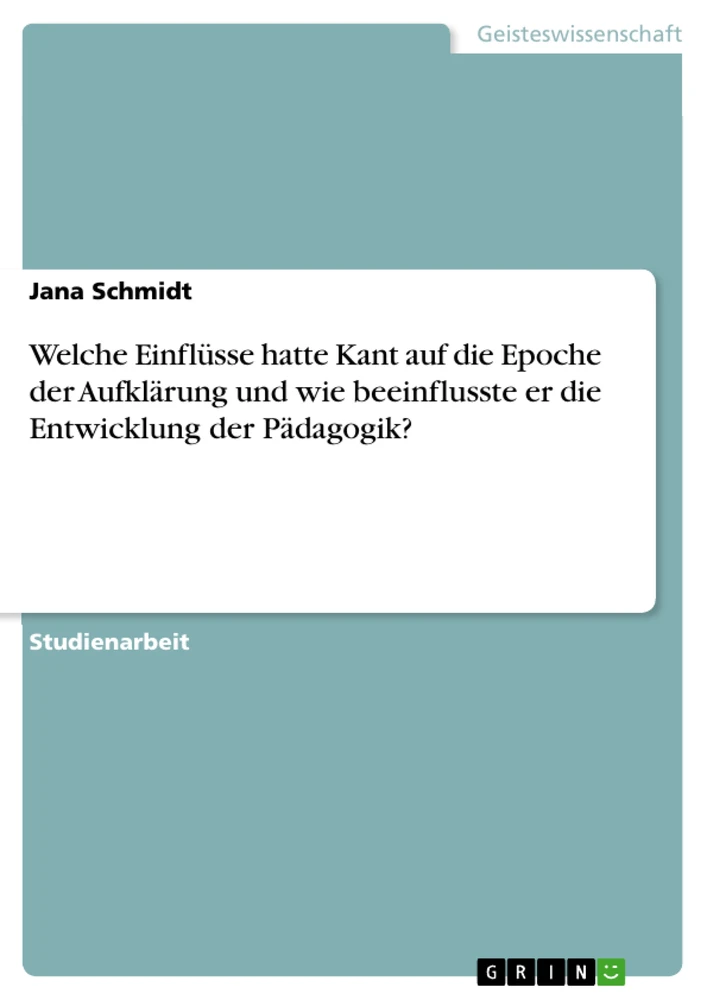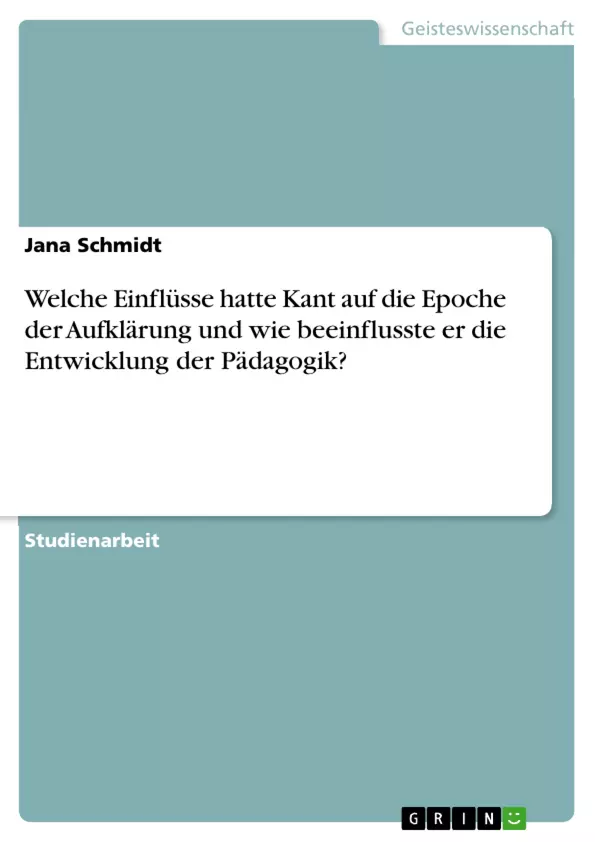Kant ist uns allen bekannt als einer der größten deutschen Philosophen. Weniger bekannt ist er jedoch für seinen Einfluss als Pädagoge. Moralphilosophie und Erziehung gehören allerdings oft zwangsläufig zusammen, zumindest wenn sie bedacht ist, den Menschen zu einem moralisch besseren Menschen zu erziehen.
Zudem ist Kant Teil der Epoche der Aufklärung, also einem Zeitalter in der die Menschen von ihrem blinden Folgen von Autoritäten, insbesondere der christlichen Kirche, abkommen sollten, und anstatt dessen selbst denken lernen sollten, um Klarheit über ihr Leben und die Welt zu bekommen. Die wissenschaftlichen Durchbrüche der Zeit unterstützten den Fortschritt der Aufklärung ebenfalls maßgeblich.
In dieser Arbeit soll zunächst ein kurzer Überblick über die Epoche der Aufklärung gegeben werden und ihre Bedeutung für die Pädagogik der Neuzeit aufgezeigt werden. Im Folgenden soll das Wirken Kants als Pädagoge in dieser Epoche verdeutlicht werden, sowie sein eigenes Verständnis von der Aufklärung. In einem nächsten Schritt wird die Erziehungsphilosophie Kants vorgestellt, sowie seine Ziele und
Zwecke. Hier soll auch deutlich werden, inwiefern die kantische Pädagogik im Zusammenhang mit Kant als Moralphilosoph steht. In einem letzten Schritt wird Bezug auf die Pädagogik in der deutschen Geschichte und der Stellenwert der Pädagogik der Aufklärung in der Geschichte, sowie in der zeitgenössischen Pädagogik genommen und überprüft, inwiefern die Pädagogik der Aufklärung heute noch relevant ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Einbettung
- Kants Einfluss auf die Aufklärung
- Erziehung bei Kant
- Sinn und Zweck der Erziehung
- Die Nachwirkung Kants in der zeitgenössischen Pädagogik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet den Einfluss von Immanuel Kant auf die Epoche der Aufklärung und die Entwicklung der Pädagogik. Sie untersucht Kants Verständnis von Aufklärung und seine Erziehungsphilosophie im Kontext der Zeit. Ziel ist es, Kants Bedeutung für die Pädagogik aufzuzeigen und die Relevanz seiner Ideen in der zeitgenössischen Pädagogik zu überprüfen.
- Kants Definition von Aufklärung und seine Kritik an der Unmündigkeit des Menschen
- Die Rolle der Vernunft und die Bedeutung des selbstständigen Denkens in Kants Erziehungsphilosophie
- Kants Verständnis von Erziehung und deren Zielsetzungen im Kontext seiner Moralphilosophie
- Die Auswirkungen von Kants Ideen auf die Entwicklung der Pädagogik im 18. Jahrhundert und darüber hinaus
- Die Relevanz der Aufklärungspädagogik in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz von Kants Pädagogik im Kontext der Aufklärung.
- Historische Einbettung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Einbettung der Aufklärung und deren Einfluss auf die Pädagogik. Es beleuchtet die Veränderungen in der gesellschaftlichen Sichtweise auf den Menschen und die Rolle der Vernunft.
- Kants Einfluss auf die Aufklärung: Dieses Kapitel analysiert Kants Verständnis von Aufklärung und seine Kritik an der Unmündigkeit des Menschen. Es geht auf Kants berühmte Aussage "Sapere aude!" (Wage es, weise zu sein!) und deren Bedeutung für die pädagogische Praxis ein.
- Erziehung bei Kant: Dieses Kapitel untersucht Kants Erziehungsphilosophie im Detail. Es behandelt seine Ziele und Zwecke der Erziehung, die Rolle der Vernunft und des selbstständigen Denkens in der Bildung.
- Sinn und Zweck der Erziehung: Dieses Kapitel analysiert Kants Verständnis von der Bedeutung der Erziehung für die Entwicklung des Menschen als moralisch handelndes Wesen. Es zeigt den Zusammenhang zwischen Kants Moralphilosophie und seiner Erziehungsphilosophie auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Aufklärung, Vernunft, Mündigkeit, Erziehung, Moral, Pädagogik und Immanuel Kant. Sie untersucht Kants Einfluss auf die Entwicklung der Pädagogik und die Bedeutung der Aufklärungspädagogik für die Gegenwart.
- Quote paper
- Jana Schmidt (Author), 2013, Welche Einflüsse hatte Kant auf die Epoche der Aufklärung und wie beeinflusste er die Entwicklung der Pädagogik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300767