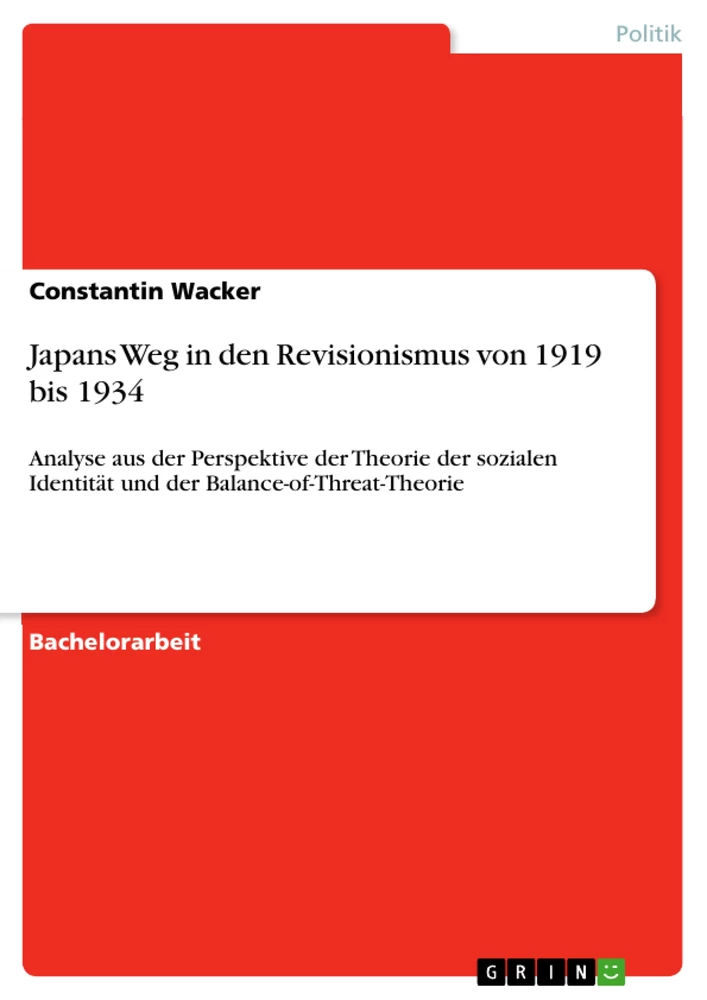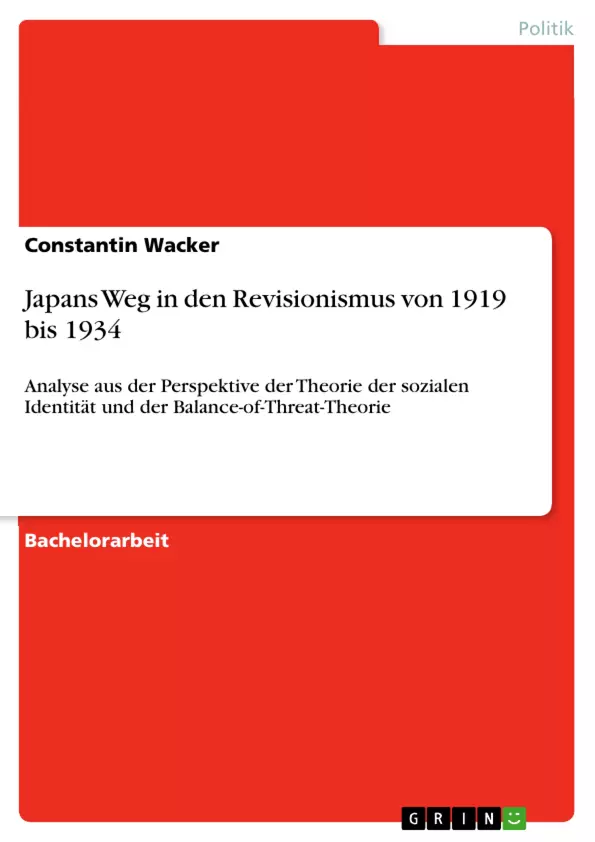In den frühen Morgenstunden des 7. Dezembers 1941 attackierten 183 Maschinen der Kaiserlich Japanischen Marineluftstreitkräfte den US-amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor. Am Folgetag erklärte das Kaiserreich Japan den Vereinigten Staaten und dem Britischen Empire den Krieg und stürzte den ostasiatisch-pazifischen Raum in die Wirren des Zweiten Weltkriegs.
Zwar hatte sich die Ausweitung des Pazifikkrieges in den Augen der japanischen Generalität durchaus als eine veritable Option präsentiert. Rückblickend kann aber mitnichten davon die Rede sein, dass die Pearl Harbor vorausgehende Expansions- und Revisionspolitik Japans eine historische Zwangläufigkeit besessen habe: Noch in den 1920er-Jahren war die Regionalmacht Japan eine der tragenden Säulen der ostasiatischen Sicherheitsarchitektur und institutionell in das „Washingtoner System“ sowie den Völkerbund eingebunden
Angesichts dessen gibt die spätestens ab 1934 in zunehmenden Maße revisionistische Außenpolitik Japans Politologen und Historikern bis zum heutigen Tag Rätsel auf: Warum beschritt die Status-quo-Macht Japan – dasjenige Land, das augenscheinlich wie kein Zweites von den Konditionen des internationalen Systems profitierte – im Laufe der Zwischenkriegszeit den Weg der Konfrontation und Aggression?
Die zeitgenössische Forschung führt eine Vielzahl von Ursachen für den japanischen Expansionismus und Imperialismus der 1930er- und 1940er-Jahre ins Feld: Machtstreben, Wachstumsbarrieren bzw. lateraler Druck, Ideologie sowie innerstaatliche Partikularinteressen. Die aufgeführten Erklärungsansätze haben indes gemein, Japans Übergang von einer affirmativen zu einer revisionistischen Politik nicht adäquat und präzise explizieren zu können. Zwei additionale Schlüssel zum Verständnis vermögen möglicherweise die Balance-of-Threat-Theorie (BOT) und die sozialpsychologische Theorie der sozialen Identität (SIT) zu liefern.
Kontrastiert werden soll die Sicherheitsperspektive durch die Heranziehung von Henri Tajfels und John C. Turners Theorie der sozialen Identität, die in der vergangenen Dekade auch in der politologischen Subdisziplin der Internationalen Beziehungen (IB) an Prominenz erlangt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Gliederung
- Theorie und Vorgehensweise
- Balance-of-Threat-Theorie (BOT)
- Theorie der sozialen Identität (SIT)
- Vorgehensweise
- Abhängige Variable: Revisionismus in den internationalen Beziehungen
- Unabhängige Variablen: Statusimmobilität und Bedrohungsperzeption
- Japans Weg in den Revisionismus 1919-1934
- Exkurs: Japan vor dem Ersten Weltkrieg
- Ambivalente Nachkriegsphase 1919-1921/22
- Kooperationsphase 1922-1931
- Phase des Abgleitens in den Revisionismus 1931-1934
- Analyse aus Perspektive der BOT und der SIT
- Analyse aus Perspektive der Balance-of-Threat-Theorie (BOT)
- Exkurs: Japan vor dem Ersten Weltkrieg
- Affirmative Phase 1919-1931
- Revisionistische Phase 1931-1934
- Analyse aus Perspektive der Theorie der sozialen Identität (SIT)
- Exkurs: Japan vor dem Ersten Weltkrieg
- Affirmative Phase 1919-1931
- Revisionistische Phase 1931-1934
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Japans Weg in den Revisionismus in der Zeit von 1919 bis 1934. Sie analysiert die Ursachen für Japans Wandel von einer kooperativen zu einer revisionistischen Außenpolitik aus der Perspektive der Balance-of-Threat-Theorie (BOT) und der Theorie der sozialen Identität (SIT).
- Die Rolle der Statusimmobilität und der Bedrohungsperzeption als Triebkräfte des japanischen Revisionismus
- Die Bedeutung von Statusbedürfnissen und Identitätsinstandhaltungsstrategien in der internationalen Politik
- Die Anwendung der BOT und der SIT auf den Fall Japans in der Zwischenkriegszeit
- Die Analyse der spezifischen historischen und politischen Rahmenbedingungen, die Japans Revisionismus begünstigten
- Die Einordnung des japanischen Revisionismus in den Kontext der internationalen Beziehungen im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und führt in die Forschungsfrage ein. Sie beleuchtet den historischen Hintergrund des japanischen Revisionismus und zeigt die Notwendigkeit auf, alternative Erklärungsansätze jenseits der traditionellen Machtpolitik zu erforschen. Kapitel 2 präsentiert die theoretischen Grundlagen der Arbeit: die Balance-of-Threat-Theorie und die Theorie der sozialen Identität. Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung Japans in der Zwischenkriegszeit und zeichnet den Weg von einer kooperativen zu einer revisionistischen Außenpolitik nach. Kapitel 4 analysiert Japans Verhalten aus der Perspektive der BOT und der SIT. Das Resümee fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Revisionismus, Balance-of-Threat-Theorie, Theorie der sozialen Identität, Statusimmobilität, Bedrohungsperzeption, Statusbedürfnisse, Identitätsinstandhaltungsstrategien, Japan, Zwischenkriegszeit, Internationale Beziehungen, Außenpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wandelte sich Japans Außenpolitik zwischen 1919 und 1934 zum Revisionismus?
Die Arbeit untersucht dies mithilfe der Balance-of-Threat-Theorie (BOT) und der Theorie der sozialen Identität (SIT). Zentrale Faktoren waren Statusimmobilität und eine veränderte Bedrohungsperzeption.
Was war das „Washingtoner System“?
Es war die Sicherheitsarchitektur der 1920er-Jahre, in die Japan als tragende Säule eingebunden war. In dieser Phase verfolgte Japan eine kooperative Status-quo-Politik.
Was besagt die Theorie der sozialen Identität (SIT) im Kontext Japans?
Die SIT erklärt Japans Verhalten durch das Bedürfnis nach Status und Identitätswahrung. Wenn Japan seinen Status im internationalen System als gefährdet oder blockiert ansah, förderte dies den Weg in die Konfrontation.
Welche Phasen der japanischen Außenpolitik werden unterschieden?
Es wird zwischen einer ambivalenten Nachkriegsphase (1919-1922), einer Kooperationsphase (1922-1931) und dem Abgleiten in den Revisionismus (1931-1934) unterschieden.
War der Angriff auf Pearl Harbor eine historische Zwangsläufigkeit?
Nein, die Arbeit argumentiert, dass Japan in den 1920er-Jahren fest in internationale Institutionen wie den Völkerbund integriert war und der Weg in den Krieg das Ergebnis spezifischer Entwicklungen in der Zwischenkriegszeit war.
- Quote paper
- Constantin Wacker (Author), 2015, Japans Weg in den Revisionismus von 1919 bis 1934, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300798