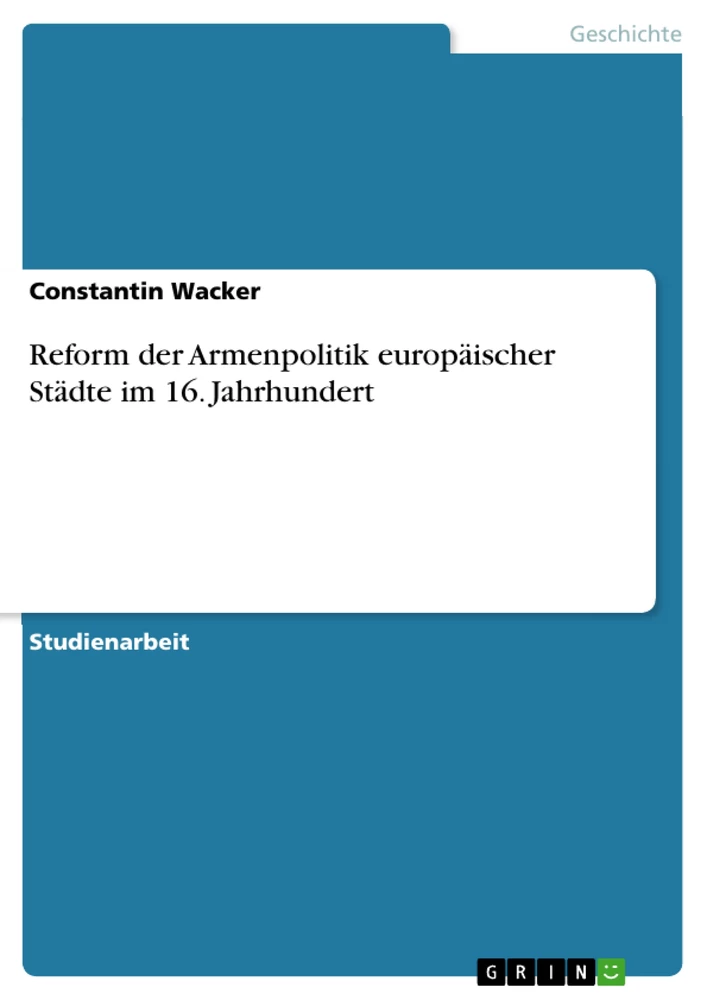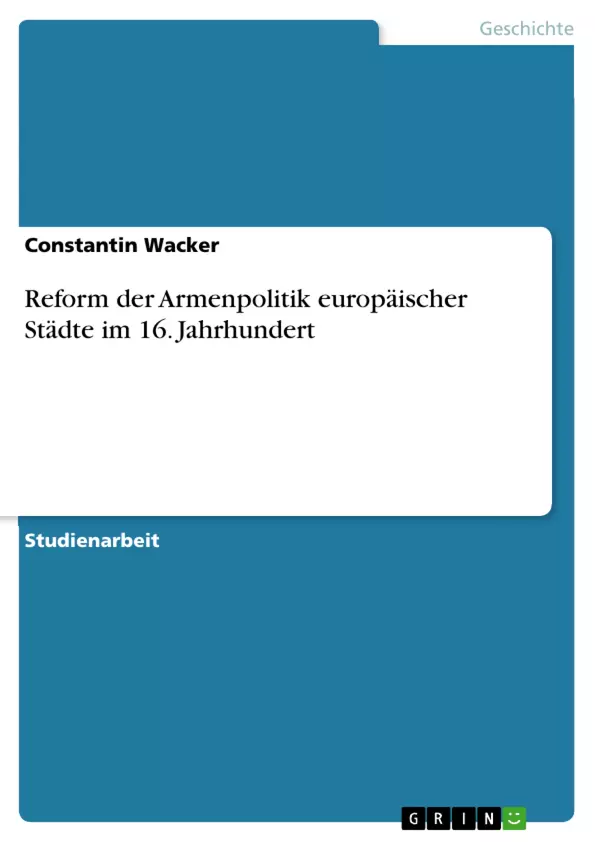Die Armutsproblematik und ihre gesellschaftliche Wahrnehmung ziehen sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte.
In den westeuropäischen Wohlstandsgesellschaften der Gegenwart sehen die Bürger in erster Linie den Staat in der Verantwortung für sozial- und armenpolitische Maßnahmen. Historisch betrachtet stellt diese bürokratisch strukturierte Organisationsform der Armenpolitik jedoch keine Selbstverständlichkeit dar. Die Anfänge der heutigen zentral geplanten und gesteuerten Wohlfahrtstätigkeit europäischer Fasson lassen sich bis in die 1520er-Jahre zurückverfolgen. Zu jener vornationalstaatlichen Zeit emanzipierten sich die europäischen Kommunen von der mittelalterlichen Praxis der unorganisierten individuellen Almosenvergabe und beschritten den Weg der Zentralisierung und Institutionalisierung auf diesem Terrain.
Welche Bedingungsfaktoren für diese Kehrtwende in der städtischen Armenpolitik des 16. Jh. ausschlaggebend waren, bleibt im geschichtswissenschaftlichen Diskurs umstritten. In Anbetracht der Kontinuitätslinien dieser Ereignisse bis in die Gegenwart setzt sich diese Hausarbeit zum Ziel, den Ursachen für diesen Wendepunkt in der kommunalen obrigkeitlichen Armenpolitik in Europa auf den Grund zu gehen. Dieses Vorhaben setzt eine Analyse der wesentlichen Strukturmerkmale und Institutionen der modernisierten Armenpolitik des 16. Jh. im Spannungsfeld zwischen Fürsorge, Kontrolle und Repression voraus.
Obgleich das besondere Augenmerk dieser Hausarbeit auf die Zeitspanne von 1500 bis 1600 gerichtet ist, erachte ich die Einbeziehung der vorherigen und nachfolgenden Jahrhunderte für ein um-fassendes Verständnis der Prozesshaftigkeit des Wandels in der Armengesetzgebung für unerlässlich. Bevor sich der munizipalen Armutspolitik des 16. Jh. zugewandt werden kann, stelle ich in einem ersten Schritt eine von Sozialhistorikern herangezogene Begriffsdefinition der Armut voran und determiniere den Adressatenkreis eines solchen zielgerichteten politischen Handelns. Daraufhin gehe ich in einem zweiten Schritt auf die konkrete Ausgestaltung der Armenreform des 16. Jh. ein. Mit Hinweis auf die aufgetretenen Implementationsdefizite dieser erlassenen Armen- und Bettelordnungen folgt eine kritische Hinterfragung ihrer Bilanz, bevor ich mich mit den in der geschichts-wissenschaftlichen Kontroverse vorgebrachten Ursachen und Bedingungsfaktoren für die kommunale Armenreform befasse. Am Ende der Hausarbeit steht ein Resümee.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Armut an der Schwelle zur Frühen Neuzeit
- Armutsdefinition
- Objekte der Armenpolitik: Die „Pauperes“
- Wandel der städtischen Armenpolitik im 16. Jahrhundert
- Städtische Armengesetzgebung zwischen Fürsorge, Kontrolle und Repression
- Bilanz der neuausgerichteten Armenpolitik des 16. Jahrhunderts
- Ursachen der städtischen Armenreform des 16. Jahrhunderts
- Armenreform als Reaktion auf die Pauperisierung zu Beginn der Frühen Neuzeit
- Armenreform als Verdienst der Reformation
- Armenreform als Teilaspekt der Entwicklung der Magistrate zu „Obrigkeiten“
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen der Reform der kommunalen Armenpolitik in Europa im 16. Jahrhundert. Sie analysiert die wesentlichen Strukturmerkmale und Institutionen der modernisierten Armenpolitik im Spannungsfeld zwischen Fürsorge, Kontrolle und Repression. Die Arbeit betrachtet dabei die Entwicklung der Armenpolitik im Kontext der sozio-ökonomischen und politischen Veränderungen der Frühen Neuzeit.
- Die Entwicklung der Armenpolitik im 16. Jahrhundert als Reaktion auf die Pauperisierung und die sozio-ökonomischen Krisen der Zeit.
- Der Einfluss der Reformation auf die Armenpolitik und die Rolle der Kirche in der Armenfürsorge.
- Die Entwicklung der städtischen Magistrate zu „Obrigkeiten“ und die damit verbundene Institutionalisierung der Armenpolitik.
- Die Herausforderungen der Armengesetzgebung im Spannungsfeld zwischen Fürsorge, Kontrolle und Repression.
- Die Bilanz der Armenreform und ihre Auswirkungen auf die städtische Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Armenpolitik im 16. Jahrhundert ein und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet die Armutsdefinition und die sozialen Gruppen, die von Armut betroffen waren. Das dritte Kapitel analysiert den Wandel der städtischen Armenpolitik im 16. Jahrhundert und diskutiert die Ursachen der Reform. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Armengesetzgebung, der Bilanz der Reform und den verschiedenen Erklärungsmodellen für die Veränderungen. Das Resümee fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Armenpolitik.
Schlüsselwörter
Armenpolitik, Frühe Neuzeit, Pauperisierung, Reformation, Magistrate, Fürsorge, Kontrolle, Repression, Städtische Gesellschaft, Sozio-ökonomische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Warum änderte sich die Armenpolitik im 16. Jahrhundert?
Die Änderung war eine Reaktion auf die zunehmende Massenarmut (Pauperisierung) und den Wunsch der Städte nach mehr sozialer Kontrolle und Ordnung.
Welchen Einfluss hatte die Reformation auf die Armenfürsorge?
Die Reformation führte zur Säkularisierung der Fürsorge, wodurch die Verantwortung von der Kirche auf die städtischen Magistrate überging.
Was ist der Unterschied zwischen „würdigen“ und „unwürdigen“ Armen?
Städte unterschieden zwischen unverschuldet Armen (Kranke, Witwen) und arbeitsfähigen Bettlern, die oft mit Repression und Arbeitszwang konfrontiert wurden.
Was war das Ziel der neuen Bettelordnungen?
Ziele waren die Zentralisierung der Almosenvergabe, das Verbot des wilden Bettelns und die systematische Erfassung der Hilfsbedürftigen.
Wie entwickelte sich die Rolle der Magistrate?
Die städtischen Verwaltungen entwickelten sich zu „Obrigkeiten“, die Fürsorge als Teil ihrer staatlichen Kontroll- und Erziehungsaufgabe verstanden.
- Quote paper
- Constantin Wacker (Author), 2013, Reform der Armenpolitik europäischer Städte im 16. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300802