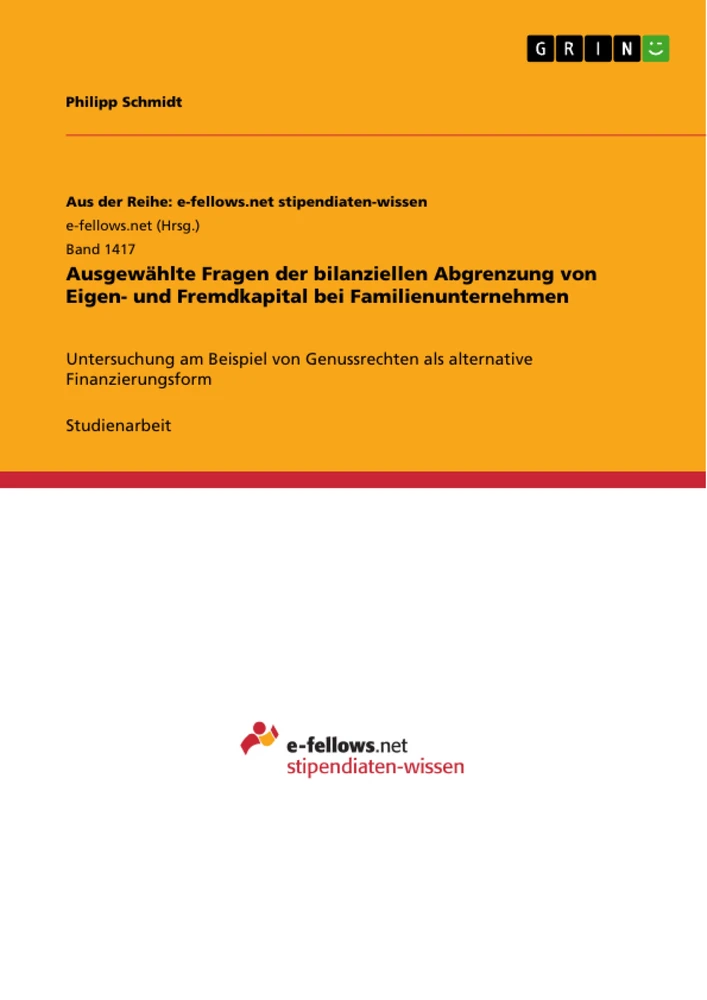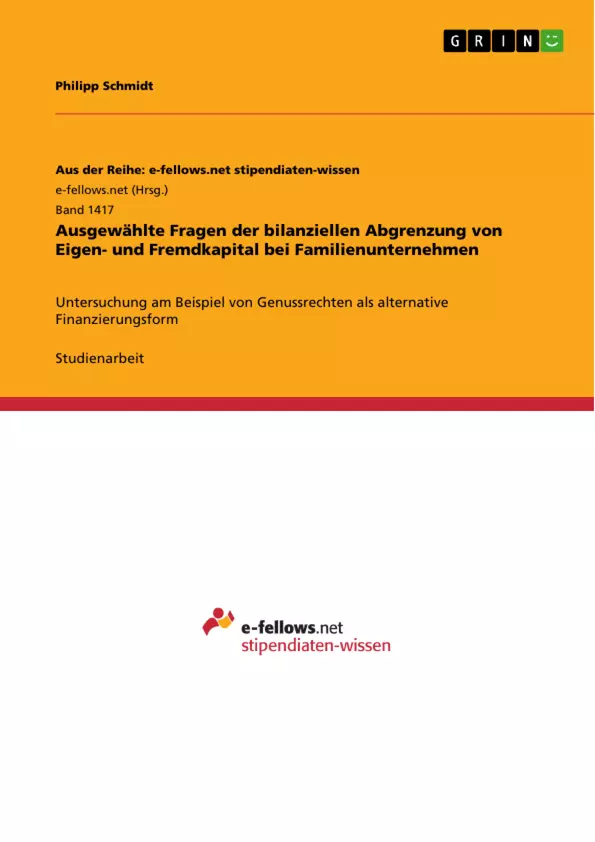Diese Arbeit setzt sich am Beispiel von Genussrechten mit der bilanziellen Abgrenzung von Mezzaninen Finanzierungsformen bei Familienunternehmen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) auseinander. Genussrechte sind besonders aktuell in den Medien. Erst vor kurzem erschien ein großer Artikel über Genussrechte in der Zeitschrift Focus Money, in dem auf deren „Zwitter[form] aus Aktie und Anleihe“ eingegangen wurde. Diese etwas andere Form der Finanzierung stellt in der heutigen Zeit für viele Unternehmen eine Alternative zum klassischen Bankkredit oder Aktien dar. Diese Finanzierungsform wird für Unternehmen immer interessanter, vor allem durch die Eigenkapitalvorschriften von Basel II bzw. III, aufgrund derer die Kreditvergabe der Banken immer restriktiver wird.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, wie Genussrechte abgegrenzt werden, also wann diese als Eigen- oder Fremdkapital in der Bilanz auszuweisen sind. Was für Auswirkungen sind mit der jeweils unterschiedlichen Bilanzierung verbunden? Es soll dabei folgende vom Autor aufgestellte These überprüft werden: Genussrechte werden von Unternehmen nicht (mehr) als Fremdkapital bilanziert!
Es wird dabei die Frage aufgeworfen, warum es sich überhaupt lohnt, Genussrechte als Eigenkapital zu bilanzieren. Es sollen die Hintergründe untersucht werden, wieso viele Unternehmen anscheinend dieses Ziel verfolgen. Was für Vorteile erhoffen sich bzw. erlangen Firmen dadurch? Im Handelsgesetzbuch (HGB) finden sich zum Thema Genussrechte kaum aufschlussreiche Hinweise zur Gestaltung, geschweige denn dazu, wie diese bilanziell abzugrenzen sind. Fraglich ist daher, wie viele Gestaltungsspielräume den Unternehmen für die Bilanzierung bleiben und ob es trotzdem einheitliche Bilanzierungsvorschriften gibt. Denn dies ist notwendig, damit der Jahresabschluss der Unternehmen für einen Dritten vergleichbar bleibt. Das Problem soll sowohl aus Rechnungslegungsperspektive, als auch aus finanzwirtschaftlicher Sicht beleuchtet werden, um einen umfassenden Überblick über die Thematik zu erhalten.
Es sollen zudem anhand eines fiktiven Zahlenbeispiels die Auswirkungen der jeweiligen Bilanzierung aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Genussrechte als alternative Finanzierungsform
- Genussrechte aus finanzwirtschaftlicher Perspektive
- Betrachtung aus der Rechnungslegungsperspektive
- Kriterien zur bilanziellen Abgrenzung
- Ausweis in der Bilanz
- Konkretes Beispiel
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die bilanziellen Abgrenzungen von Mezzanine-Finanzierungsformen, insbesondere Genussrechten, bei Familienunternehmen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Die Arbeit analysiert die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen von Genussrechten und beleuchtet die rechnungslegungsrelevanten Aspekte der Bilanzierung als Eigen- oder Fremdkapital.
- Bilanziellen Abgrenzung von Genussrechten als Eigen- oder Fremdkapital
- Finanzwirtschaftliche Auswirkungen von Genussrechten auf Bilanzkennzahlen
- Rechnungslegungsperspektiven und Kriterien zur Abgrenzung
- Gestaltungsspielräume für Unternehmen bei der Bilanzierung von Genussrechten
- Vorteile und Nachteile der Bilanzierung als Eigenkapital
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Diese Arbeit analysiert die bilanziellen Abgrenzungen von Mezzanine-Finanzierungsformen, speziell Genussrechten, bei Familienunternehmen nach dem HGB. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und warum Genussrechte als Eigen- oder Fremdkapital bilanziert werden und welche Auswirkungen dies hat. Die Arbeit untersucht die Relevanz der Bilanzierung für die Unternehmensbewertung und -finanzierung und beleuchtet die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Gestaltungsspielräume für Unternehmen.
Genussrechte als alternative Finanzierungsform: Dieses Kapitel beschreibt Genussrechte als Inhaberpapiere, die eine Zwischenform zwischen Anleihe und Aktie darstellen. Es wird erläutert, dass Genussrechte einen schuldrechtlichen Anspruch auf Gewinn- oder Liquidationserlös gewähren, aber im Gegensatz zu Aktien keine Stimmrechte beinhalten. Die flexible Gestaltungsmöglichkeit und die Möglichkeit der direkten Ausgabe an Mitarbeiter oder Kunden machen Genussrechte zu einer attraktiven Finanzierungsalternative zu klassischen Bankkrediten oder Aktienemissionen, besonders im Kontext der verschärften Eigenkapitalvorschriften (Basel II/III).
Genussrechte aus finanzwirtschaftlicher Perspektive: Dieses Kapitel befasst sich mit den finanzwirtschaftlichen Aspekten von Genussrechten. Es untersucht die Bedingungen, unter denen Genussrechte für Unternehmen eine attraktive Kapitalbeschaffungsform und für Kapitalgeber eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Ein wichtiger Aspekt ist die Erhaltung der Beteiligungsverhältnisse, da Genussrechtsinhaber in der Regel keine Mitgliedschaftsrechte haben. Die Bilanzierung als Eigenkapital wird als vorteilhaft dargestellt, da sie die Eigenkapitalbasis stärkt, die Fremdkapitalquote nicht erhöht und somit die Bonität und Kreditwürdigkeit verbessert. Dies ist besonders für KMU von Bedeutung, da es ihnen alternative Finanzierungsquellen eröffnet.
Betrachtung aus der Rechnungslegungsperspektive: Dieses Kapitel beleuchtet die rechnungslegungsrelevanten Aspekte der Genussrechte. Es werden die Kriterien zur bilanziellen Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital im Kontext von Genussrechten diskutiert, sowie die korrekte Darstellung in der Bilanz erläutert. Es wird auf die Notwendigkeit einheitlicher Bilanzierungsvorschriften hingewiesen, um die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen zu gewährleisten. Ein konkretes Beispiel verdeutlicht die Auswirkungen unterschiedlicher Bilanzierungen auf die Bilanzkennzahlen.
Schlüsselwörter
Genussrechte, Mezzanine-Finanzierung, Familienunternehmen, HGB, Bilanzierung, Eigenkapital, Fremdkapital, Rechnungslegung, Finanzwirtschaft, Bilanzkennzahlen, Bonität, Kreditwürdigkeit, Kapitalbeschaffung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bilanzierung von Genussrechten bei Familienunternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die bilanziellen Abgrenzungen von Mezzanine-Finanzierungsformen, insbesondere Genussrechten, bei Familienunternehmen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Der Fokus liegt auf der Frage, ob und warum Genussrechte als Eigen- oder Fremdkapital bilanziert werden und welche Auswirkungen dies hat. Die Arbeit analysiert die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen und beleuchtet die rechnungslegungsrelevanten Aspekte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die bilanziellen Abgrenzungen von Genussrechten als Eigen- oder Fremdkapital, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf Bilanzkennzahlen, die Rechnungslegungsperspektiven und Kriterien zur Abgrenzung, Gestaltungsspielräume für Unternehmen bei der Bilanzierung und die Vor- und Nachteile der Bilanzierung als Eigenkapital.
Was sind Genussrechte und wie werden sie als Finanzierungsform beschrieben?
Genussrechte werden als Inhaberpapiere beschrieben, die eine Zwischenform zwischen Anleihe und Aktie darstellen. Sie gewähren einen schuldrechtlichen Anspruch auf Gewinn- oder Liquidationserlös, beinhalten aber im Gegensatz zu Aktien keine Stimmrechte. Ihre flexible Gestaltung und die Möglichkeit der direkten Ausgabe an Mitarbeiter oder Kunden machen sie zu einer attraktiven Finanzierungsalternative.
Welche finanzwirtschaftlichen Aspekte von Genussrechten werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Bedingungen, unter denen Genussrechte für Unternehmen eine attraktive Kapitalbeschaffungsform und für Kapitalgeber eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. Ein wichtiger Aspekt ist die Erhaltung der Beteiligungsverhältnisse, da Genussrechtsinhaber in der Regel keine Mitgliedschaftsrechte haben. Die Bilanzierung als Eigenkapital wird als vorteilhaft dargestellt, da sie die Eigenkapitalbasis stärkt und die Bonität verbessert.
Wie werden die rechnungslegungsrelevanten Aspekte der Genussrechte behandelt?
Das Kapitel beleuchtet die Kriterien zur bilanziellen Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital im Kontext von Genussrechten, die korrekte Darstellung in der Bilanz und die Notwendigkeit einheitlicher Bilanzierungsvorschriften zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen. Ein konkretes Beispiel verdeutlicht die Auswirkungen unterschiedlicher Bilanzierungen auf die Bilanzkennzahlen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Genussrechte, Mezzanine-Finanzierung, Familienunternehmen, HGB, Bilanzierung, Eigenkapital, Fremdkapital, Rechnungslegung, Finanzwirtschaft, Bilanzkennzahlen, Bonität, Kreditwürdigkeit, Kapitalbeschaffung.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Problemstellung, Genussrechte als alternative Finanzierungsform, Genussrechte aus finanzwirtschaftlicher Perspektive, Betrachtung aus der Rechnungslegungsperspektive (mit Unterkapiteln zu Kriterien zur bilanziellen Abgrenzung, Ausweis in der Bilanz und einem konkreten Beispiel) und Thesenförmige Zusammenfassung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere im Bereich Rechnungswesen und Finanzwirtschaft, sowie für Praktiker in Familienunternehmen und Unternehmensberatung, die sich mit der Finanzierung und Bilanzierung von Unternehmen befassen.
- Quote paper
- Philipp Schmidt (Author), 2013, Ausgewählte Fragen der bilanziellen Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital bei Familienunternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300987