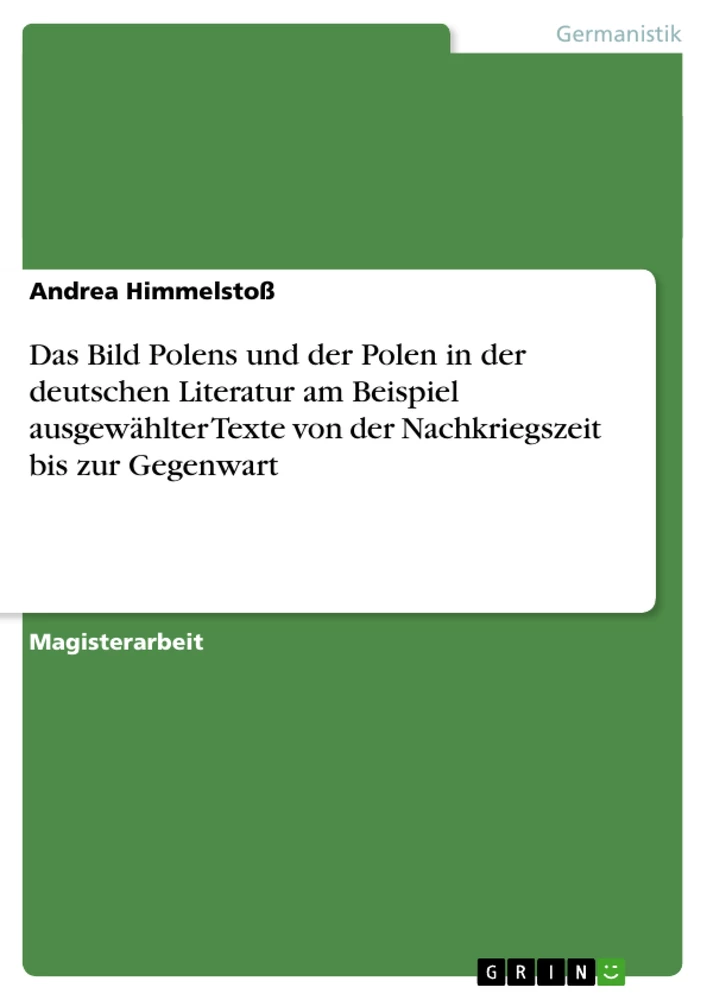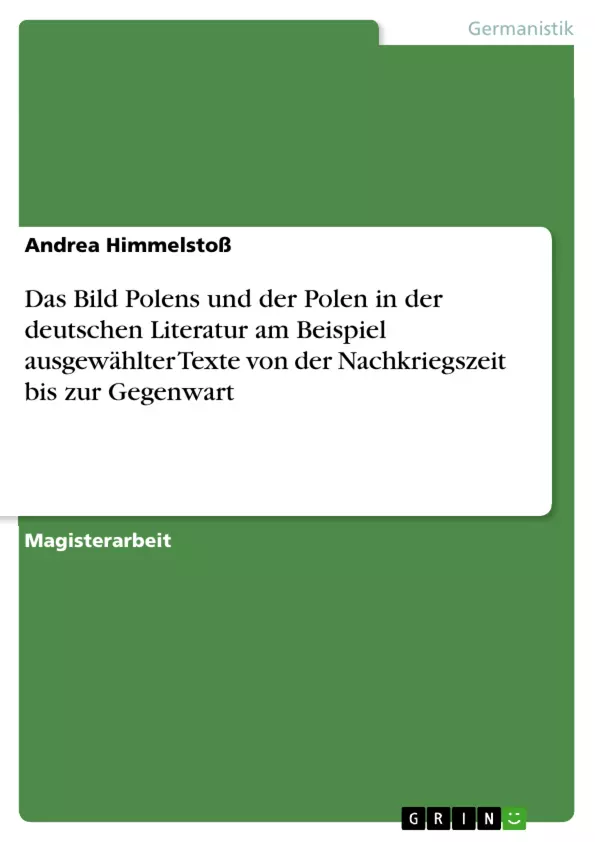Eines wird schnell deutlich auf der Zugfahrt durch Niederschlesien von der deutschen Grenze, von Dresden und Görlitz, in Richtung Breslau : Alles ist polnisch…
Weil sie in ihrer Umhängetasche aus Kalbsleder jederzeit zwei von den sechs [Einkaufsnetzen, AH] mit sich führte, leitete er diese Vorsorge von der in allen Ostblockstaaten herrschenden Mangelwirtschaft ab: ‚Plötzlich gibt es irgendwo frischen Blumenkohl, …
Zwei Menschen beschreiben ihre Eindrücke in Polen. Der – nicht fiktive - Journalist Strothmann leitet seine Reportage „Polens Wille zum Wandel“ mit Feststellungen ein, die zu einigen polemischen Bemerkungen herausfordern könnten. Doch soll ein Vergleich zur Illustration genügen: Türkei- oder Amerikareisende werden sich wohl kaum darüber wundern, wenn sie in ein Land einreisen, in dem kein Deutsch gesprochen und verstanden wird. Man mag dem Autor zugute halten, daß er mit seinen Feststellungen auf die wechselvolle Geschichte Niederschlesiens anspielen will. Man kann aber auch zu dem Schluß kommen, daß Strothmann hier ein gewisses Mißtrauen ausdrückt, wenn er sagt, daß Kenntnisse der deutschen Sprache auf Seiten der Polen, die ihm begegnen, nicht erkennbar sind. Denn dies impliziert ja, daß sie dem Fremden, womöglich der polnischen Sprache Unkundigen, reserviert entgegentreten. Was der Autor aufgrund der Rolle der Deutschen in der Vergangenheit sicher auch verstehen würde, so scheint es mitzuklingen. Und gerade diese subtile Mischung von Mißtrauen und Verständnis ist es, welche die Wirksamkeit der Vorbehalte deutlich macht. Verständnis basiert hier auf der Nutzung des Verstandes, ist rational begründet und wird positiv bewertet. Doch unter der Schicht des Verständnisses entlarvt der Autor die emotionale Ebene seines Mißtrauens unbeabsichtigt selbst. Die Beschreibung der Freundlichkeit und des Bemühens um Kontakt, denen er begegnet, ist nur auf den ersten Blick positiv konnotiert. Ist es doch nur ein Lächeln, mit dem man mit ihm kommuniziert. Darüber hinaus erinnert seine Beschreibung der Kontaktaufnahme bei ungenügender fremdsprachlicher Qualifikation an die Beschreibung von Ureinwohnern in zu kolonisierenden Gebieten. Die eigene Unfähigkeit, die Menschen in deren Muttersprache anzusprechen, wird nicht reflektiert und keineswegs in Frage gestellt, die Muttersprache des Reisenden erscheint als Maßstab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Fragestellung
- 2.1 Gegenstand der Untersuchung
- 2.2 Der Einfluß von Stereotypen
- 2.3 Kategorien
- 2.4 Zwischen Panorama und Spiegelbild
- 2.5 Literarische Bilder vom Land Polen und von polnischen Menschen
- 3. Zur Illustration des Bisherigen: Bestandsaufnahme
- 3.1 Die Zeit der Polenlieder
- 3.2 Der Umschwung
- 4. Bilder der polnischen Nation
- 4.1 Die Verwendung nationalistischer Termini in der Literatur
- 4.2 Die Vermeidung von Nationalitätsbezeichnungen
- 4.3 „E bißche vom polnischen Leichtsinn“
- 4.4 Nationalität als abgrenzende Eigenschaft
- 4.5 Die Relativität von nationalen Stereotypen
- 4.6 Von der Ebene des Konkreten zu übergreifenden Erklärungen
- 5. Bilder der Individuen
- 5.1 Zwischen deklarierter Völkerfreundschaft und Individualität
- 5.2 Gemeinsamkeiten
- 5.3 Einzelne Menschen im Fokus der literarischen Beschreibung
- 5.3.1 Die Witwe Piątkowska
- 5.3.2 Kindheiten
- 5.4 Objekte im Zoom
- 6. Wahrgenommenes
- 6.1 Städtebilder
- 6.2 „Daß Häuser altern, hast du gewußt“
- 6.3 Landschaften
- 6.4 Ausdruck der Eindrücke
- 7. Alltagsdarstellungen - Die Bedingtheit des täglichen Lebens
- 7.1 Gastfreundschaft
- 7.2 Auseinandersetzungen
- 7.3 Markttage
- 7.4 Schwarzmarkt und Jugend
- 7.5 Entwicklungen: Kirche und Solidarność
- 7.6 Maßstäbe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung Polens und der Polen in der deutschen Literatur von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Ziel ist es, die verwendeten Bilder und Stereotype zu analysieren und deren Entwicklung im Kontext der deutsch-polnischen Geschichte und der politischen Systeme zu beleuchten. Die Arbeit hinterfragt, inwieweit die Literatur zur Reflexion über Vorurteile und zur Entwicklung eines differenzierten Polenbildes beigetragen hat.
- Die Entwicklung von Stereotypen über Polen in der deutschen Literatur.
- Der Einfluss der deutsch-polnischen Geschichte auf die literarische Darstellung.
- Die Rolle von Nationalität und Individualität in den literarischen Bildern.
- Die Darstellung des polnischen Alltagslebens in der Literatur.
- Die Frage nach der Reflexion von Vorurteilen in der Literatur.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit persönlichen Eindrücken einer Zugfahrt durch Niederschlesien, die den Fokus auf die sprachliche und kulturelle Andersartigkeit Polens lenkt. Sie dient als Aufhänger für die folgende Untersuchung der Darstellung Polens in der deutschen Literatur, wobei der Autor bereits implizite Vorurteile und die Schwierigkeit einer unvoreingenommenen Betrachtung thematisiert.
2. Zur Fragestellung: Dieses Kapitel definiert den Gegenstand der Untersuchung – die Darstellung Polens in der deutschen Literatur – und beschreibt die methodischen Ansätze. Es erläutert den Einfluss von Stereotypen auf die Wahrnehmung und deren Rolle in der literarischen Darstellung. Es wird die Notwendigkeit einer differenzierten Analyse betont, um die Bildung von Vorurteilen entgegenzuwirken.
3. Zur Illustration des Bisherigen: Bestandsaufnahme: Dieses Kapitel bietet eine historische Übersicht über die Darstellung Polens in der deutschen Literatur, beginnend mit der „Zeit der Polenlieder“ und dem darauffolgenden Wandel in der Wahrnehmung. Es legt den Grundstein für die detailliertere Analyse der folgenden Kapitel.
4. Bilder der polnischen Nation: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung nationalistischer Begriffe und die Vermeidung von Nationalitätsbezeichnungen in der deutschen Literatur. Es untersucht die verschiedenen Stereotype, die mit Polen verbunden sind (z.B. Leichtsinn, Religiosität) und deren Relativität im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.
5. Bilder der Individuen: Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Darstellung einzelner polnischer Personen in der deutschen Literatur. Es untersucht die Balance zwischen der Darstellung von Gemeinsamkeiten und der Hervorhebung individueller Charaktere. Die Analyse fokussiert auf Beispiele, um die Vielschichtigkeit der literarischen Bilder zu verdeutlichen.
6. Wahrgenommenes: Dieses Kapitel befasst sich mit der literarischen Darstellung von Städten, Landschaften und dem Ausdruck von Eindrücken in Bezug auf Polen. Es untersucht, wie die Wahrnehmung der Umwelt die literarische Gestaltung beeinflusst und wie diese Wahrnehmung wiederum von Vorurteilen geprägt sein kann.
7. Alltagsdarstellungen - Die Bedingtheit des täglichen Lebens: Der letzte analysierte Abschnitt befasst sich mit der Darstellung des polnischen Alltagslebens in der deutschen Literatur, einschließlich Gastfreundschaft, Auseinandersetzungen, Markttagen, Schwarzmarkt und der Entwicklungen rund um Kirche und Solidarność. Es wird untersucht, wie diese Alltagsaspekte die literarischen Bilder Polens prägen und welche Bedeutung ihnen zugeschrieben wird.
Schlüsselwörter
Polen, Deutschland, Literatur, Stereotype, Nationalität, Identität, Nachkriegszeit, Wendezeit, Deutsch-polnische Beziehungen, Vorurteile, Alltagsdarstellung, nationale Bilder, individuelle Darstellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung Polens in der deutschen Literatur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Darstellung Polens und der polnischen Bevölkerung in der deutschen Literatur von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Der Fokus liegt auf der Analyse der verwendeten Bilder und Stereotype sowie deren Entwicklung im Kontext der deutsch-polnischen Geschichte und der jeweiligen politischen Systeme.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die in der Literatur verwendeten Bilder und Stereotype über Polen und deren Entwicklung. Sie beleuchtet den Einfluss der deutsch-polnischen Geschichte auf diese Darstellungen und hinterfragt, inwieweit die Literatur zur Reflexion über Vorurteile und zur Entwicklung eines differenzierten Polenbildes beigetragen hat.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von Stereotypen über Polen in der deutschen Literatur, den Einfluss der deutsch-polnischen Geschichte auf die literarische Darstellung, die Rolle von Nationalität und Individualität in den literarischen Bildern, die Darstellung des polnischen Alltagslebens und die Frage nach der Reflexion von Vorurteilen in der Literatur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Fragestellung (mit Unterpunkten zu Gegenstand der Untersuchung, Einfluss von Stereotypen, Kategorien, Panorama und Spiegelbild, literarische Bilder), Bestandsaufnahme (Polenlieder und Umschwung), Bilder der polnischen Nation (nationalistische Termini, Vermeidung von Nationalitätsbezeichnungen, Stereotype), Bilder der Individuen (Völkerfreundschaft und Individualität, Gemeinsamkeiten, Einzelne Menschen im Fokus, Objekte), Wahrgenommenes (Städtebilder, Landschaften, Ausdruck der Eindrücke) und Alltagsdarstellungen (Gastfreundschaft, Auseinandersetzungen, Markttage, Schwarzmarkt, Kirche und Solidarność, Maßstäbe).
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die methodischen Ansätze zur Analyse der literarischen Darstellungen Polens, betont die Notwendigkeit einer differenzierten Analyse, um Vorurteilen entgegenzuwirken und verwendet Literaturbeispiele zur Veranschaulichung der Ergebnisse.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Für jedes Kapitel (Einleitung, Fragestellung, Bestandsaufnahme, Bilder der polnischen Nation, Bilder der Individuen, Wahrgenommenes, Alltagsdarstellungen) gibt es eine Zusammenfassung, die den jeweiligen Inhalt und die wichtigsten Ergebnisse kurz beschreibt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Polen, Deutschland, Literatur, Stereotype, Nationalität, Identität, Nachkriegszeit, Wendezeit, Deutsch-polnische Beziehungen, Vorurteile, Alltagsdarstellung, nationale Bilder, individuelle Darstellung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bietet einen Überblick. Für detailliertere Informationen konsultieren Sie bitte den vollständigen Text der Arbeit.
- Citar trabajo
- Magister Artium Andrea Himmelstoß (Autor), 2000, Das Bild Polens und der Polen in der deutschen Literatur am Beispiel ausgewählter Texte von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30102