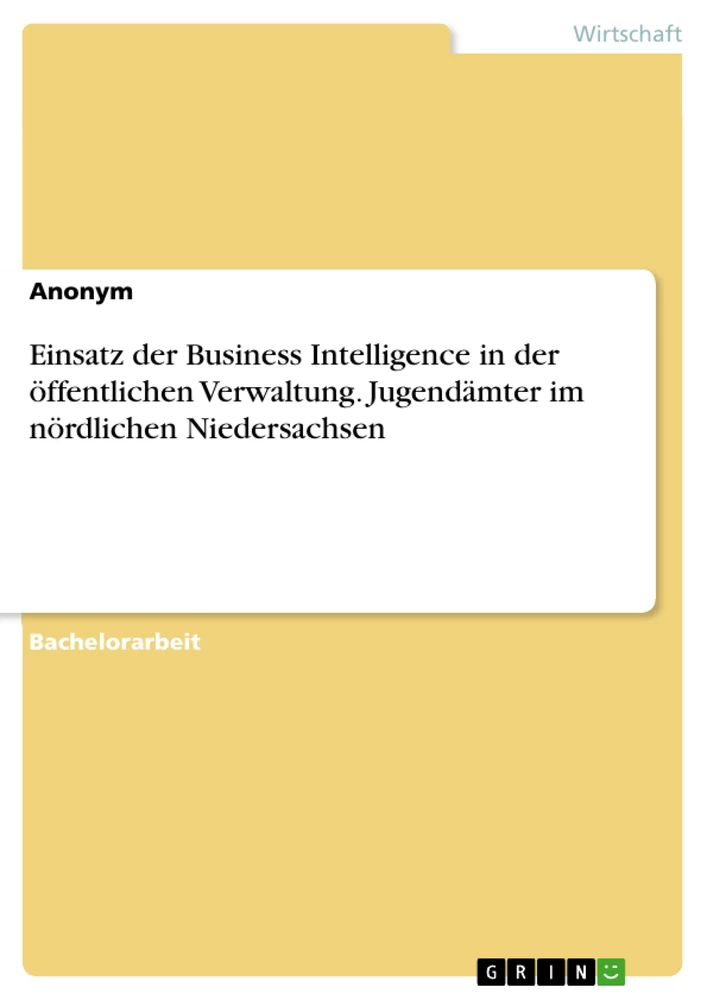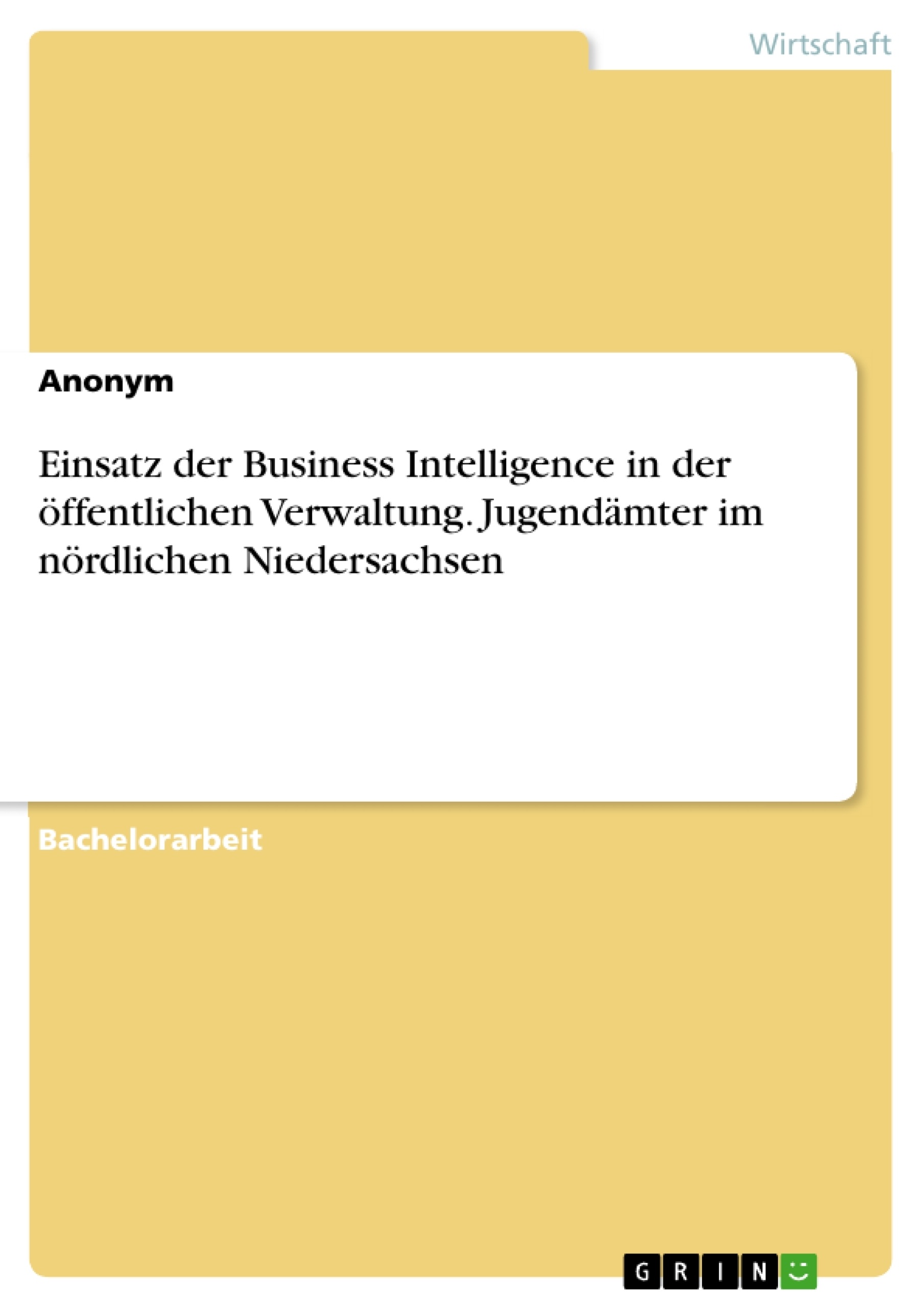In dieser Bachelorarbeit wird der stark wachsende Markt der Business Intelligence Anwendungen untersucht. Dabei geht es hier nicht um die Privatwirtschaft, sondern um die öffentliche Verwaltung. Da technische Neuerungen hier generell etwas später umgesetzt werden, soll diese Arbeit verdeutlichen, welches Potenzial in Business Intelligence Anwendungen steckt und welche Vorteile sich dadurch für eine öffentliche Verwaltung ergeben können. Darüber hinaus wird eine Umfrage unter verschiedenen Jugendämtern im nördlichen Niedersachsen durchgeführt um zu überprüfen, ob hier bereits Business Intelligence Anwendungen genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Business Intelligence
- 2.1 Was ist Business Intelligence (BI)?
- 2.2 Entwicklung der Business Intelligence
- 2.3 Aufbau einer klassischen BI-Struktur
- 2.3.1 Datenbereitstellung
- 2.3.2 Datenverarbeitung
- 2.3.3 Informationsverteilung
- 2.3.3.1 Reporting und Dashboards
- 2.3.3.2 Ad-hoc Abfragen und OLAP
- 2.4 Open-Source-BI-Lösungen
- 3 Aufbau und Organisation der öffentlichen Verwaltung
- 3.1 Struktureller Aufbau des öffentlichen Sektors
- 3.2 Die Kommunalverwaltung
- 3.2.1 Funktionen und Aufgaben
- 3.2.2 Struktureller Aufbau
- 3.2.3 Wirtschaftlicher Aufbau
- 3.3 Management in Kommunalverwaltungen
- 3.4 Das Jugendamt
- 3.4.1 Entwicklung des Jugendamtes
- 3.4.2 Gesellschaftliche Bedeutung
- 3.4.3 Steigende Komplexität in der Jugendhilfe
- 4 Theoretisches Konzept zum Einsatz von Business Intelligence in Jugendämtern
- 4.1 Schaffung der Grundlagen
- 4.2 Open Source als (Einstiegs-)Alternative
- 4.3 Erweiterung der BI-Lösung
- 4.4 Personalisierung der BI-Oberflächen
- 4.5 Einsatzmöglichkeiten der BI in einer öffentlichen Verwaltung
- 4.6 Wartung und Pflege
- 5 Empirische Untersuchung
- 5.1 Informationen zur Umfrage
- 5.1.1 Ziel der Umfrage
- 5.1.2 Teilnehmer der Umfrage
- 5.1.3 Der Fragebogen
- 5.2 Ablauf der Umfrage
- 5.2.1 Erster Kontakt zu den Jugendämtern
- 5.2.2 Erste Eindrücke nach der Kontaktaufnahme
- 5.3 Auswertung der Umfrage
- 5.3.1 Resonanz der Befragten
- 5.3.2 Ergebnisse der Umfrage
- 5.3.3 Bedeutung der Business Intelligence für die Jugendämter
- 6 Vergleich des theoretischen Konzepts mit den Erkenntnissen aus der empirischen Untersuchung
- 7 Handlungsempfehlungen und Ausblick auf die Entwicklung der Business Intelligence in Jugendämtern
- 7.1 Handlungsempfehlungen zum Einsatz von Business Intelligence in Jugendämtern
- 7.2 Zukünftige Entwicklung der Business Intelligence in Jugendämtern
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis untersucht den Einsatz von Business Intelligence (BI) in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in Jugendämtern im nördlichen Niedersachsen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Potenziale von BI-Lösungen für die Optimierung von Arbeitsabläufen, die Verbesserung der Entscheidungsfindung und die Steigerung der Effizienz in Jugendämtern aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von Business Intelligence in der öffentlichen Verwaltung
- Die Herausforderungen des Einsatzes von BI-Lösungen in Jugendämtern
- Die Möglichkeiten zur Nutzung von Open Source BI-Lösungen in der Jugendhilfe
- Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Einsatz von BI in Jugendämtern
- Handlungsempfehlungen für die Implementierung von BI-Lösungen in Jugendämtern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelor-Thesis ein und erläutert die Relevanz des Themas. Kapitel 2 definiert den Begriff Business Intelligence und beleuchtet die Entwicklung und den Aufbau von BI-Systemen. Kapitel 3 beschreibt die Struktur und Organisation der öffentlichen Verwaltung sowie die Aufgaben und Herausforderungen von Jugendämtern. Kapitel 4 entwickelt ein theoretisches Konzept für den Einsatz von Business Intelligence in Jugendämtern. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die Einblicke in die Praxis des BI-Einsatzes in Jugendämtern bietet. Kapitel 6 vergleicht das theoretische Konzept mit den empirischen Erkenntnissen. Kapitel 7 formuliert Handlungsempfehlungen für die Implementierung von BI-Lösungen in Jugendämtern und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von BI in diesem Bereich. Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Business Intelligence, öffentliche Verwaltung, Jugendämter, Open Source, empirische Untersuchung, Handlungsempfehlungen, Datenanalyse, Entscheidungsfindung, Effizienzsteigerung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Einsatz der Business Intelligence in der öffentlichen Verwaltung. Jugendämter im nördlichen Niedersachsen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301020