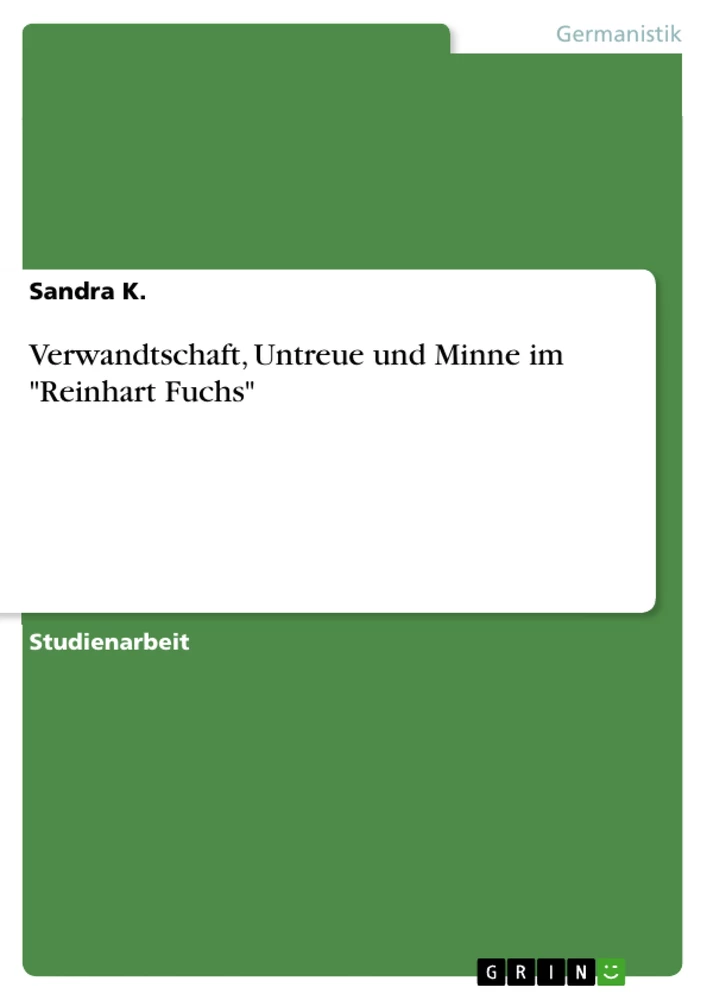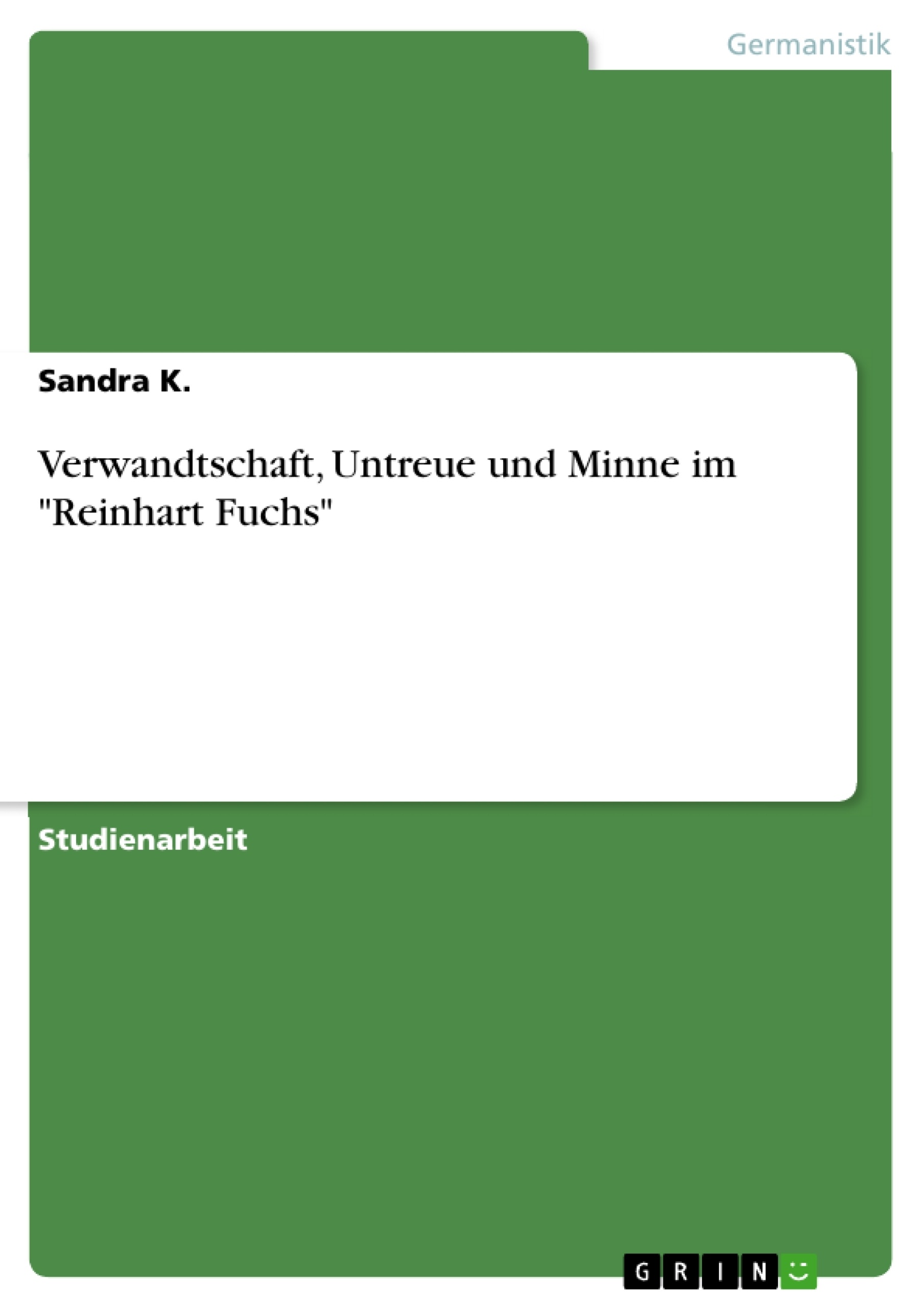Der Fuchs ist eine häufig eingesetzte Figur in der Literatur. Alle Darstellungen des Tieres laufen in der Zurschaustellung seiner Listigkeit zusammen. Dies scheint ein genreübergreifendes Merkmal zu sein. Doch wie ist dies mit der Minne und der "triuwe", die in Werken des Mittelalters hoch thematisiert werden, zu vereinbaren?
Auch die dominierenden Verwandtschaftsdarstellungen im Reinhart Fuchs sind eng mit dem Treuebegriff verbunden und stehen in direkter Opposition mit der Charaktereigenschaft des Fuchses.
Im speziellen die Geschichten mit Wolf und Fuchs sind in vielen Versionen und über Generationen tradiert, dass es schwer festzumachen ist, wo der Ursprung sowohl örtlich als auch thematisch anzusetzen ist.
So liegt beispielsweise zwischen dem Roman de Renart und dem Reinhart Fuchs ein wesentlicher Unterschied, der sich vor allem im Details und in der Tiefe des Tierepos zeigt. Was im Reinhart Fuchs im Nebensatz thematisiert wird, kann im Roman de Renart mehrere Seiten in Anspruch nehmen. Auch im Gottscheds Reineke der Fuchs und Reineke Fuchs von Goethe liegen die Schwerpunkte ganz anders verteilt. Es existieren viele Versionen, doch gibt es nur ein Ursprung?
Das episodenhafte Erzählen und das Beschränken auf das Wesentliche von Heinrichs Dichtkunst machen dieses Werk besonders. Der Fokus der Arbeit soll auf dessen Reinhart Fuchs liegen, jedoch lassen sich verwandte Werke nicht immer ausblenden, da sie kontextuell verwoben erscheinen. Wie finden Verwandtschaft, Treue und Minne so Platz in Heinrichs Werk? Wie wird die Verflechtung der drei Themen vom Autor umgesetzt?
Zunächst soll die Arbeit eine Unterscheidung der vorzufindenden Verwandtschaftsgrade und deren Bedeutung für das Leben zu der Zeit liefern. Darauf sollen die Darstellung der Verwandtschaft, Treue und Minne im Werk hermeneutisch hervorgehoben werden und so das Fazit einleiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familie als Verband
- Blutsverwandtschaft
- Geistliche Verwandtschaft
- Rechte und Pflichten innerhalb der Sippengemeinschaft
- Familie als Lebenswirklichkeit
- Treuebruch in den Episoden
- Anfangsepisoden
- Die Allianz zwischen Fuchs und Wolf
- Der Hoftag
- Minne
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Verwandtschaft, Treue und Minne im mittelalterlichen Tierdichtung "Reinhart Fuchs" von Heinrich dem Glîchezâre. Ziel ist es, die Bedeutung der Verwandtschaftsverhältnisse für das Leben im Mittelalter zu beleuchten und zu untersuchen, wie diese Themen im Werk des Autors umgesetzt werden.
- Die Rolle der Blutsverwandtschaft und geistlichen Verwandtschaft im Mittelalter
- Die Bedeutung des Treuebegriffs in den Tierdichtungen
- Die Darstellung des Treuebruchs in den Episoden des "Reinhart Fuchs"
- Die Verbindung von Verwandtschaft, Treue und Minne im Werk
- Die literarische Umsetzung dieser Themen durch Heinrich den Glîchezâre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Fokus der Arbeit dar, die auf den "Reinhart Fuchs" von Heinrich den Glîchezâre liegt. Das Kapitel "Familie als Verband" beleuchtet die Bedeutung der Verwandtschaft im Mittelalter, sowohl in Bezug auf Blutsverwandtschaft als auch geistliche Verwandtschaft. Es werden die Rechte und Pflichten innerhalb der Sippengemeinschaft sowie die Familie als Lebenswirklichkeit thematisiert.
Das Kapitel "Treuebruch in den Episoden" untersucht verschiedene Episoden aus dem "Reinhart Fuchs", in denen der Fuchs die Verwandtschaftsbeziehung zur Manipulation und zum persönlichen Vorteil nutzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Verwandtschaft, Treue, Minne, Tierdichtung, Mittelalter, Heinrich der Glîchezâre, "Reinhart Fuchs", Blutsverwandtschaft, geistliche Verwandtschaft, Sippengemeinschaft, Treuebruch, Episoden.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Tierepos „Reinhart Fuchs“?
Das Werk von Heinrich dem Glîchezâre thematisiert die List des Fuchses und wie er Konzepte wie Verwandtschaft und Treue zur Manipulation nutzt.
Was bedeutete „Sippengemeinschaft“ im Mittelalter?
Die Familie war ein Schutzverband mit festen Rechten und Pflichten, wobei Blutsverwandtschaft und geistliche Verwandtschaft das soziale Gefüge bestimmten.
Wie wird Treuebruch im Werk dargestellt?
Besonders in der Allianz zwischen Fuchs und Wolf zeigt sich, wie Reinhart Fuchs durch List die „triuwe“ (Treue) bricht, um seinen eigenen Vorteil zu erlangen.
Welche Rolle spielt die Minne im Reinhart Fuchs?
Die Arbeit untersucht, wie das höfische Ideal der Minne in der Tierdichtung parodiert oder als Mittel zur Täuschung eingesetzt wird.
Gibt es Unterschiede zum französischen „Roman de Renart“?
Ja, Heinrichs Werk ist oft knapper und konzentrierter auf das Wesentliche, während die französischen Vorlagen episodenhafter und detailreicher sind.
- Quote paper
- Sandra K. (Author), 2013, Verwandtschaft, Untreue und Minne im "Reinhart Fuchs", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301038