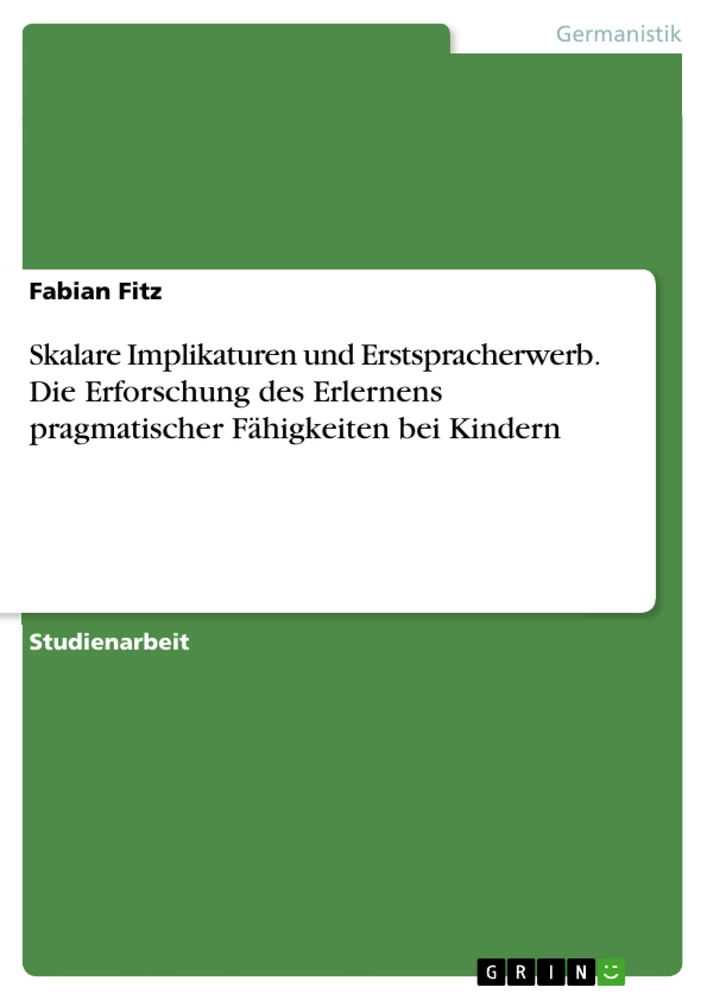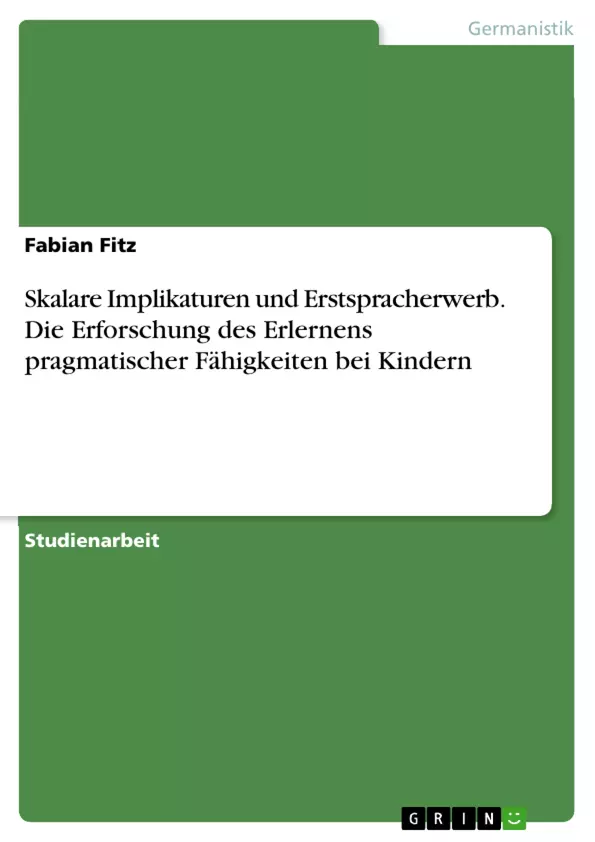Die Theorien von Noam Chomsky, besonders die generative Transformationsgrammatik, hatten großen Einfluss auf die Spracherwerbsforschung und so stand vor allem in den sechziger und angehenden siebziger Jahren die Entwicklung grammatikalischer Strukturen im Mittelpunkt der Forschung. Hauptaugenmerk lag dabei auf formalen Aspekten der Sprache.
Da Chomsky davon ausgeht, dass Kinder über einen bestimmten Regelapparat verfügen, kommt er zu dem Schluss, dass dieser formale Regelapparat die „Tiefenstrukturen der Sätze generiert und diese mit Transforamtionsregeln in die konkreten syntaktischen Oberflächenstrukturen überführt.“ Aufgrund des großen Einflusses dieser Theorie ging es in der Spracherwerbsforschung lange Zeit vor allem darum, wie das Kind sein konkretes grammatisches System aufbaut und es erfolgte nahezu eine Gleichsetzung von Sprache und Grammatik.
Eine weitere viel beachtete Konzeption war zu gleichen Zeit der Behaviorismus um Burrhus Frederic Skinner, für den das Erlernen von Sprache vordergründig aus Imitation besteht.
In den letzten Jahren hat die Entwicklung sprachwissenschaftlicher Theorien eine andere Wendung genommen, auch innerhalb bestimmter Forschungsparadigmen.
Formale Aspekte der Sprache haben an Bedeutung verloren und es das Interesse an der Formulierung von Regeln weicht mehr und mehr dem Interesse nach sprachtheoretischen Prinzipien, die mittlerweile als basal für jegliche Regel gelten. Die sprachwissenschaftliche Forschung sieht Sprache heute nicht mehr als reine Grammatik, sondern im Gegenteil sind der kontextuelle Rahmen und die Anwendung von Sprache von großer Bedeutung. Das heißt jedoch nicht, dass Theorien wie die generative Grammatik vollständig verdrängt wurden, sondern dass auch innerhalb exponierter Forschungsparadigmen eine Verlagerung der Interessen stattfindet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Pragmatik und Spracherwerb
- 2.1 Pragmatik und Implikaturen
- 3. Implikaturen
- 3.1 Konversationsmaximen
- 3.2 Skalare Implikaturen
- 4. Die Entwicklung skalarer Implikaturen
- 4.1 ,,When children are more logical than adults”
- 4.2 Experiment 1
- 4.3 Experiment 2
- 4.4 Experiment 3
- 5. Schlüsse aus den Experimenten
- 5.1 Bezug zur Neo-Gricean Pragmatik
- 6. Kritik an Noveck
- 6.1 Die Möglichkeit anderer Implikaturen bei Kindern
- 6.2 Child-implicatures
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Pragmatik im Spracherwerb und analysiert aktuelle Forschungsarbeiten zu diesem Thema. Sie legt den Fokus auf die Experimente von Ira A. Noveck zu skalaren Implikaturen und deren Entwicklung bei Kindern. Die Arbeit untersucht diese Experimente kritisch und berücksichtigt auch gegensätzliche Hypothesen. Außerdem werden grundlegende Begriffe und Konzepte der Pragmatik geklärt.
- Die Bedeutung der Pragmatik für den Spracherwerb
- Skalare Implikaturen und ihre Entwicklung bei Kindern
- Die Experimente von Ira A. Noveck
- Kritische Analyse der Experimente
- Gegensätzliche Hypothesen und alternative Interpretationen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung stellt den aktuellen Forschungsstand im Bereich des Spracherwerbs dar und hebt die wachsende Bedeutung der Pragmatik in diesem Kontext hervor. Sie erläutert den Einfluss der Theorie der generativen Transformationsgrammatik von Noam Chomsky und den Wandel des Forschungsfokus von der Grammatik zur Pragmatik. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Pragmatik für den Spracherwerb zu beleuchten und die Experimente von Noveck zu skalaren Implikaturen zu analysieren.
Kapitel 2: Pragmatik und Spracherwerb Dieses Kapitel behandelt die Beziehung zwischen Pragmatik und Spracherwerb und geht auf die semiotische Teildisziplin der Pragmatik im Sinne von Peirce ein. Es wird betont, dass die Pragmatik eine eigene Sprachebene ist und dass die Betrachtung des „Benutzers“ und seines Alters entscheidend für die Analyse sprachlicher Phänomene ist.
Kapitel 2.1: Pragmatik und Implikaturen Dieser Abschnitt fokussiert auf den Beitrag von H.P. Grice zur Konversationslogik und die von ihm entwickelten Konversationsmaximen. Diese Prinzipien dienen dazu, dem Sprachverhalten von Menschen Sinnhaftigkeit zuzuschreiben, auch wenn diese auf wörtlicher Ebene nicht gegeben ist.
Kapitel 3: Implikaturen Kapitel 3 behandelt das Konzept der Implikaturen im Allgemeinen und erläutert die von Grice entwickelten Konversationsmaximen. Es werden die unterschiedlichen Arten von Implikaturen, insbesondere die skalaren Implikaturen, vorgestellt.
Kapitel 4: Die Entwicklung skalarer Implikaturen Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung skalarer Implikaturen bei Kindern. Es werden verschiedene Experimente von Noveck und anderen Forschern vorgestellt, die untersuchen, inwieweit Kinder die Fähigkeit zur Interpretation skalarer Implikaturen entwickeln.
Kapitel 5: Schlüsse aus den Experimenten Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der Experimente zu skalaren Implikaturen zusammen und setzt diese in Bezug zur Neo-Gricean Pragmatik.
Kapitel 6: Kritik an Noveck In Kapitel 6 werden verschiedene Kritikpunkte an den Experimenten von Noveck diskutiert. Es werden alternative Interpretationen und Hypothesen zur Interpretation kindlicher Äußerungen vorgestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Pragmatik, Spracherwerb, Implikaturen, Skalare Implikaturen, Konversationsmaximen, Experimentelle Pragmatik, Noveck, Kinder, Entwicklung, Neo-Gricean Pragmatik, Sprachverhalten, Bedeutung, Semiotik, Zeichentheorie.
- Citation du texte
- Fabian Fitz (Auteur), 2013, Skalare Implikaturen und Erstspracherwerb. Die Erforschung des Erlernens pragmatischer Fähigkeiten bei Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301158