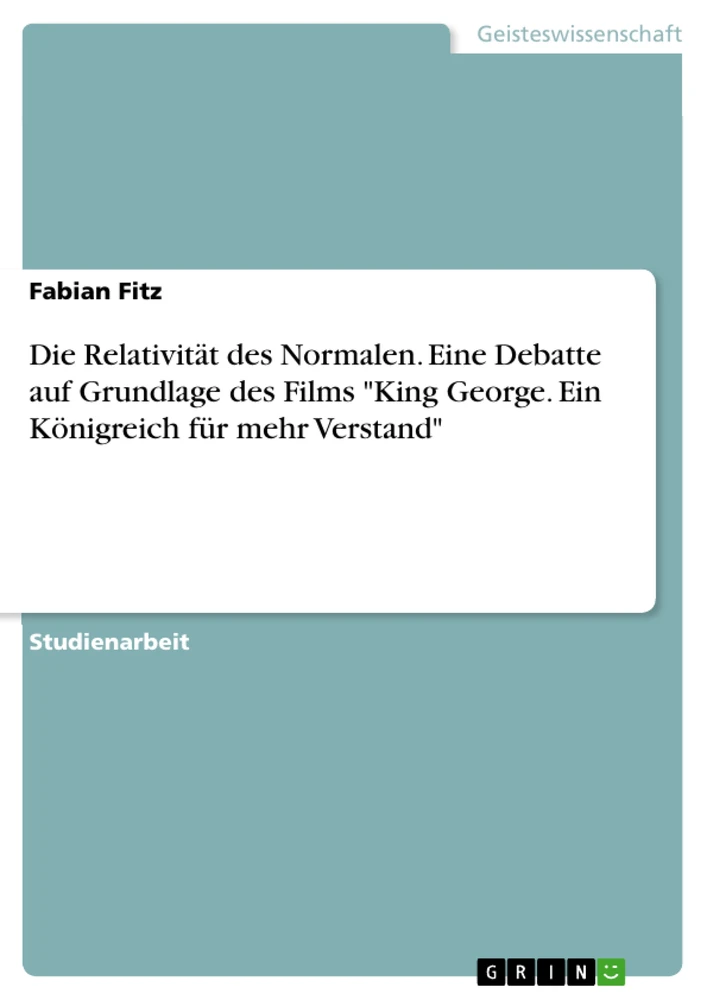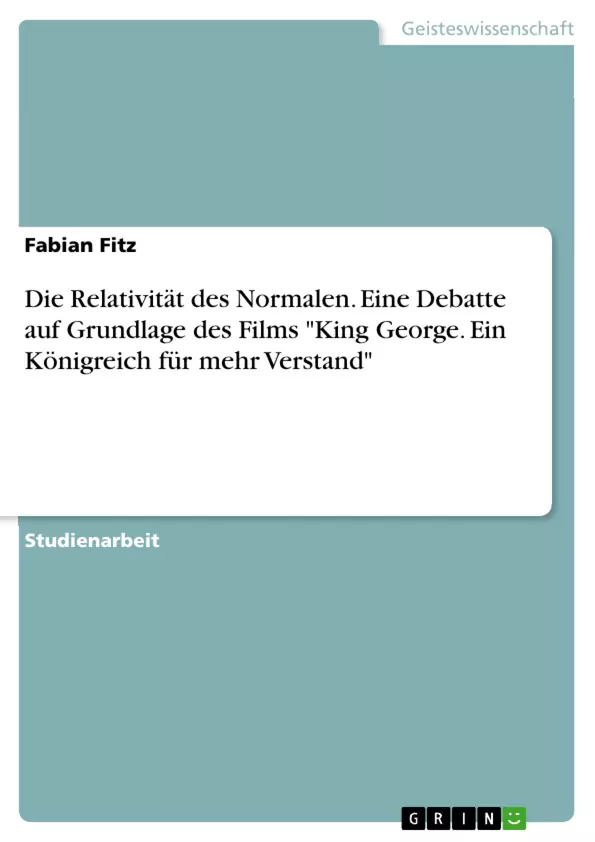Diese Arbeit soll auf Grundlage des Films „King George – Ein Königreich für mehr Verstand“ (Englischer Originaltitel: The madness of King George) Fragen zur Philosophie und Psychologie und deren Grenzgebiete aufwerfen, Probleme erkennen und Möglichkeiten entwickeln. Dabei gehe ich von der These aus, dass der Film sein Hauptaugenmerk auf zwei Dinge legt: den Begriff der Normalität und die Behandlung einer psychischen Krankheit mit Fokus auf dem Verhältnis von Therapeut und Klient. Ausgehend davon soll eine kritische Sichtweise auf die Relativität des Normalen entwickelt und Probleme wie gesellschaftlicher Anpassungsdruck und Etikettierung beleuchtet werden.
Meine These ist es, dass die Philosophie und die Psychologie gerade in Fragen der Psychiatrie enger zusammen arbeiten und sich nicht gegenseitig als Spekulationswissenschaft beziehungsweise als begriffslose Empirie abtun sollten. Aufgrund der Schwierigkeiten, die der Begriff des „Normalen“ und der „Abweichung“ oder auch die Begriffe „gesund“ und „krank“ aufwerfen, ist es für die Psychologie unumgänglich sich des kritischen Potentials der Philosophie zu bedienen und wenn die Philosophie den Anspruch haben will, auch für die psychologische und psychotherapeutische Praxis relevant zu sein, darf auch sie die empirischen Erkenntnisse der Psychologie nicht außen vor lassen.
Für das Gelingen des Unterfangens soll in dieser Arbeit zu Beginn die Geschichte der Psychiatrie dargestellt werden. Diese ist insofern relevant, als dass dadurch deutlich wird, inwieweit die Betrachtung psychischer Krankheiten und psychischer Normalität sich über die Jahre verändert hat. Damit einher gehen gesellschaftliche Moralvorgaben, sich verändernde Menschenbilder, unterschiedliche Auffassungen des Zusammenhangs von Körper und Geist und ganz allgemein Mechanismen des Umbruchs einer Gesellschaft. Dabei sollen schon einige Fragen entwickelt werden, welche auch im Film angesprochen werden. Die Darstellung der Entwicklung des Krankheitsverlaufs von King George und die Filmadaption des historischen Stoffes soll zeigen, welche Möglichkeiten das Medium Film bietet, philosophische und psychologische Schwierigkeiten zumindest anzusprechen. Dabei soll sowohl der Krankheitsverlauf, als auch die filmische Umsetzung nicht nur deskriptiv gezeigt werden, sondern immer schon normative Elemente mit einfließen , um diese im weiteren Verlauf der Arbeit wieder aufzunehmen und genauer zu betrachten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte der Psychiatrie
- 2.1 Die Relativität des Normalen
- 2.2 Wahnsinn im gesellschaftlichen Umbruch
- 2.3 Wahnsinn zwischen Anerkennung und Ausschluss
- 2.4 Moralische Kontrolle
- 2.5 Kritik der Psychologie
- 3. Die Entwicklung der Krankheit bei King George
- 3.1 Wahnsinn als psychische Störung
- 3.2 Behandlungsmethoden und Menschenbild
- 4. Die Filmadaption des historischen Stoffes
- 4.1 King George - gesund oder krank?
- 4.2 Der Gesundheitsbegriff in Abhängigkeit des sozialen Status
- 5. Philosophie und Psychologie
- 5.1 Bezugspunkt psychischer Krankheiten
- 5.2 Person und Persönlichkeit
- 5.3 Anthropologie
- 5.4 Das Verhältnis von Therapeut und Klient
- 5.5 Normalität und Abweichung
- 5.6 Normalitätsdefinitionen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht anhand des Films „King George – Ein Königreich für mehr Verstand“ die philosophischen und psychologischen Aspekte von Normalität und der Behandlung psychischer Krankheiten. Sie hinterfragt die Relativität des Normalen, beleuchtet den gesellschaftlichen Anpassungsdruck und die Problematik der Etikettierung. Ein zentrales Anliegen ist die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Psychologie im Bereich der Psychiatrie.
- Die Relativität des Normalitätsbegriffs und dessen gesellschaftliche Konstruktion
- Der Einfluss gesellschaftlicher Moralvorstellungen und Machtstrukturen auf die Psychiatrie
- Die Entwicklung der Psychiatrie und des Umgangs mit psychischer Krankheit im Laufe der Geschichte
- Die kritische Betrachtung von Behandlungsmethoden und dem Menschenbild in der Psychiatrie
- Das Verhältnis von Therapeut und Klient
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung legt die Grundlage der Arbeit dar, indem sie die Fragestellungen definiert und die These formuliert, dass der Film „King George“ die Begriffe Normalität und die Behandlung psychischer Krankheiten, insbesondere das Therapeut-Klient-Verhältnis, in den Mittelpunkt stellt. Es wird die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Relativität des Normalen und den Problemen von Anpassungsdruck und Etikettierung betont. Die Autorin argumentiert für eine engere Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Psychologie im Bereich der Psychiatrie, wobei die Philosophie das kritische Potential und die Psychologie die empirischen Erkenntnisse beisteuern sollte. Die Arbeit verspricht eine Darstellung der Geschichte der Psychiatrie, eine Analyse der Krankheitsentwicklung von King George und der Filmadaption, sowie eine kritische Betrachtung der Psychologie und Psychiatrie, inklusive der Behandlungsmethoden. Schliesslich sollen daraus resultierende psychologische Schulen und Denkweisen mit ihren Normalitätsdefinitionen betrachtet und auf ihre Ertragreichkeit hin untersucht werden.
2. Geschichte der Psychiatrie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Verständnisses von psychischer Krankheit und Normalität im Laufe der Geschichte. Es wird betont, dass die Betrachtung des menschlichen Geistes und dessen Krankheiten immer von gesellschaftlichen und philosophischen Vorstellungen beeinflusst wird und diese wiederum beeinflusst. Der Fokus liegt auf dem gesellschaftlichen Umgang mit Wahnsinn und wie dieser Umgang die gesellschaftliche Wirklichkeit stabilisiert. Die Kapitelteile beleuchten die Relativität des Normalen, den Wahnsinn im gesellschaftlichen Umbruch, den Wahnsinn zwischen Anerkennung und Ausschluss, moralische Kontrolle und eine Kritik der Psychologie. Es wird deutlich, dass die Definition von Normalität und Abweichung sich im Wandel der Zeit und der Gesellschaft verändert.
Häufig gestellte Fragen zu "King George – Ein Königreich für mehr Verstand": Eine philosophisch-psychologische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Film "King George – Ein Königreich für mehr Verstand" unter philosophischen und psychologischen Gesichtspunkten. Sie untersucht die Relativität des Normalitätsbegriffs, den gesellschaftlichen Anpassungsdruck und die Problematik der Etikettierung psychischer Krankheiten. Ein zentrales Thema ist die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Psychologie in der Psychiatrie.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Psychiatrie, der Entwicklung der Krankheit bei King George III., der Filmadaption, philosophischen und psychologischen Konzepten von Normalität und Abweichung, dem Therapeut-Klient-Verhältnis und verschiedenen Normalitätsdefinitionen. Sie beleuchtet den Einfluss gesellschaftlicher Moralvorstellungen und Machtstrukturen auf die Psychiatrie und die kritische Betrachtung von Behandlungsmethoden und dem Menschenbild.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Geschichte der Psychiatrie (inkl. Relativität des Normalen, Wahnsinn im gesellschaftlichen Umbruch, Wahnsinn zwischen Anerkennung und Ausschluss, Moralische Kontrolle, Kritik der Psychologie), Die Entwicklung der Krankheit bei King George (inkl. Wahnsinn als psychische Störung, Behandlungsmethoden und Menschenbild), Die Filmadaption (inkl. King George – gesund oder krank?, Der Gesundheitsbegriff in Abhängigkeit des sozialen Status), Philosophie und Psychologie (inkl. Bezugspunkt psychischer Krankheiten, Person und Persönlichkeit, Anthropologie, Das Verhältnis von Therapeut und Klient, Normalität und Abweichung, Normalitätsdefinitionen) und Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die philosophischen und psychologischen Aspekte von Normalität und der Behandlung psychischer Krankheiten zu untersuchen. Sie hinterfragt den gesellschaftlichen Umgang mit Wahnsinn und die Relativität des Normalitätsbegriffs. Ein wichtiges Anliegen ist die Argumentation für eine engere Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Psychologie in der Psychiatrie.
Wie wird der Film "King George" in die Analyse einbezogen?
Der Film dient als Fallbeispiel, um die theoretischen Konzepte zu illustrieren. Die Analyse betrachtet, wie der Film den Gesundheitsbegriff, die Behandlung psychischer Krankheiten und das Verhältnis zwischen Therapeut und Klient darstellt und welche Fragen er aufwirft.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Der genaue Inhalt des Fazits ist in der Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben, jedoch wird eine Schlussfolgerung basierend auf der Analyse der Geschichte der Psychiatrie, der Krankheitsentwicklung King Georges, der Filmadaption und der philosophisch-psychologischen Betrachtung erwartet.)
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Normalität, Abweichung, psychische Krankheit, Psychiatrie, Philosophie, Psychologie, gesellschaftlicher Anpassungsdruck, Etikettierung, Therapeut-Klient-Verhältnis, Moral, Machtstrukturen, Behandlungsmethoden, Menschenbild, Relativität des Normalen.
- Arbeit zitieren
- Fabian Fitz (Autor:in), 2013, Die Relativität des Normalen. Eine Debatte auf Grundlage des Films "King George. Ein Königreich für mehr Verstand", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301159