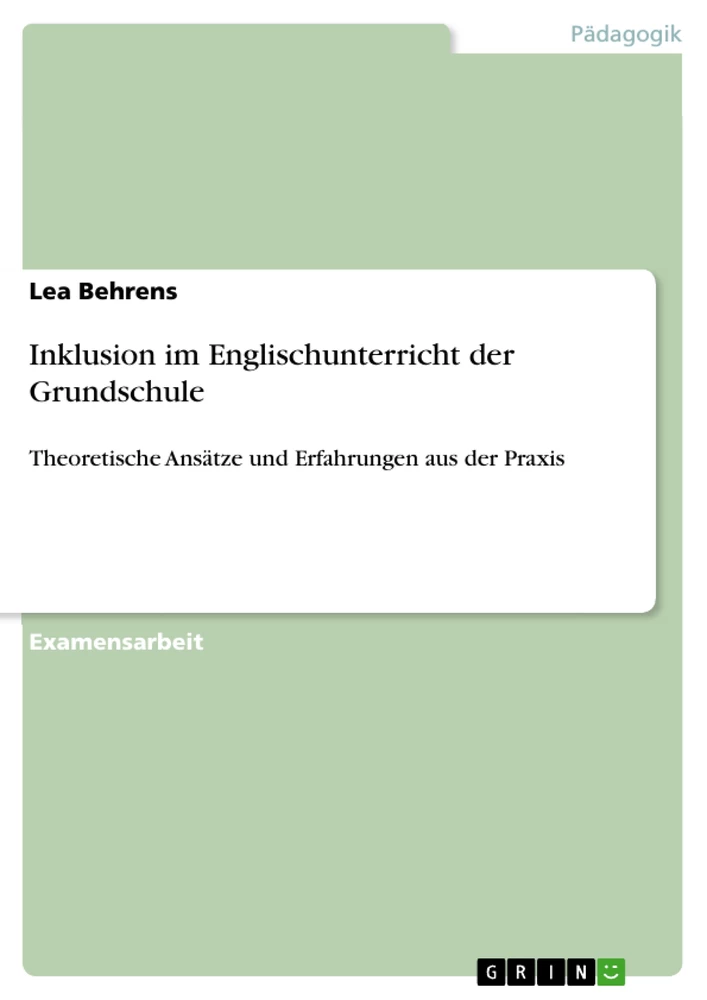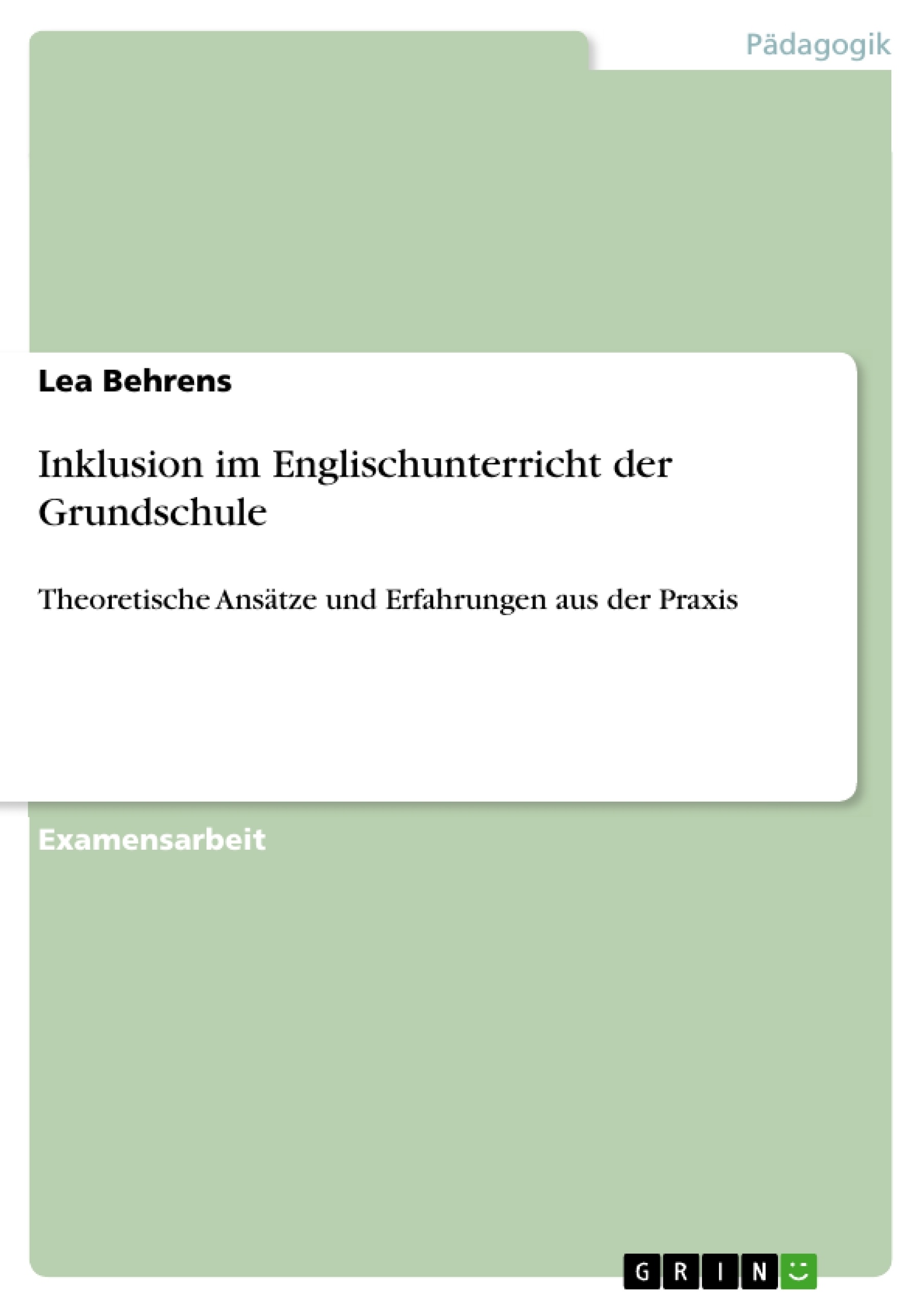In den letzten Wochen löste der sogenannte Fall Henri reges Medieninteresse aus und brachte das Thema der Inklusion ein weiteres Mal in den Fokus der Öffentlichkeit. Hierbei handelt es sich um den elfjährigen Jungen Henri, der mit dem Down-Syndrom zur Welt kam und den Wunsch hat, nach der vierten Klasse das örtliche Gymnasium besuchen zu dürfen. Dieses möchte den Jungen allerdings nicht aufnehmen, da es nicht im Rahmen von Henris Möglichkeiten läge, den Abschluss zu erreichen und eine angemessene Förderung von der Schule nicht geleistet werden könne. Doch geht es Henri beziehungsweise seinen Eltern nicht um diesen Abschluss, sondern vielmehr darum, dass Henri weiterhin zusammen mit seinen Freunden die Schule besuchen kann.
Dieser Fall spiegelt die Aktualität des Themas Inklusion wider. Es gibt kaum Fälle, auf welche hierbei Bezug genommen werden kann, so wird über diesen speziellen Fall letztendlich Andreas Stoch, der Kultusminister des Landes Baden-Württembergs, entscheiden. Zwischenzeitlich haben sich in der Öffentlichkeit zwei unterschiedliche Meinungen zum Thema gebildet. So gibt es die Befürworter der Inklusion, welche die schulische Zukunft Henris am Gymnasium gutheißen und die Gegner, die der Meinung sind, dass Henri an dieser Schule keine Zukunft haben wird und sich selbst sowie der Klassengemeinschaft keinen Gefallen tun würde, wenn er inklusiv in dieser Klasse beschult wird (vgl. Allgöwer 2014).
Henri besucht zurzeit noch eine Grundschule, die durch inklusiven Unterricht ermöglicht, dass Kinder mit Beeinträchtigungen gemeinsam mit den Kindern aus der Nachbarschaft ein und dieselbe Schule besuchen können. Grundschulen praktizieren Inklusion schon seit einiger Zeit, weshalb sich die Frage stellt, wie inklusiver Unterricht in der Praxis gestaltet wird. Die vorliegende Arbeit möchte sich daher mit der Gestaltung inklusiven Unterrichts befassen, wobei der Fokus auf den Englischunterricht gerichtet ist: Wie kann der Englischunterricht der Grundschule inklusiv gestaltet werden, welche Methoden und Unterrichtsformen bieten sich an, und ist der Fremdsprachenunterricht hier überhaupt durchführbar? Diese Fragen sollen im Laufe dieser Arbeit bearbeitet und geklärt werden.
Da die Ausarbeitung dieser Hausarbeit auf einen Zeitraum von drei Monaten begrenzt ist und sich dieses Thema als äußerst komplex und vielschichtig erwiesen hat, wurden einige thematische Eingrenzungen vollzogen [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inklusion
- Herkunft und Entstehung des Inklusionsbegriffs
- Definition des pädagogischen Inklusionsbegriffs
- Problematik zwischen Integration und Inklusion
- Inklusive Pädagogik in der Grundschule
- Institution
- Schulleben
- Klassenleben
- Didaktik
- Lernmaterialien
- Leistungsbewertung
- Professionelle Kooperation
- Der Index für Inklusion als Hilfestellung zur Schulentwicklung
- Englischunterricht in der Grundschule
- Wege des Fremdsprachenunterrichts in die Grundschule
- Richtlinien im Bildungsplan Baden-Württembergs
- Grundsätze für einen kindgerechten Englischunterricht
- Offene Lernangebote im Englischunterricht
- Inklusion im Bezug zum Englischunterricht der Grundschule
- Erfahrungen aus der Praxis
- Theoretische Grundlagen zur qualitativen Sozialforschung
- Methodisches Vorgehen der Erhebung
- Ergebnisse der durchgeführten Befragung
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gestaltung inklusiven Englischunterrichts an Grundschulen in Baden-Württemberg. Ziel ist es, praktische Methoden und Unterrichtsformen für einen inklusiven Fremdsprachenunterricht aufzuzeigen und dessen Durchführbarkeit zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen und empirischen Befunden aus qualitativen Interviews.
- Der historische Werdegang des Inklusionsbegriffs im schulischen Kontext
- Definition und Abgrenzung von Inklusion und Integration in der Pädagogik
- Methoden und Unterrichtsformen für inklusiven Englischunterricht an der Grundschule
- Analyse der Ergebnisse qualitativer Interviews mit Lehrkräften zum Thema Inklusion im Englischunterricht
- Die Rolle des Index für Inklusion in der Schulentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert den aktuellen Fall Henris, eines Kindes mit Down-Syndrom, das ein Gymnasium besuchen möchte, und verdeutlicht damit die Relevanz des Themas Inklusion. Sie führt in die Thematik ein und skizziert die Forschungsfrage: Wie kann inklusiver Englischunterricht an der Grundschule gestaltet werden? Die Arbeit konzentriert sich auf den deutschen Kontext, insbesondere Baden-Württemberg, und beschränkt sich thematisch auf einige ausgewählte Aspekte der Inklusion, um die Komplexität des Themas im Rahmen der Arbeit zu bewältigen.
Inklusion: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Werdegang des Inklusionsbegriffs von der Exklusion über die Segregation und Integration bis hin zur heutigen Inklusion. Es definiert den pädagogischen Inklusionsbegriff und arbeitet die Problematik der Abgrenzung zu Integration heraus. Ein Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung inklusiver Pädagogik in der Grundschule, wobei verschiedene Bereiche wie Institution, Schulleben, Klassenmanagement, Didaktik, Lernmaterialien, Leistungsbewertung und professionelle Kooperation betrachtet werden. Der Index für Inklusion wird als Instrument zur erfolgreichen Umsetzung von Inklusion an Schulen vorgestellt.
Englischunterricht in der Grundschule: Dieses Kapitel beschreibt den Weg des Fremdsprachenunterrichts in die Grundschule und die Richtlinien im Bildungsplan Baden-Württembergs. Es beleuchtet grundlegende Prinzipien eines kindgerechten Englischunterrichts wie Authentizität, multisensorisches Lernen und Unterricht in der Zielsprache. Weiterhin werden verschiedene Methoden des differenzierenden und individualisierenden Unterrichts, insbesondere offene Lernangebote wie Freiarbeit, Planarbeit, Projektarbeit und Task-based Language Learning, vorgestellt. Der Bezug zur Inklusion wird hergestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, Englischunterricht, Grundschule, Baden-Württemberg, inklusive Pädagogik, qualitative Sozialforschung, Differenzierung, Individualisierung, offene Lernangebote, Fremdsprachenlernen, Index für Inklusion, Schulentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Inklusiver Englischunterricht an Grundschulen in Baden-Württemberg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Gestaltung inklusiven Englischunterrichts an Grundschulen in Baden-Württemberg. Das Ziel ist es, praktische Methoden und Unterrichtsformen für einen inklusiven Fremdsprachenunterricht aufzuzeigen und dessen Durchführbarkeit zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen und empirischen Befunden aus qualitativen Interviews.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen Werdegang des Inklusionsbegriffs, die Definition und Abgrenzung von Inklusion und Integration, Methoden und Unterrichtsformen für inklusiven Englischunterricht an der Grundschule, die Analyse qualitativer Interviews mit Lehrkräften zum Thema Inklusion im Englischunterricht und die Rolle des Index für Inklusion in der Schulentwicklung. Konkret werden Aspekte wie Institution, Schulleben, Klassenmanagement, Didaktik, Lernmaterialien, Leistungsbewertung und professionelle Kooperation im Kontext von inklusiver Pädagogik betrachtet. Der Englischunterricht wird unter Berücksichtigung des Bildungsplans Baden-Württembergs und kindgerechter Prinzipien (Authentizität, multisensorisches Lernen, Unterricht in der Zielsprache) beleuchtet. Offene Lernangebote wie Freiarbeit, Planarbeit, Projektarbeit und Task-based Language Learning werden ebenfalls thematisiert.
Welche Methodik wurde verwendet?
Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen und empirischen Befunden aus qualitativen Interviews mit Lehrkräften. Das Kapitel "Erfahrungen aus der Praxis" beschreibt das methodische Vorgehen der Erhebung und die Auswertung der Ergebnisse dieser Befragung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Inklusion (inkl. Unterkapitel zur Umsetzung inklusiver Pädagogik in der Grundschule), Englischunterricht in der Grundschule und Erfahrungen aus der Praxis. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was ist das zentrale Ergebnis oder die Kernaussage der Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie inklusiver Englischunterricht an der Grundschule gestaltet werden kann und beleuchtet dessen Durchführbarkeit anhand praktischer Methoden und Unterrichtsformen. Die Ergebnisse basieren auf einer Kombination aus theoretischen Grundlagen und empirischen Daten aus qualitativen Interviews.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Inklusion, Integration, Englischunterricht, Grundschule, Baden-Württemberg, inklusive Pädagogik, qualitative Sozialforschung, Differenzierung, Individualisierung, offene Lernangebote, Fremdsprachenlernen, Index für Inklusion, Schulentwicklung.
Wie wird der Index für Inklusion in der Arbeit behandelt?
Der Index für Inklusion wird als Instrument zur erfolgreichen Umsetzung von Inklusion an Schulen vorgestellt und seine Rolle in der Schulentwicklung diskutiert.
Wie wird der Bezug zum Bildungsplan Baden-Württemberg hergestellt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Richtlinien des Bildungsplans Baden-Württembergs für den Englischunterricht in der Grundschule und diskutiert deren Implikationen für einen inklusiven Ansatz.
Welche Rolle spielt die qualitative Sozialforschung in dieser Arbeit?
Qualitative Interviews mit Lehrkräften bilden die empirische Grundlage der Arbeit. Die Methodik der qualitativen Sozialforschung wird im entsprechenden Kapitel erläutert.
- Quote paper
- Lea Behrens (Author), 2014, Inklusion im Englischunterricht der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301193