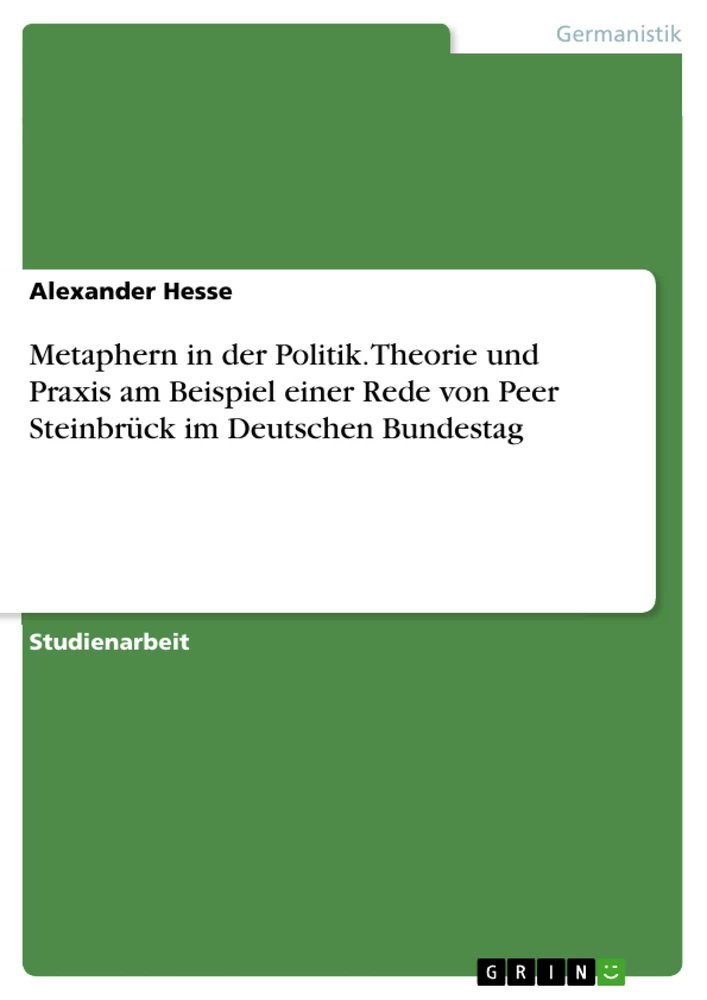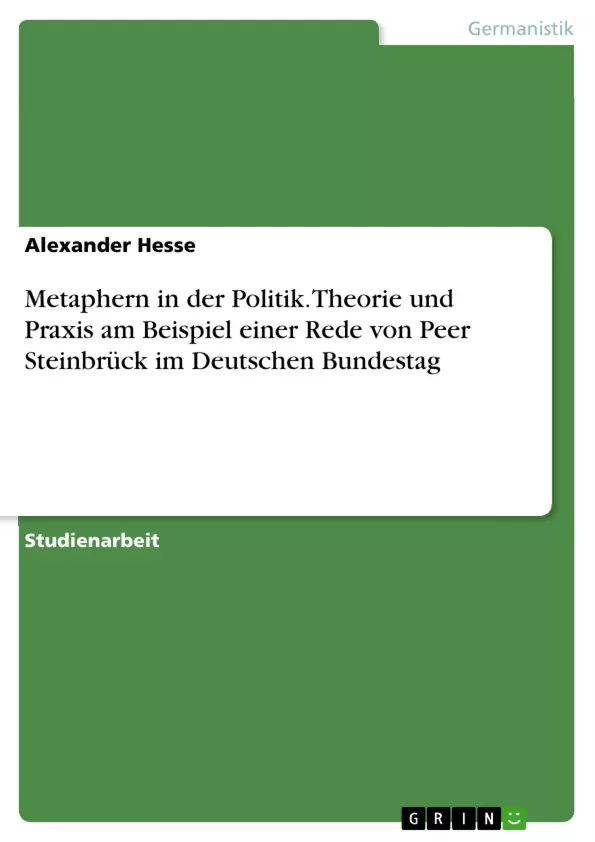Die vorliegende Ausarbeitung hat den Gebrauch, die Funktion und auch den Nutzen von Metaphern innerhalb der politischen Kommunikation als Thematik zugrunde liegen. Zur besseren Übersicht teilt sich die Ausarbeitung in zwei Teile auf, wobei der erste Teil den theoretischen Teil bildet, in welchem ich versuchen möchte darzulegen, was eine Metapher überhaupt darstellt, welche verschiedene Arten von Metaphern es gibt, und wie man mit ihnen innerhalb eines Textes umgehen sollte, um sowohl zu erkennen, welche Intention derjenige hat, der die Metapher gebraucht, als auch zu erkennen, welche Wirkungsweise und Funktion sie beim Rezipienten hat.
Der darauf folgende zweite Teil befasst sich dann darauf aufbauend explizit mit einem praktischen Beispiel, anhand dessen untersucht werden soll, wie viele Metaphern und vor allem auch wie, bzw. zu welchem Zweck die enthaltenen Metaphern genutzt worden sind.
Als Beispiel habe ich eine Rede des ehemaligen Finanzministers und Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück gewählt. Diese Entscheidung habe ich nicht nur basierend auf der Tatsache getroffen, dass Herr Steinbrück 2011 mit dem Cicero-Rednerpreis, welcher seit 1994 verliehen wird, und der laut eigener Darstellung auf „die wichtige Rolle der Redekunst in einer auf Kommunikationsfähigkeit und Dialogbereitschaft angewiesenen Demokratie“ hinweisen soll, ausgezeichnet wurde, sondern und vor allem deswegen, da Herr Steinbrück laut Medienberichten sehr oft dazu neigt, in seinen Reden und Stellungnahmen Sprachbilder zur Verdeutlichung seiner Meinungen, Einstellungen und Pläne zu benutzen.
Genau dieser Aussage wollte ich auch aus eigenem Interesse einmal nachgehen und habe mich ganz bewusst dazu entschieden.
Zuerst hatte ich geplant, die Rede, welche Herr Steinbrück im sogenannten TV Duell mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel, welches landesweit übertragen worden ist, zu untersuchen, da mir die Aussagen von Herrn Steinbrück noch sehr gut in Erinnerung geblieben waren. Leider musste ich dann aber kurze Zeit später innerhalb meiner Recherche für den praktischen Teil dieser Hausarbeit feststellen, dass diese Rede nicht in Schriftform vorliegt, weder auf den Internetseiten der Bundesregierung, da diese Veranstaltung verständlicherweise wohl nicht in erster Linie als Veranstaltung des Bundestages zählt, noch auf der Internetseite der SPD.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffs „Metapher“
- Wo werden Metaphern überall genutzt?
- George Lakoff und Mark Johnson
- Sechs verschiedene Typen von Metaphern
- Konzeptuelle Metaphern
- Orientierungsmetaphern
- Ontologische Metaphern
- Strukturmetaphern
- Metonymie
- Personifikation
- Weitere Metaphern (nicht nach der klassischen Rhetorik)
- Synekdoche, Antonomasie, Vossianische Antonomasie
- Vorstellung der systemischen Metaphernanalyse (nach Schmitt)
- Stufe 1: Identifizierung des Themas und der Forschungsfrage
- Stufe 2: Unsystematische breite Sammlung der Hintergrundmetaphern
- Stufe 3: Systematische Analyse einer Subgruppe
- Stufe 4: Rekonstruktion individueller Metaphorik
- Stufe 5: Methoden Triangulation
- Systematische Metaphernanalyse mit Hilfe der 5 Analysestufen der Rede von Peer Steinbrück vom 24.3.2011 im Deutschen Bundestag
- Stufe 1: Identifizierung des Themas und der Forschungsfrage
- Stufe 2: Unsystematische breite Sammlung der Hintergrundmetaphern
- Stufe 3: Systematische Analyse einer Subgruppe
- Stufe 4: Rekonstruktion individueller Metaphorik
- Stufe 5: Methoden Triangulation
- Vorstellung der Ergebnisse
- Fazit und abschließende Bemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Gebrauch und die Funktion von Metaphern in der politischen Kommunikation. Der Fokus liegt auf der theoretischen Erläuterung des Metapherbegriffes, der verschiedenen Metaphertypen und ihrer Wirkungsweise. Ein praktischer Teil analysiert die Metaphern in einer Rede von Peer Steinbrück, um deren Intention und Funktion zu beleuchten.
- Definition und Klassifizierung von Metaphern
- Anwendung von Metaphern in verschiedenen Kontexten (Politik, Kunst)
- Theorie der Metaphern nach Lakoff und Johnson
- Systematische Metaphernanalyse nach Schmitt
- Analyse der Metaphern in einer politischen Rede
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht den Gebrauch von Metaphern in der politischen Kommunikation, sowohl theoretisch als auch anhand eines praktischen Beispiels – einer Rede von Peer Steinbrück. Der theoretische Teil erläutert den Metapherbegriff, verschiedene Metaphertypen und deren Wirkungsweise. Der praktische Teil analysiert die Metaphern in Steinbrücks Rede, um deren Intention und Funktion zu ergründen. Die Wahl der Rede begründet sich auf Steinbrücks bekannten Gebrauch von Sprachbildern und seiner Auszeichnung mit dem Cicero-Rednerpreis.
2. Definition des Begriffs „Metapher“: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Metapher“, ausgehend von der griechischen Wortbedeutung „anderswo hintragen“ und Aristoteles’ Definition als Übertragung eines Wortes auf etwas anderes aufgrund einer Analogie. Metaphern werden als Tropen klassifiziert, Stilmittel, die einen Ausdruck durch einen anderen ersetzen, ohne den Aussagegehalt zu verlieren. Die Arbeit hebt hervor, dass die Metapher selbst eine Metapher ist, ein Punkt, der im Laufe der Arbeit weiter vertieft wird.
3. Wo werden Metaphern überall genutzt?: Dieses Kapitel argumentiert, dass Metaphern allgegenwärtig sind, besonders in der politischen und wirtschaftlichen Kommunikation sowie in der Kunst, wo sie beispielsweise in der Lyrik von Paul Celan eine zentrale Rolle spielen. Celans spezifische Metaphorik wird als Beispiel für den kreativen und vielschichtigen Gebrauch von Metaphern in der Literatur genannt.
4. George Lakoff und Mark Johnson: Dieses Kapitel stellt die Autoren George Lakoff und Mark Johnson und ihr Werk „Leben in Metaphern“ vor, welches die Grundlage für die folgenden Kapitel über verschiedene Metaphertypen bildet. Es wird kurz Lakoffs Ansicht zusammengefasst, dass Metaphern unbewusst verwendet und sogar im Denken genutzt werden.
Schlüsselwörter
Metapher, politische Kommunikation, Rhetorik, Sprachbilder, Lakoff, Johnson, systemische Metaphernanalyse, Peer Steinbrück, Sprachliche Zeichen, Tropen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Metaphernanalyse in der politischen Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Gebrauch und die Funktion von Metaphern in der politischen Kommunikation. Der Fokus liegt sowohl auf der theoretischen Erläuterung des Metapherbegriffes und verschiedener Metaphertypen als auch auf der praktischen Analyse von Metaphern in einer Rede von Peer Steinbrück.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Einführung in den Begriff der Metapher, verschiedene Metaphertypen (konzeptuelle, Orientierungs-, ontologische, Strukturmetaphern, Metonymien, Personifikationen, Synekdoche, Antonomasie, Vossianische Antonomasie), die Theorie von Lakoff und Johnson sowie die systematische Metaphernanalyse nach Schmitt. Ein zentraler Bestandteil ist die Anwendung der systematischen Metaphernanalyse auf eine Rede von Peer Steinbrück.
Welche Methode wird zur Metaphernanalyse verwendet?
Die Arbeit verwendet die systematische Metaphernanalyse nach Schmitt, die in fünf Stufen unterteilt ist: 1. Identifizierung des Themas und der Forschungsfrage, 2. Unsystematische breite Sammlung der Hintergrundmetaphern, 3. Systematische Analyse einer Subgruppe, 4. Rekonstruktion individueller Metaphorik und 5. Methoden Triangulation. Diese Methode wird Schritt für Schritt an der Rede von Peer Steinbrück angewendet.
Welche Rede von Peer Steinbrück wird analysiert?
Die Arbeit analysiert eine Rede von Peer Steinbrück vom 24. März 2011 im Deutschen Bundestag. Die Wahl dieser Rede begründet sich auf Steinbrücks bekanntem Gebrauch von Sprachbildern und seiner Auszeichnung mit dem Cicero-Rednerpreis.
Welche Autoren werden zitiert?
Ein wichtiger Bezugspunkt ist das Werk „Leben in Metaphern“ von George Lakoff und Mark Johnson, welches die verschiedenen Metaphertypen und deren Wirkungsweise erklärt. Die systematische Metaphernanalyse nach Schmitt bildet die Grundlage der praktischen Analyse.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der systematischen Metaphernanalyse der ausgewählten Rede von Peer Steinbrück, wobei die einzelnen Analyseschritte detailliert beschrieben werden. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über die Intention und Funktion der verwendeten Metaphern geben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Metapher, politische Kommunikation, Rhetorik, Sprachbilder, Lakoff, Johnson, systematische Metaphernanalyse, Peer Steinbrück, Sprachliche Zeichen, Tropen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, die sich mit der Einleitung, der Definition von Metaphern, dem Vorkommen von Metaphern, der Theorie von Lakoff und Johnson, verschiedenen Metaphertypen, der systematischen Metaphernanalyse, der Analyse der Rede von Peer Steinbrück, der Präsentation der Ergebnisse und einem Fazit befassen.
- Quote paper
- Alexander Hesse (Author), 2014, Metaphern in der Politik. Theorie und Praxis am Beispiel einer Rede von Peer Steinbrück im Deutschen Bundestag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301268