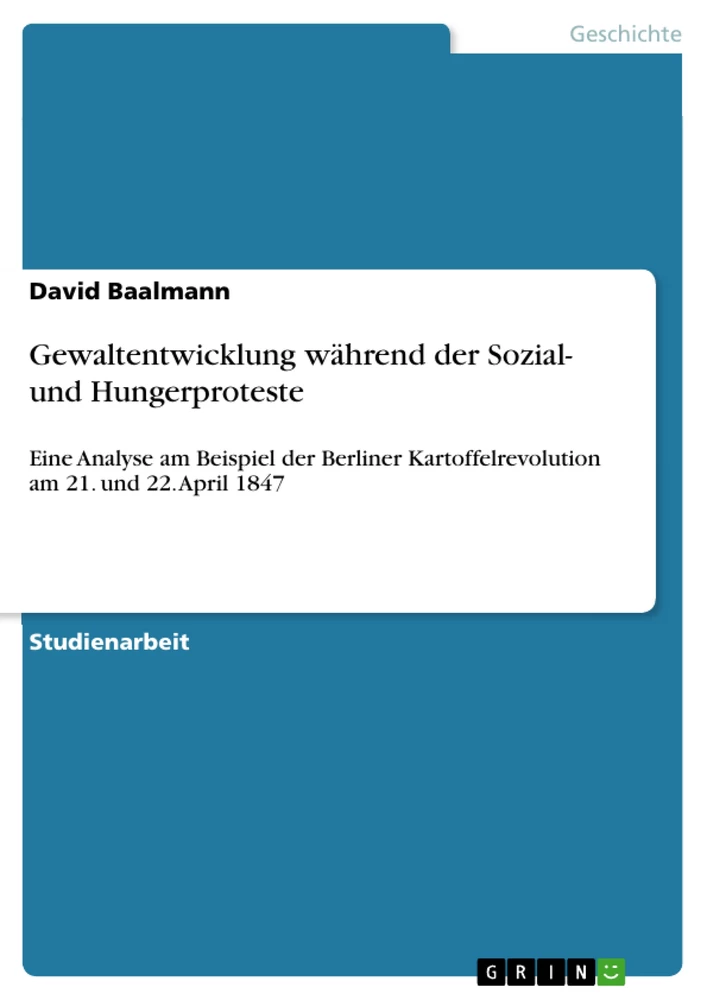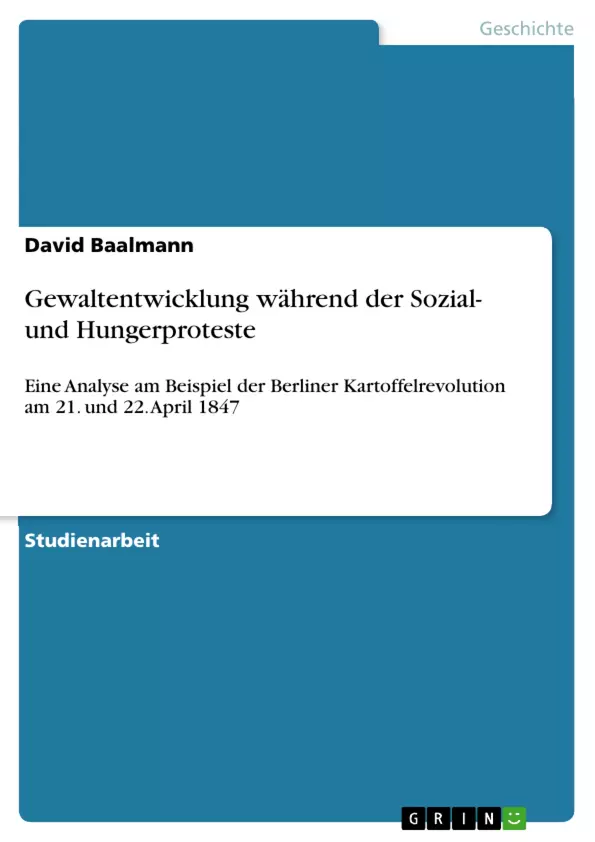In dieser Hausarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema in Bezug auf die Sozial- und Hungerproteste. Aufgrund des Umfangs dieser Thematik beschränke ich mich hierbei auf die Hungerproteste als besondere Form des sozialen Protests. Anhand eines ausgewählten Beispiels werde ich einen durchaus typischer Verlauf darstellen und unter folgender Fragestellung beleuchten: Was für Formen von Gewalt werden ausgeübt? Wie läuft die Gewalt ab? Was provoziert die Gewalt? Wie und wann schlägt die Gewalt um? Gibt es Gegengewalt? War die Gewalt revolutionär?
Die Frage nach der Gewalthaftigkeit bzw. -losigkeit soll in dieser Arbeit vordergründig sein, dennoch ist eine Erklärung und Analyse der Ursachen ebenso notwendig, wie eine Einordnung in die vorherigen sowie weiteren Ereignisse um den Bezug zur Revolution herzustellen.
Die 1840er Jahre wurden von einer großen Anzahl von Hungerprotesten erfüllt, die stets nach einem ähnlichen Muster abliefen. Die meisten Proteste gab es 1847, also unmittelbar vor dem Ausbruch der Revolution. Für dieses Jahr können ca. 200 Aufstände nachgewiesen werden, von denen um die 86% in den Monaten April und Mai stattfanden. Dennoch war es schwer, eine Quelle zu finden, da die meisten Berichte und Zeitungsartikel in den Archiven der betroffenen Städte liegen und ich aufgrund des Zeit- und Raumaufwandes diese Archive nicht aufsuchen konnte.
Problematisch ist auch, dass die Hungerrevolten vergleichsweise bedeutungslos waren im Vergleich zu den Ereignissen in den Jahren 1848/49 und deswegen in den Zeitungen und Zeitzeugenberichten weniger Beachtung finden, als die Unruhen in den Jahren davor. Ich habe mich aus diesem Grund für die sogenannte „Kartoffelrevolution“ am 21. und 22. April 1847 in Berlin entschieden. Adolf Streckfuß schilderte die Ereignisse als Zeitzeuge. Die Berichte über die anschließenden Gerichtsverhandlungen der bei den Tumulten Festgenommenen wurden in der Zeitschrift „Der Publicist“, die ich durch die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg zur Verfügung gestellt bekommen habe, veröffentlicht.
In der von mir genutzten Ausgabe vom 02.06.1847 ist unter anderem die Gerichtsverhandlungen vom 28.05.1847 mit einigen Akteuren der Unruhen in Berlin veröffentlicht worden. Dabei wird diese als die wichtigste bezeichnet, denn sie behandelte den Vorfall vor dem Laden des Bäckermeisters Blumberg, der als Signal für die Eskalation der weiteren Tumulte gesehen wird.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Hungeraufstand in Berlin
- Das Vorspiel
- Die Eskalation
- Das Nachspiel
- III. Die Ereignisse von Schwiebus im Vergleich
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Gewaltentwicklung während der Sozial- und Hungerproteste im 19. Jahrhundert, fokussiert auf die „Kartoffelrevolution“ in Berlin 1847. Die Arbeit analysiert die Formen der ausgeübten Gewalt, ihren Ablauf, die Auslöser, Eskalationsdynamiken, Gegengewalt und die Frage nach dem revolutionären Charakter der Gewalt. Die Ursachen der Proteste werden ebenso beleuchtet wie deren Einordnung in den Kontext der Revolution von 1848/49.
- Gewaltformen während Hungerprotesten
- Auslöser und Eskalation von Gewalt
- Die Rolle der „moralischen Ökonomie“
- Vergleich mit ähnlichen Ereignissen (z.B. Schwiebus)
- Einordnung in den Kontext der Revolution von 1848/49
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gewaltentwicklung während der Hungerproteste der 1840er Jahre ein. Sie benennt die Forschungsfrage nach den Formen, dem Ablauf und den Auslösern von Gewalt, sowie deren Eskalation, Gegengewalt und revolutionärem Charakter. Die Arbeit konzentriert sich auf die „Kartoffelrevolution“ in Berlin 1847 als Fallbeispiel und erwähnt die Quellenlage, die sich hauptsächlich auf Zeitzeugenberichte von Adolf Streckfuß und Gerichtsakten stützt, ergänzt durch das Werk von Dora Meyer und das Tagebuch von Karl August Varnhagen von Ense. Die Einordnung der Berliner Ereignisse in den Kontext anderer Hungerproteste und der Revolution von 1848/49 wird als Ziel genannt.
II. Der Hungeraufstand in Berlin: Dieses Kapitel analysiert detailliert die „Kartoffelrevolution“ in Berlin. Es unterteilt sich in die Phasen des Vorspiels, der Eskalation und des Nachspiels. Die einzelnen Abschnitte untersuchen die Ursachen, den Verlauf und die Folgen der Proteste, beleuchten die unterschiedlichen Formen der Gewalt und deren Intensität. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ereignisse um den Bäckermeister Blumberg, die als Wendepunkt der Eskalation gelten. Die Kapitel beleuchtet die Rolle der beteiligten Akteure, die Reaktionen der Obrigkeit und die darauffolgenden Gerichtsverhandlungen.
III. Die Ereignisse von Schwiebus im Vergleich: Dieses Kapitel setzt die Berliner „Kartoffelrevolution“ in Relation zu einem weiteren Hungeraufstand in Schwiebus. Durch den Vergleich wird die Variabilität der Gewaltentwicklung in ähnlichen Protesten verdeutlicht. Der Schwerpunkt liegt auf den Unterschieden im Umgang mit dem Konflikt und den jeweiligen Folgen. Der Vergleich mit Schwiebus, wo der Konflikt ohne direkte Auseinandersetzung mit dem Militär gelöst wurde, dient dazu, die Vielschichtigkeit von Hungeraufständen dieser Zeit hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Hungerproteste, Kartoffelrevolution, Berlin 1847, Gewalt, Sozialer Protest, Moralische Ökonomie, Revolution 1848/49, Gewalteskalation, Hunger, Nahrungsmittelknappheit, Preiserhöhungen, Obrigkeit, Gerichtsverhandlungen, Vergleich, Schwiebus.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Gewaltentwicklung während der Hungerproteste im 19. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Gewaltentwicklung während der Sozial- und Hungerproteste im 19. Jahrhundert, insbesondere die „Kartoffelrevolution“ in Berlin 1847. Sie analysiert die Formen der Gewalt, ihren Ablauf, die Auslöser, Eskalationsdynamiken, Gegengewalt und den revolutionären Charakter der Ereignisse. Die Arbeit beleuchtet zudem die Ursachen der Proteste und ordnet sie in den Kontext der Revolution von 1848/49 ein.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Themen: Gewaltformen während Hungerprotesten, Auslöser und Eskalation von Gewalt, die Rolle der „moralischen Ökonomie“, Vergleich mit ähnlichen Ereignissen (z.B. Schwiebus) und die Einordnung in den Kontext der Revolution von 1848/49.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Quellenlage basiert hauptsächlich auf Zeitzeugenberichten von Adolf Streckfuß und Gerichtsakten. Ergänzt werden diese durch das Werk von Dora Meyer und das Tagebuch von Karl August Varnhagen von Ense.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den Hungeraufstand in Berlin (unterteilt in Vorspiel, Eskalation und Nachspiel), ein Kapitel zum Vergleich mit den Ereignissen in Schwiebus und ein Fazit.
Was wird im Kapitel über den Hungeraufstand in Berlin behandelt?
Dieses Kapitel analysiert detailliert die „Kartoffelrevolution“ in Berlin 1847, untersucht die Ursachen, den Verlauf und die Folgen der Proteste, beleuchtet die unterschiedlichen Formen der Gewalt und deren Intensität. Ein besonderer Fokus liegt auf den Ereignissen um den Bäckermeister Blumberg als Wendepunkt der Eskalation. Die Rolle der beteiligten Akteure, die Reaktionen der Obrigkeit und die darauffolgenden Gerichtsverhandlungen werden ebenfalls behandelt.
Wozu dient der Vergleich mit den Ereignissen in Schwiebus?
Der Vergleich der Berliner „Kartoffelrevolution“ mit dem Hungeraufstand in Schwiebus verdeutlicht die Variabilität der Gewaltentwicklung in ähnlichen Protesten. Der Schwerpunkt liegt auf den Unterschieden im Umgang mit dem Konflikt und den jeweiligen Folgen. Der Vergleich soll die Vielschichtigkeit von Hungeraufständen dieser Zeit hervorheben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hungerproteste, Kartoffelrevolution, Berlin 1847, Gewalt, Sozialer Protest, Moralische Ökonomie, Revolution 1848/49, Gewalteskalation, Hunger, Nahrungsmittelknappheit, Preiserhöhungen, Obrigkeit, Gerichtsverhandlungen, Vergleich, Schwiebus.
- Arbeit zitieren
- David Baalmann (Autor:in), 2014, Gewaltentwicklung während der Sozial- und Hungerproteste, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301446