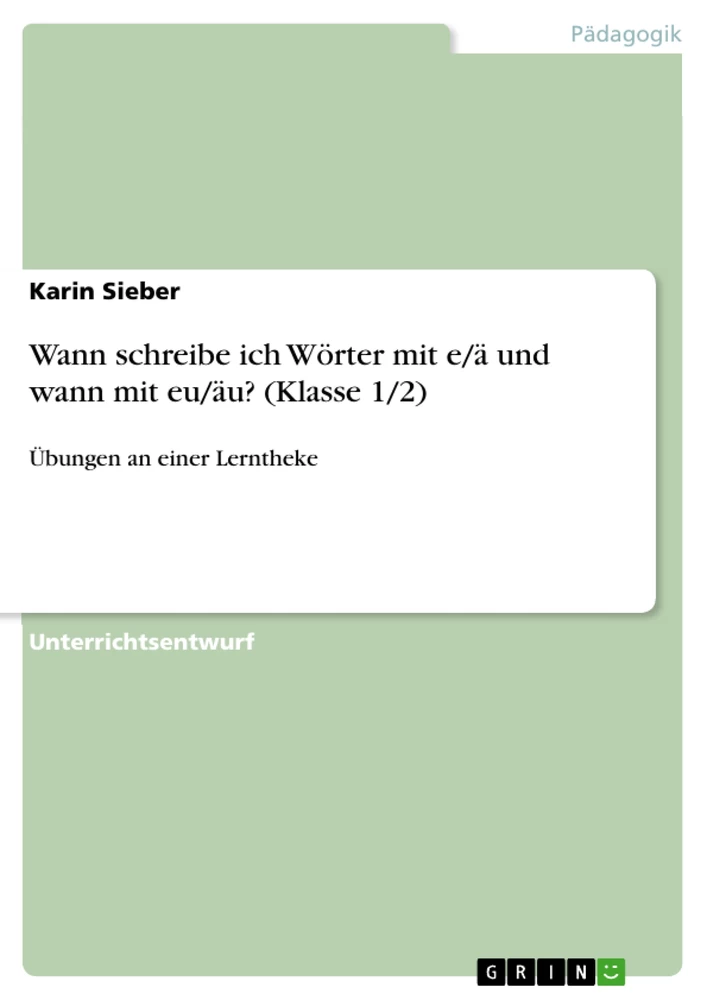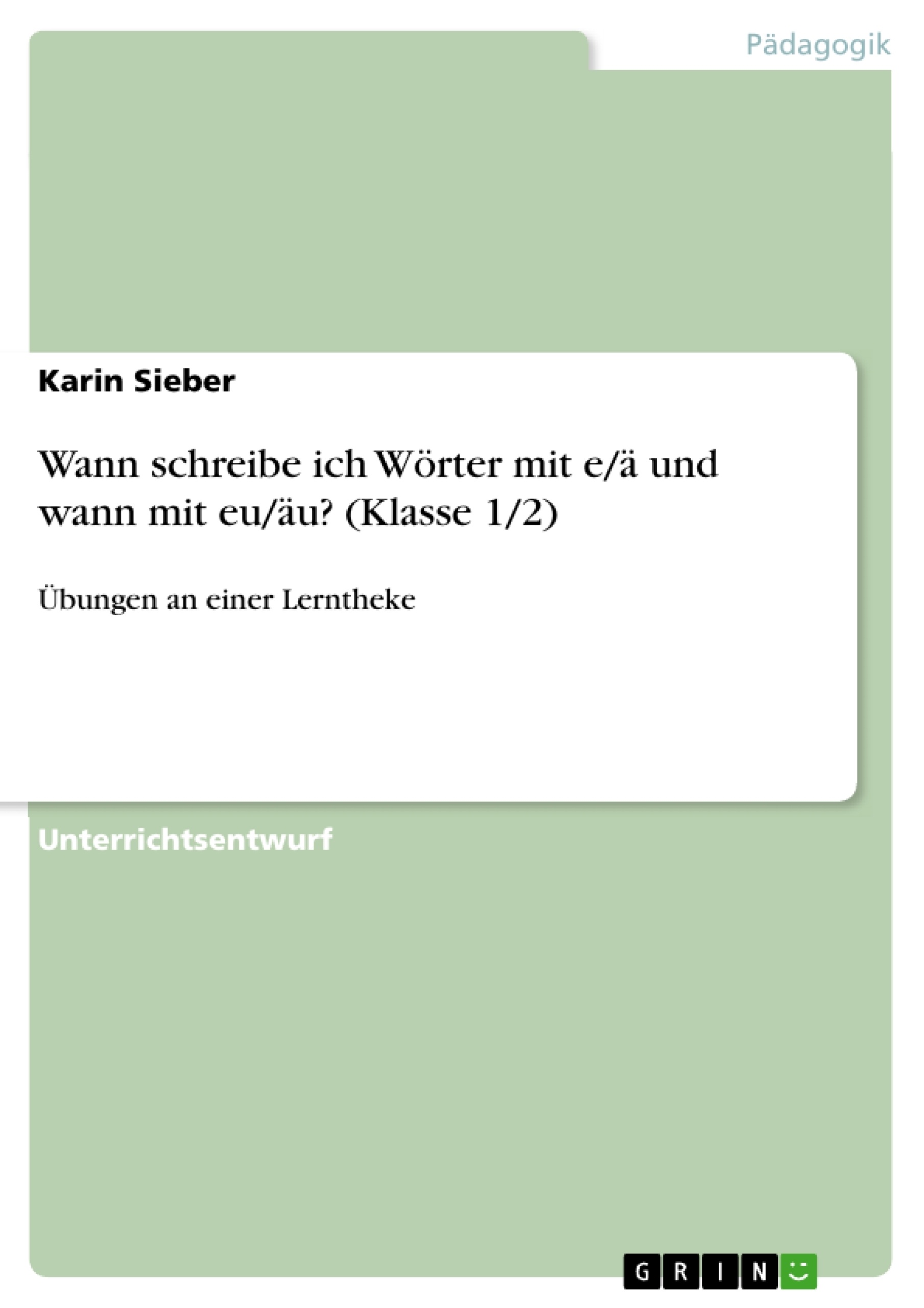Nachdem die Kinder die Regeln zu Umlautung kennengelernt haben, üben sie die Anwendung der Tipps an einer Lerntheke. Eine genaue Sachanalyse, der Einbezug des LehrplanPLUS, die Individuallage der Schüler ermöglichen einen didaktisch und methodisch exakt geplanten Stundenverlauf.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Lehrplanbezug - LehrplanPLUS Grundschule
- Darstellung der Sequenz
- Eröffnete Lernchancen und Ziele
- Grobziel
- Feinziele
- Begründung der Zielsetzung
- von der Sachstruktur
- von der Individuallage der Klasse
- Didaktische Reduktion
- Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Themas für die Schüler
- Angebote an der Lerntheke
- Methodisches Vorgehen
- Kommentierter Sitzplan
- Plan der Durchführung
- Tafelbild
- Literaturverzeichnis
- Grundlagenliteratur
- Fachwissenschaftliche Literatur
- Fachdidaktische Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Unterrichtseinheit zielt darauf ab, die Schüler der zweiten Jahrgangsstufe in die richtige Anwendung von Rechtschreibstrategien zum Umgang mit Umlautungen (a/ä und au/äu) einzuführen und zu festigen. Dabei werden die Prinzipien des phonologischen, silbischen und morphologischen Prinzips aufgezeigt und geübt.
- Entwicklung von Rechtschreibbewusstsein und Rechtschreibstrategien
- Anwendung des phonologischen, silbischen und morphologischen Prinzips zur Rechtschreibung
- Sicherung des Grundwortschatzes in Bezug auf Umlautungen
- Vernetzung der Unterrichtseinheit mit anderen Fachbereichen
- Individuelle Förderung und Differenzierung im Rechtschreibunterricht
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet den Lehrplanbezug der Unterrichtseinheit im Fach Deutsch in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe. Dabei werden die Kompetenzerwartungen im Bereich „Sprachgebrauch und Sprache untersuchen“ und die Bedeutung des Schriftspracherwerbs im LehrplanPLUS hervorgehoben. Das zweite Kapitel fokussiert auf die didaktische Reduktion des Themas, die die Relevanz der Umlautungen für die Schüler verdeutlicht und die Angebote an der Lerntheke darstellt. Das dritte Kapitel zeigt das methodische Vorgehen in der Unterrichtseinheit auf, wobei der kommentierte Sitzplan, der Plan der Durchführung und das Tafelbild erläutert werden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem Thema „Umlautung“ und ihren Rechtschreibregeln. Wichtige Schlüsselwörter sind Rechtschreibung, Rechtschreibstrategien, phonologisches Prinzip, silbisches Prinzip, morphologisches Prinzip, Grundwortschatz, Umlaute a/ä und au/äu, LehrplanPLUS, Kompetenzstrukturmodell, Differenzierung und Individualisierung.
- Quote paper
- Karin Sieber (Author), 2015, Wann schreibe ich Wörter mit e/ä und wann mit eu/äu? (Klasse 1/2), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301512