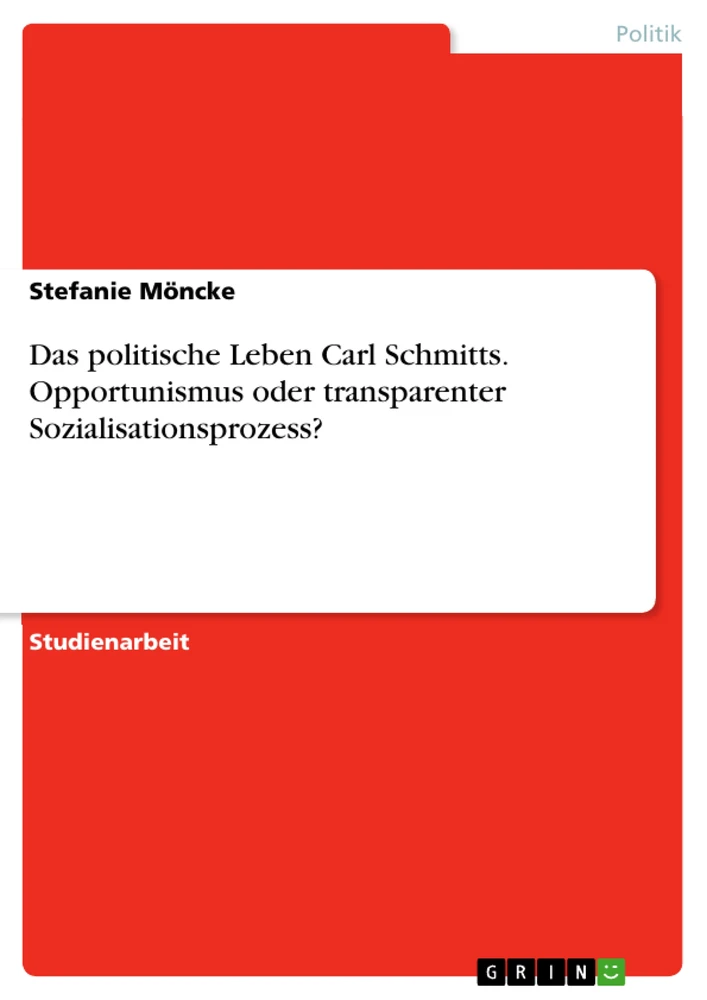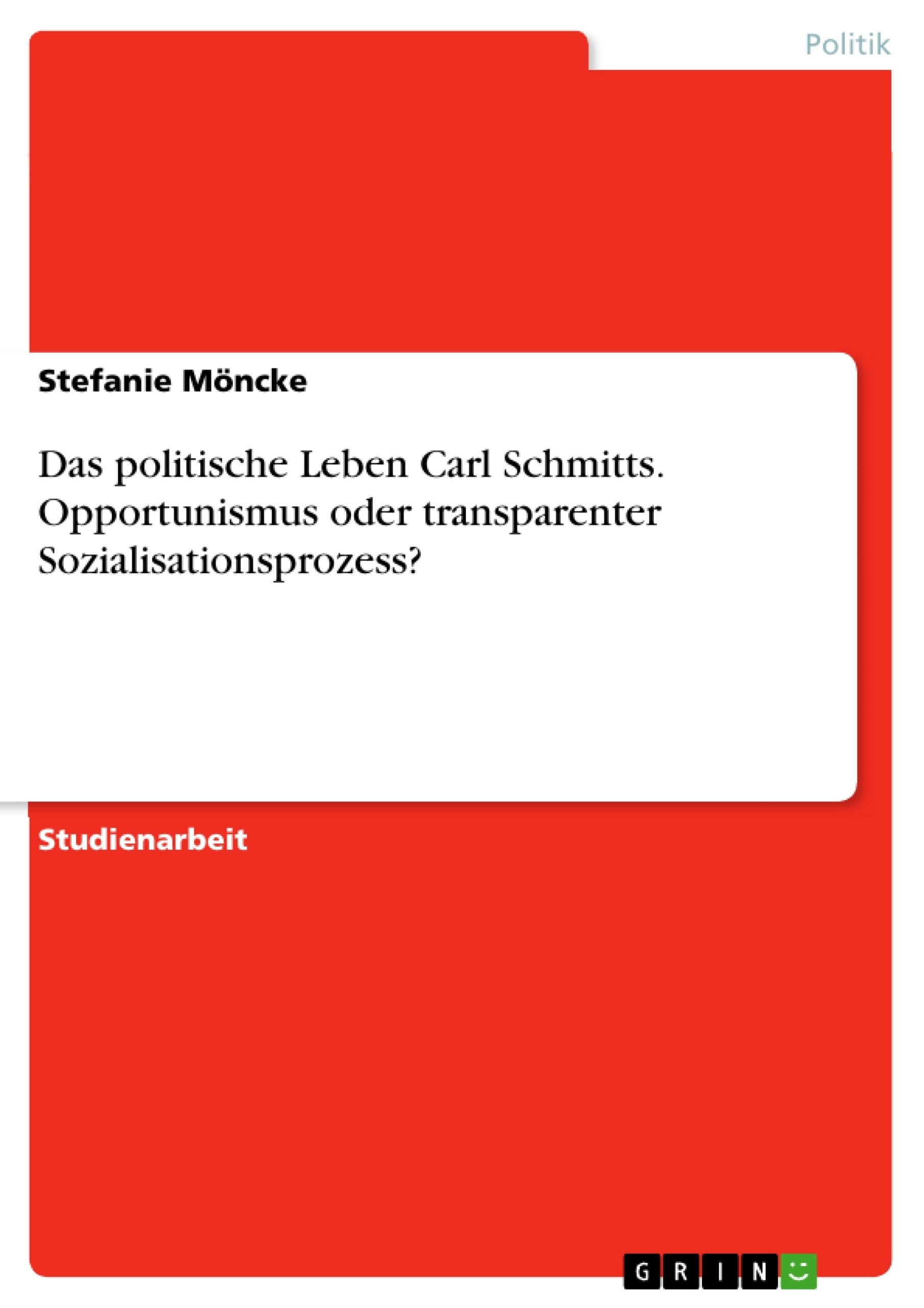Diese Arbeit schließt das Seminar mit dem Titel „Hannah Arendt und Carl Schmitt“ im Wintersemester 2014 ab. Im Seminar wurden die Politikkonzepte von Hannah Arendt und Carl Schmitt behandelt.
Es repräsentierte zwei konträre Antworten auf die Frage nach dem Politischen: auf der einen Seite Hannah Arendts politische Philosophie der Freiheit, auf der anderen Seite Carl Schmitts Politikbegriff begründet in der radikalen Freund-Feind-Unterscheidung. In der Begriffsgeschichte des Politischen müssen die eben genannten beiden Traditionslinien unterschieden werden (Vgl. Marchart 2010, S. 14).
Carl Schmitt ist weltbekannt und möglicherweise der am meisten diskutierte deutsche Jurist und politische Denker des 20. Jahrhunderts. In Verbindung mit seinem Namen stehen Begriffe wie politisches Handeln, Anti-Liberalismus und Opportunismus. Sein Hauptwerk „Der Begriff des Politischen“ (1932) gibt bis heute Anlass zu kritischen und unerschöpflichen Kontroversen im Bereich der politischen Geistesgeschichte. Einerseits schreiben ihm Kritiker das Scheitern der Weimarer Republik zu und bezeichnen ihn als „Kronjuristen“ des Dritten Reiches, andererseits ist er für andere ein Denker und Klassiker der Politik (Vgl. Ottmann 1990, S. 61). Diese Widersprüchlichkeit wird im ersten Kapitel dieser Arbeit vertiefend dargestellt. Desweiteren lässt sich seine Biographie nahezu genau konstruieren, da seine stenografischen Tagebücher gut erhalten waren und entschlüsselt wurden, sowie die vielen Briefwechsel mit den wenigen vertrauten Freunden und seiner Familie gesammelt wurden. Zudem wurde er zu Lebzeiten stark kritisiert und stand in der Öffentlichkeit. Viele Originaldokumente sind heute in der Carl-Schmitt-Gesellschaft mit Sitz in seiner Heimatstadt Plettenberg einsehbar.
Die folgende Abhandlung beleuchtet eine Auswahl seiner Werke im Kontext der jeweiligen politischen Ereignisse. Das Ziel soll sein, Schmitt als Opportunisten zu entlarven oder ihn als schicksalsergebenen Staatsrechtler zu identifizieren. Als politischer Akteur steht er im historischen Kontext zu zwei Weltkriegen und der Weimarer Republik. Ab dem dritten Abschnitt wird also der Frage nachgegangen, in welchen Punkten und an welchen Ereignissen man ihm opportunistisches Handeln vorwerfen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsklärungen
- 1.1. Sozialisation
- 1.2. Opportunismus
- 2. Wer war dieser Carl Schmitt?
- 2.1. Wichtige Ereignisse bis 1914
- 3. Aufstieg im Wilhelminismus
- 3.1. Sein Freund: Fritz Eisler (1887-1914)
- 4. Schmitt in Weimar
- 4.1. Sein Freund: Moritz Julius Bonn (1873-1965)
- 5. Nationalsozialistisches Engagement und Enttäuschung (1933-1936)
- 6. Schmitt nach 1945 - Langsamer Rückzug
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das politische Leben von Carl Schmitt und hinterfragt, ob es als opportunistisch oder als Ergebnis eines Sozialisationsprozesses betrachtet werden kann. Sie setzt sich mit seinem Aufstieg, seinen politischen Engagements und seiner Entwicklung im Kontext der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus auseinander.
- Schmitts politische Philosophie und seine Theorie der Freund-Feind-Unterscheidung
- Schmitts Rolle im Wilhelminismus und in der Weimarer Republik
- Schmitts Engagement im Nationalsozialismus und seine spätere Enttäuschung
- Die Frage nach Schmitts Opportunismus und seine mögliche Sozialisation
- Schmitts Einfluss auf die politische Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Seminar „Hannah Arendt und Carl Schmitt“ und die konträren Politikkonzepte von Arendt und Schmitt vor. Sie führt in das Thema der Arbeit ein und skizziert die Biographie von Carl Schmitt sowie die methodischen Aspekte der Arbeit.
- 1. Begriffsklärungen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Sozialisation und Opportunismus. Es erläutert, wie diese Konzepte im Kontext von Schmitts Leben relevant sind.
- 2. Wer war dieser Carl Schmitt?: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Schmitts Leben, seine wichtigen Ereignisse bis 1914 und seine Rolle im Wilhelminismus. Es führt auch seine Freundschaft mit Fritz Eisler ein.
- 3. Aufstieg im Wilhelminismus: Dieses Kapitel beleuchtet Schmitts Aufstieg im Wilhelminismus und seine Freundschaft mit Fritz Eisler.
- 4. Schmitt in Weimar: Dieses Kapitel untersucht Schmitts Rolle in der Weimarer Republik und seine Freundschaft mit Moritz Julius Bonn.
- 5. Nationalsozialistisches Engagement und Enttäuschung (1933-1936): Dieses Kapitel behandelt Schmitts Engagement im Nationalsozialismus und seine spätere Enttäuschung mit der NS-Herrschaft.
- 6. Schmitt nach 1945 - Langsamer Rückzug: Dieses Kapitel fokussiert auf Schmitts Leben und Arbeit nach dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich seines langsamen Rückzugs aus dem öffentlichen Leben.
Schlüsselwörter
Carl Schmitt, politische Philosophie, Freund-Feind-Unterscheidung, Opportunismus, Sozialisation, Wilhelminismus, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, politisches Handeln, Anti-Liberalismus, Geistesgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Carl Schmitt und warum ist er so umstritten?
Carl Schmitt war ein einflussreicher Jurist und politischer Denker des 20. Jahrhunderts. Er gilt einerseits als Klassiker der Politik, andererseits als "Kronjurist" des Dritten Reiches.
Was ist das Hauptwerk von Carl Schmitt?
Sein bekanntestes Werk ist "Der Begriff des Politischen" (1932), in dem er das Politische über die radikale Unterscheidung zwischen Freund und Feind definiert.
Wird Carl Schmitt in der Arbeit als Opportunist bezeichnet?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob Schmitts Handeln opportunistisch war oder ob er als schicksalsergebener Staatsrechtler agierte, der durch seinen Sozialisationsprozess geprägt war.
Welche Phasen seines Lebens werden untersucht?
Die Analyse umfasst seinen Aufstieg im Wilhelminismus, seine Zeit in der Weimarer Republik, sein Engagement im Nationalsozialismus (1933-1936) und seinen Rückzug nach 1945.
Welche Rolle spielten seine Freundschaften für sein Denken?
Die Arbeit beleuchtet Beziehungen zu Personen wie Fritz Eisler und Moritz Julius Bonn, um Schmitts persönliche und politische Entwicklung im historischen Kontext besser zu verstehen.
Wie unterscheidet sich Schmitts Ansatz von dem Hannah Arendts?
Während Hannah Arendt eine politische Philosophie der Freiheit vertritt, basiert Schmitts Konzept auf der existenziellen Freund-Feind-Unterscheidung und Machtstrukturen.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Möncke (Autor:in), 2015, Das politische Leben Carl Schmitts. Opportunismus oder transparenter Sozialisationsprozess?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301609