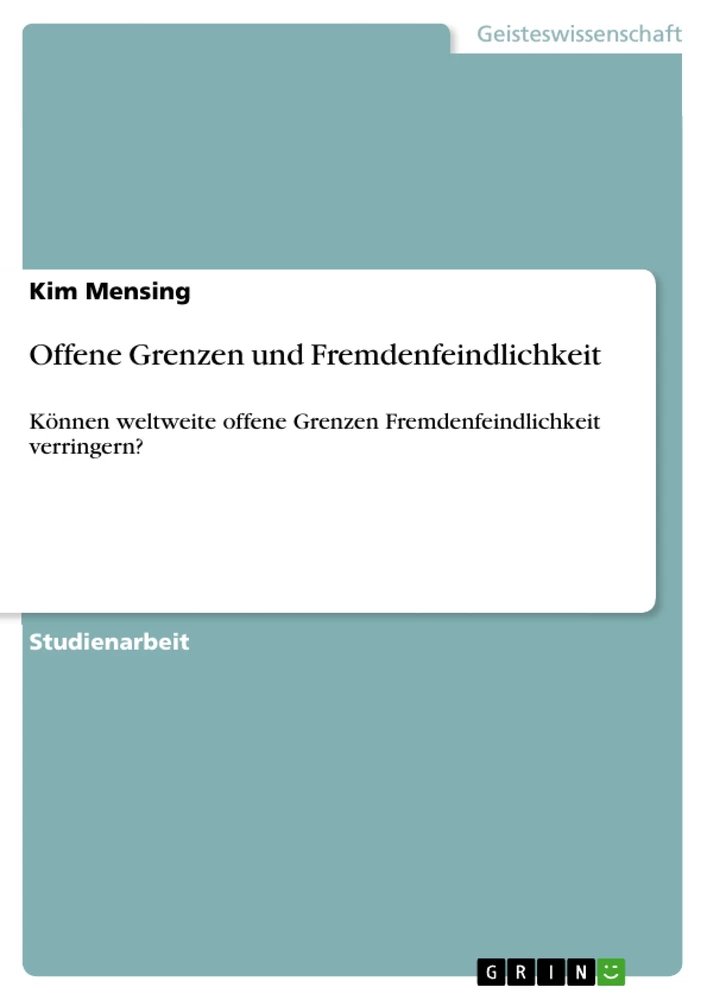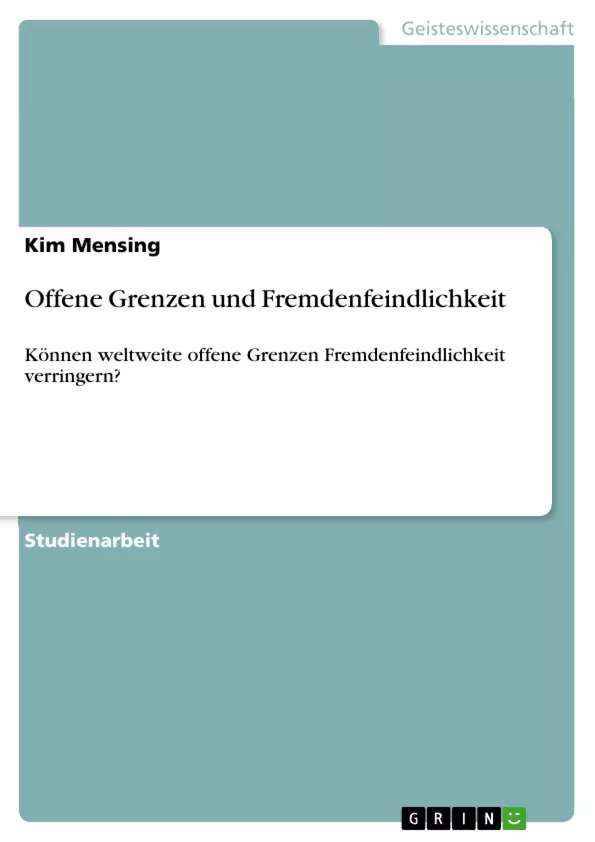Verschiedene Grenzmodelle formulieren unterschiedliche Vorstellungen einer Gesellschaft. Der Nationalstaat schließt seine Grenzen, um die Homogenität seiner Kultur zu bewahren, während die Republik verfassungsgemäß offen für fremde Kulturen ist und seine Grenzen nicht vollständig schließt. In der Annahme, dass Multikulturalität Fremdenfeindlichkeit reduziert, könnte man daher meinen, dass offene Grenzen wenig Raum für Fremdenfeindlichkeit gegenüber anderen Kulturen bieten. Dennoch sind offene Grenzen alleine kein Garant für ein friedliches Miteinander. In der Bundesrepublik Deutschland ist Fremdenfeindlichkeit immer noch ein Thema, wie man beispielsweise an der islamfeindlichen Bürgerbewegung „Pegida“ sehen kann. Das wirft grundlegende Fragen über Fremdenfeindlichkeit auf: inwiefern wird sie durch Grenzen beeinflusst, und wo hört der Einfluss auf?
Ich werde diese Fragen anhand der These untersuchen, dass in einer imaginären Welt, in der alle Grenzen offen sind, die Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit zurückgeht. Als Grundlage für diese These definiere ich die offene Republik und deren Form von offenen Grenzen und stelle sie der Definition des Nationalstaats gegenüber. Anschließend beschäftige ich mich mit den Ergebnissen der Studie „Die Abwertung des Anderen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2011, die Fremdenfeindlichkeit in Europa untersucht. Über diese Studie werde ich Fremdenfeindlichkeit definieren und sie hinzuziehen, um die Neigung zur Fremdenfeindlichkeit im Nationalstaat mit der in der offenen Republik zu vergleichen. In Kapitel vier stelle ich relevante Aspekte von Michael Walzer’s Gesellschaftstheorie vor und diskutiere schließlich anhand der Ergebnisse die Auswirkungen offener Grenzen auf Fremdenfeindlichkeit am Beispiel der Europäischen Union. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
1.0 Einleitung
2.0 Grenzen und Identitäten
2.1 Der Nationalstaat und die nationale Identität
2.2 Die offene Republik und die weltbürgerliche Identität
3.0 Fremdenfeindlichkeit
3.1 Das Fremde und Fremdenfeindlichkeit
3.2 Studie „Die Abwertung der Anderen“
3.3 Die Neigung zur Fremdenfeindlichkeit: Nationalstaat vs. Republik
4.0 Offene Grenzen als Lösung?
4.1 Walzer: Gegenargumente
4.2 Diskussion am Beispiel der EU
5.0 Zusammenfassung und Fazit
1.0 Einleitung
Verschiedene Grenzmodelle formulieren unterschiedliche Vorstellungen einer Gesellschaft. Der Nationalstaat schließt seine Grenzen, um die Homogenität sei-ner Kultur zu bewahren, während die Republik verfassungsgemäß offen für fremde Kulturen ist und seine Grenzen nicht vollständig schließt.1 In der Annahme, dass Multikulturalität Fremdenfeindlichkeit reduziert, könnte man daher meinen, dass offene Grenzen wenig Raum für Fremdenfeindlichkeit gegenüber anderen Kulturen bieten. Die offenen Grenzen innerhalb der europäischen Union können der ehemaligen deutschen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zufolge Fremdenfeindlichkeit reduzieren:
„ Offene Grenzen innerhalb der Europäischen Union (EU) und die damit verbundene Freizügigkeit sind eine wichtige Errungenschaft. Anstelle von Abschottung und Grenzkontrollen wird das Zusammenleben in der EU neben dem freien Austausch von Waren und Dienstleistungen von der grenzfreien Reise- und Bewegungsfreiheit geprägt. Das ist der sichtbare Ausdruck für die Ü berwindung früherer Feindschaften und für das friedliche Miteinander “ [2]
Dennoch sind offene Grenzen alleine kein Garant für ein friedliches Miteinander. (Beispiel Flüchtlinge & Festung Europa) In der Bundesrepublik Deutschland ist Fremdenfeindlichkeit immer noch ein Thema, wie man beispielsweise an der islamfeindlichen Bürgerbewegung „Pegida“ sehen kann. Selbst Leutheusser-Schnarrenberger wendet ein, dass die von ihr genannten positiven Aspekte der europäischen Grenzöffnung nicht unbedingt der Realität entsprechen.3 Das wirft grundlegende Fragen über Fremdenfeindlichkeit auf: inwiefern wird sie durch Grenzen beeinflusst, und wo hört der Einfluss auf?
Ich werde diese Fragen anhand der These untersuchen, dass in einer imaginären Welt, in der alle Grenzen offen sind, die Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit zurückgeht. Als Grundlage für diese These definiere ich die offene Republik und deren Form von offenen Grenzen und stelle sie der Definition des Nationalstaats gegenüber. Anschließend beschäftige ich mich mit den Ergebnissen der Studie „Die Abwertung des Anderen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2011, die Fremdenfeindlichkeit in Europa untersucht. Über diese Studie werde ich Fremdenfeindlichkeit definieren und sie hinzuziehen, um die Neigung zur Fremdenfeindlichkeit im Nationalstaat mit der in der offenen Republik zu vergleichen. In Kapitel vier stelle ich relevante Aspekte von Michael Walzer’s Gesellschaftstheorie vor und diskutiere schließlich anhand der Ergebnisse die Auswirkungen offener Grenzen auf Fremdenfeindlichkeit am Beispiel der Europäischen Union. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Fragestellungen.
2.0 Grenzen und Identitäten
2.1 Der Nationalstaat und die nationale Identität
Der Nationalstaat ist eine Ideologie und defininiert sich besonders über seine Souveränität, also seine politische Unabhängigkeit gegenüber anderen Staaten.4 Man könnte sagen, der Nationalstaat möchte sich von dem Rest der Welt abgrenzen. Gleichzeitig strebt er eine homogene Gesellschaft an, wie Oberndörfer formuliert: „Wer nicht an der ‘Substanz der Gleichheit’ (Carl Schmitt) des Staatsvolkes teilhat, […] gilt als Stör- und Risikofaktor der nationalen Einheit […]“.5 Die Homogenisierung der Gesellschaft ist eine Tendenz, die nach Oberndörfer in allen Formen des Nationalstaats vorkommt, aber sich dennoch auf diverse Eigenschaften beziehen kann. So sprechen auch Braitling und Reese-Schäfer von verschiedenen Konzepten der Nationalität, die „[…] ethnisch, geschichtlich, religiös, sprachlich oder demokratisch-republikanisch […]“ begründet sein können.6
Diese Aspekte sind Gegenstand der nationalen Identität, die der Nationalstaat seiner Gesellschaft vorschreibt. Die Regierung eines Staates mit dieser Ideologie möchte immer über der Gesellschaft stehen: wie in der Definition von Karl W. Deutsch „[…] ist das politisch mobilisierte Volk […] ein Volk im Besitz eines Staates“.7 Schließlich muss sie, um das Konzept der Homogenität umzusetzen, die ungewünschten Bevölkerungsgruppen gezielt ausgrenzen, abschieben oder gar physisch vernichten. Die einzelnen Aspekte der nationalen Identität werden nach Oberndörfer in den meisten Fällen geschichtlich begründet. Diese starren und einseitigen Aspekte sind nicht nur ungenau und bestehen meist aus Mythen, sondern bauen auf einem Kulturbegriff auf, der die Kultur als einheitlich ansieht: „In Wirklichkeit weist aber die Geschichte der Kulturen und Völker niemals nur ‘eine’ und noch dazu homogene Identität auf. Kulturen und Völker sind immer vielgestaltig und dynamische, sich in ihrer Geschichte verändernde Gebilde“.8 Staatsfremde oder auch Einwanderer haben es insofern schwer – meist werden sie von der Einreise ferngehalten. Dadurch, so Oberndörfer, „[…] verarmt die individuelle und kolllektive kulturelle und ethnische Vielfalt“.9
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nationalstaaten durch das Streben nach Homogenität diejenigen ausschließt, die aufgrund ihrer Kultur, Ethnie, Sprache etc. nicht der nationalen Identität entsprechen können. Wie sich das auf die Fremdenfeindlichkeit auswirkt, soll später behandelt werden. Zunächst stelle ich die Theorie der offenen Republik vor.
2.2 Die offene Republik und die weltbürgerliche Identität
Die Republik ist eine Staatsform, und ich bin mir bewusst, sie nicht direkt mit der Ideologie des Nationalstaats vergleichen zu können. Allerdings liegt auch eine Staatsform wie die Republik diversen Ideen zugrunde, wie sich eine Gesellschaft konstituiert. Auf diese grundsätzlich unterschiedlichen Ideen möchte ich hier aufmerksam machen. Da es viele verschiedene Formen der Republik gibt und ich aus Platzgründen nicht alle erläutern kann, beziehe ich mich hier weiterhin auf die Definition von Oberndörfer. Demnach wird die Gesellschaft einer Republik durch die gemeinsame Verfassung zusammengehalten: „Die Lebensgrundlage der Republik ist der Verfassungspatriotismus, die aktive Identifikation der Bürgerinnen mit der politischen Ordnung und den Werten der Republik“.10 Gleichzeitig strebt sie nach kultureller Diversität statt nach Homogenität. Dieser Anspruch wird durch die Verfassung begünstigt: die Identität der Bürger baut nicht auf einer gemeinsamen Kultur auf, sondern auf Rechten, die sich „[…] aus der Natur ‘des’ Menschen“ ableiten.11 Die Republik ermöglicht die Zugehörigkeit damit jedem Individuum – unabhängig von Hautfarbe, Muttersprache oder Glaube. Da sie sich über die Verfassung identifiziert, ist die Identität der Republik nicht national, sondern weltbürgerlich: „Ein Staat, der sich auf die Durchsetzung der Herrschaft des Rechts und die Sicherung der Freiheit und Unversehrtheit seiner Bürger konzentriert, ist ein Staat, der für jeden zugänglich sein kann“.12
Oberndörfer meint, jede Republik müsse man aufgrund letzterer Eigenschaften als offen bezeichnen.13 Auch Yves Bizeul benutzt diesen Terminus und argumentiert in seinem Aufsatz „Nationalismus, Patriotismus und Loyalität zur offenen Republik“ dafür, dass man sich als Bürger einer offenen Republik gleichzeitig anderen Ländern zugehörig fühlen kann. Diese „verschachtelte gemeinsame Loyalität“ mache die Idee des Weltbürgertums aus.14 Die offene Republik ist also eine Staatsform, deren Grenzen offen sind – in dem Sinne, dass jeder Mensch ihr zugehören kann, der den Rechten und Pflichten, die die Verfassung formuliert, zustimmt.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich die hier erläuterten Thesen aufgreifen und mich damit auf die offenen Grenzen in Europa beziehen. Bevor es allerdings zu der Diskussion kommt, ob sich Fremdenfeindlichkeit in einer Welt aus offenen Grenzen reduzieren würde, widme ich mich zunächst dem Begriff der Fremdenfeindlichkeit und den Bedingungen, derer sie unterliegt.
3.0 Fremdenfeindlichkeit
3.1 Das Fremde und Fremdenfeindlichkeit
Was bedeutet fremd ? Der Begriff umschreibt zunächst etwas Unbekanntes, Andersartiges, das sich im häufigsten Gebrauch auf Orte und Kulturen bezieht.15 Es kann Neugier wecken, aber auch Angst auslösen. Die Angst vor dem Fremden ist jedoch keine hinreichende Bedingung für Fremdenfeindlichkeit, so Gansterer: „Sie wird erst dort primitiv, wo sie zur Fremdenfeindlichkeit […] wird“.16 Wo also hört Angst auf, wo fängt Feindlichkeit an – und wie äußert sich diese?
Es gibt diverse Formen von Fremdenfeindlichkeit, daher möchte ich mich auf die Beschreibungen der Studie „Die Abwertung des Anderen“ vom Friedrich-Ebert-Institut beziehen, die auch im Mittelpunkt des folgenden Abschnittes stehen wird. Sie untersucht die Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit in Europa anhand von Datenerhebungen aus acht europäischen Ländern. Unter Fremdenfeindlichkeit versteht die Studie eine negative Einstellung bestimmten Menschengruppen gegenüber, denen man sich nicht zugehörig fühlt. Unter diese Gruppen fallen oft Einwanderer, wobei sich Fremdenfeindlichkeit in Europa besonders gegen „[…] dunkelhaarige Menschen aus muslimischen Ländern […]“ richtet.17 Allerdings gibt es keine Möglichkeit, universell auszusagen, gegen welche Gruppen sich Fremdenfeindlichkeit richtet. Selbst Einwanderer können nicht kategorisch als Opfer bezeichnet werden. Warum das so ist und wie Fremdenfeindlichkeit entsteht, möchte ich im Folgenden aufzeigen.
3.2 Studie „Die Abwertung der Anderen“
Ein wichtiger Aspekt von Fremdenfeindlichkeit ist, dass sie sich nicht gegen Individuen, sondern gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen richtet. Diese werden über Eigenschaften wie Hautfarbe und Sprache charakterisiert, die ohne besondere Kenntnis der Personen erkennbar sind: „Eine Person wird nicht aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften abgewertet […]. Dabei ist vollkommen unerheblich, inwieweit sich diese Person selbst als Mitglied dieser Gruppe ansieht oder ob sich diese Gruppenmitgliedschaft an Fakten festmachen lässt“.18 Selbst also, wenn sich fremdenfeindliche Handlungen gegen eine bestimmte Person richten, ist der eigentliche Auslöser die Feindlichkeit gegenüber einer fremden Gruppe, in die diese Person kategorisiert wird. So bringen viele Nordeuropäer dunkelhäutige Personen mit dem Islam in Verbindung – selbst wenn sich Letztere der Religion gar nicht zugehörig fühlen.
[...]
1 vgl. Internetseite 7
2 Schneider und Siemens 2014: 7
3 vgl. ebd.
4 vgl. Oberndörfer in Hentges und Butterwegge 2009: 237
5 Oberndörfer in Hentges und Butterwegge 2009: 240
6 Braitling und Reese-Schäfer 1991: 8
7 Alter 1985: 16
8 Oberndörfer in Hentges und Butterwegge 2009: 241
9 ebd.
10 Oberndörfer in Hentges und Butterwegge 2009: 249
11 Oberndörfer in Hentges und Butterwegge 2009: 239
12 Schneider und Siemens 2014: 88
13 vgl. Oberndörfer in Hentges und Butterwegge 2009: 239
14 Bizeul 2007: 38
15 vgl. Internetseite 2
16 Gansterer: 1
17 Zick et al. 2011: 45
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieses Textes?
Dieser Text untersucht den Einfluss von Grenzen auf Fremdenfeindlichkeit, indem er die Konzepte des Nationalstaats und der offenen Republik vergleicht und die Ergebnisse der Studie „Die Abwertung der Anderen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung berücksichtigt. Es wird die These untersucht, dass in einer Welt ohne Grenzen Fremdenfeindlichkeit abnehmen würde.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Nationalstaat und offener Republik?
Der Nationalstaat strebt nach Homogenität und schließt seine Grenzen, um die nationale Identität zu bewahren. Die offene Republik hingegen basiert auf einer gemeinsamen Verfassung, fördert kulturelle Vielfalt und ist prinzipiell für jeden zugänglich, der sich an die Verfassung hält.
Wie definiert der Text Fremdenfeindlichkeit?
Der Text stützt sich auf die Studie „Die Abwertung des Anderen“ und definiert Fremdenfeindlichkeit als eine negative Einstellung gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, denen man sich nicht zugehörig fühlt, oft basierend auf Merkmalen wie Hautfarbe oder Sprache.
Welche Rolle spielen Grenzen bei der Fremdenfeindlichkeit laut diesem Text?
Der Text untersucht, ob offene Grenzen Fremdenfeindlichkeit reduzieren können, indem er argumentiert, dass eine inklusive und vielfältige Gesellschaft weniger Anreize für Vorurteile bietet. Die EU wird als Beispiel diskutiert.
Was ist die "Die Abwertung der Anderen" Studie und warum ist sie relevant?
"Die Abwertung der Anderen" ist eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Fremdenfeindlichkeit in Europa untersucht. Sie ist relevant, da sie empirische Daten liefert, die zur Definition und zum Verständnis von Fremdenfeindlichkeit verwendet werden, und somit die Grundlage für den Vergleich zwischen Nationalstaat und offener Republik bildet.
Was ist das Konzept der "Weltbürgerliche Identität" im Zusammenhang mit der offenen Republik?
Die weltbürgerliche Identität, die mit der offenen Republik verbunden ist, bedeutet, dass die Zugehörigkeit zu dieser Staatsform nicht auf nationaler Identität beruht, sondern auf universellen Rechten und Pflichten, die in der Verfassung festgelegt sind. Dies ermöglicht eine "verschachtelte gemeinsame Loyalität" und fördert das Gefühl, gleichzeitig verschiedenen Ländern oder der Welt als Ganzes zugehörig zu sein.
Welche Kritik wird am Nationalstaatsmodell im Hinblick auf kulturelle Vielfalt geübt?
Der Text kritisiert, dass das Streben nach Homogenität im Nationalstaat zu Ausgrenzung und zum Verlust individueller und kollektiver kultureller Vielfalt führt. Die Definition der nationalen Identität basiert oft auf starren, einseitigen und historisch ungenauen Aspekten.
Welche Fragestellungen werden am Ende der Einleitung aufgeworfen?
Die Einleitung wirft grundlegende Fragen über Fremdenfeindlichkeit auf: Inwiefern wird sie durch Grenzen beeinflusst, und wo hört der Einfluss auf?
Wer ist Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und welche Position vertritt sie?
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist eine ehemalige deutsche Bundesjustizministerin. Sie vertritt die Position, dass offene Grenzen innerhalb der Europäischen Union (EU) Fremdenfeindlichkeit reduzieren können.
Was ist die These, die in der Arbeit untersucht wird?
Die These lautet, dass in einer imaginären Welt, in der alle Grenzen offen sind, die Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit zurückgeht.
- Arbeit zitieren
- Kim Mensing (Autor:in), 2015, Offene Grenzen und Fremdenfeindlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301727