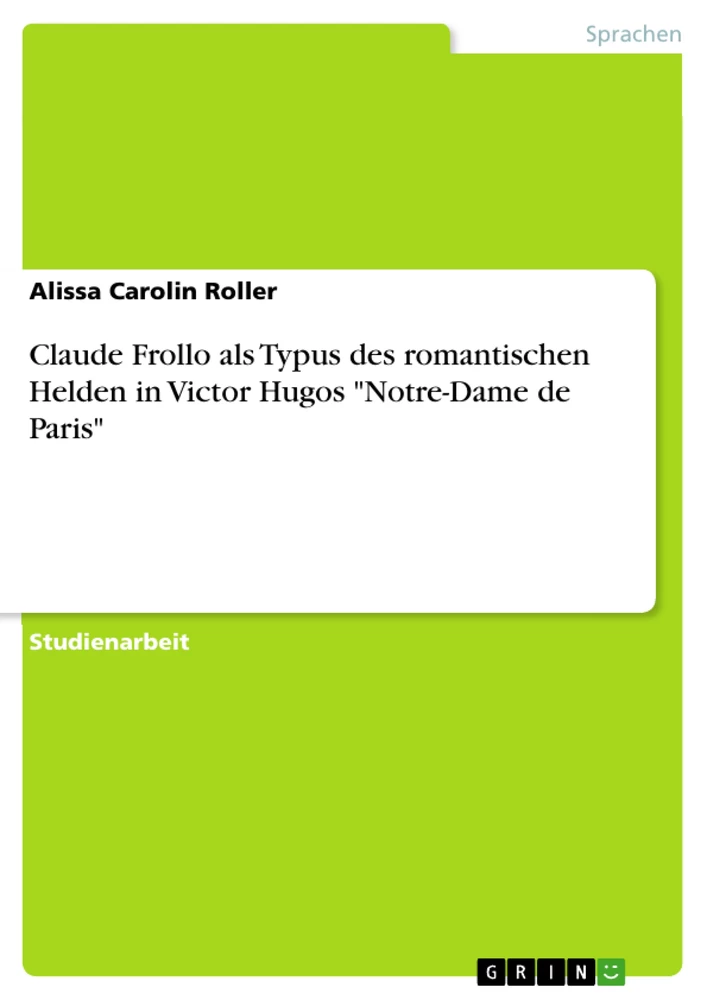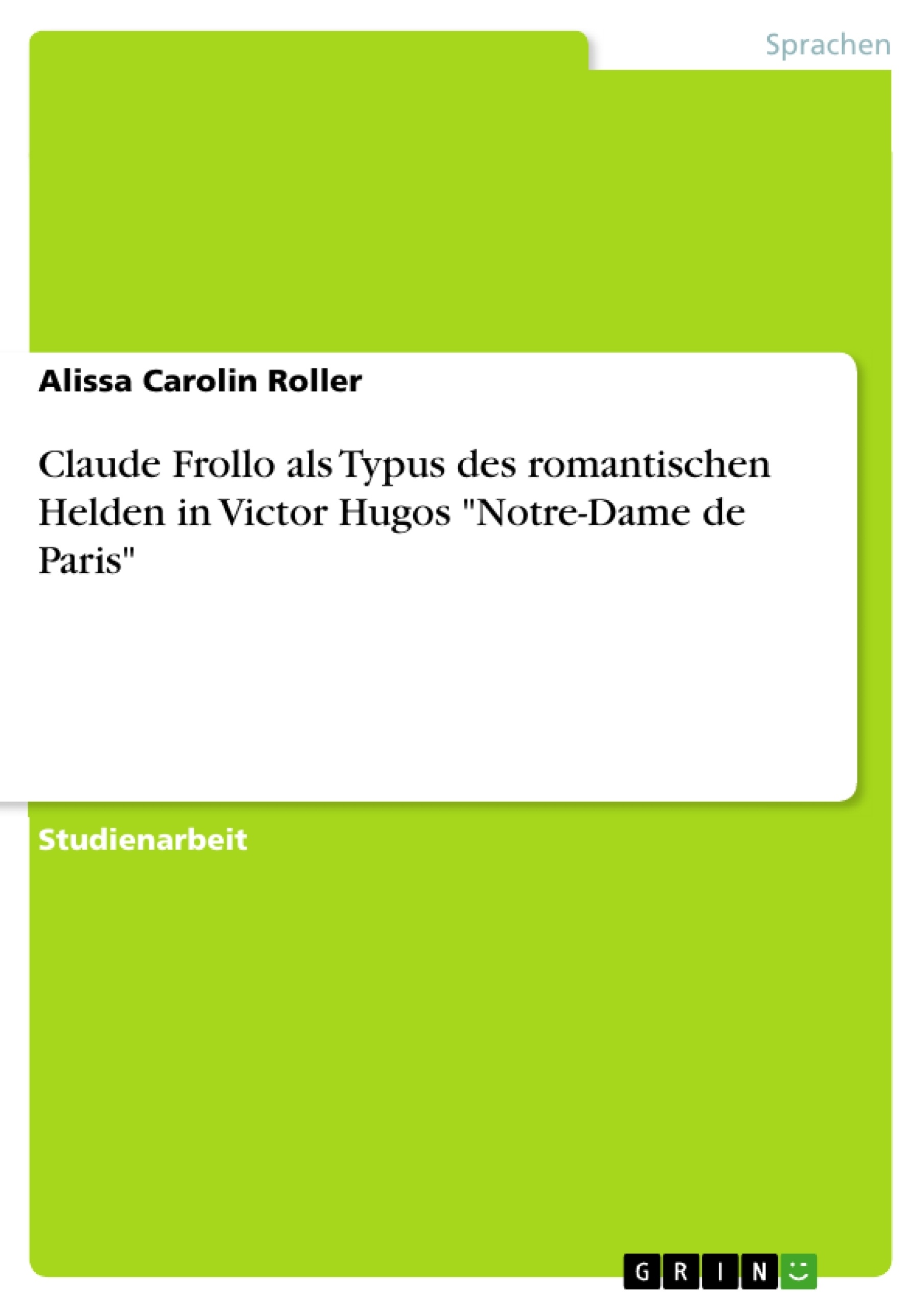"Notre-Dame de Paris" – eines der vielen literarischen Meisterwerke Victor Hugos, verfasst von 1830 bis 1831, fasziniert Leser über Generationen hinweg noch bis zum heutigen Tag. Das Werk ist zwar immer noch hochaktuell und ein gegenwartsbezogener Klassiker, hat sich aber mit der Zeit gewandelt: Aus den Lesern sind heutzutage teilweise Zuschauer geworden, die sich mit Notre-Dame de Paris beschäftigen, beispielsweise in Form eines 1998 erschienenen Musicals oder sehr aktuellen Verfilmungen, wie die Disney Produktion von 1996 oder der Hollywoodfernsehfilm von 1997. Diese Aktualität und das ständige Aufgreifen der Geschichte und Anpassen des Stoffes an die Gegenwart zeigt, dass die Geschichte um Quasimodo, den hässlichen Glöckner, die schöne Zigeunerin Esmeralda und den Erzdiakon Claude Frollo, zeitlos ist und der Leser oder Zuschauer immer wieder erneut Freude daran finden kann und einen Nutzen daraus ziehen kann.
In dieser Hausarbeit möchte ich allerdings keine Erklärungen für die Popularität des Werks suchen, sondern mich hauptsächlich auf die komplexe Figur des Erzdiakons Claude Frollo konzentrieren. In den folgenden Kapiteln werde ich zeigen, dass es sich bei Frollo nicht um den Bösewicht des Romans handelt, so wie er in vielen Referenzen der Popkultur dargestellt wird. Das beste Beispiel für die negative Darstellung des Charakters Frollo ist der 1997 erschienene Disney Film, der lose den Romaninhalt aufgreift und in dem Dom Frollo als Bösewicht und Gegenspieler des Helden Quasimodos dargestellt wird. Ich möchte hingegen zeigen, dass Frollo den eigentliche Helden des Romans darstellt, genauer gesagt, den Helden nach der romantischen Heldenkonzeption. Als Grundlage für die Argumentation soll eine allgemein Definition des romantischen Heldens dienen, mit der ich nun beginnen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heldenkonzeption der Romantik
- Heldenkonzeption anhand von problematischen Heldenfiguren der Romantik
- Byrons Childe Harold's Pilgrimage
- Byrons Manfred
- Goethes Faust
- Zusammenfassung
- Figurenkonstellation in Notre-Dame de Paris
- Claude Frollo
- Die Einführung von Frollos Charakter in den Roman und seine Lebensgeschichte
- Frollos Liebe zu Esmeralda
- Frollos Forschungen
- Konklusion
- Heldenkonzeption anhand von problematischen Heldenfiguren der Romantik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die komplexe Figur des Erzdiakons Claude Frollo in Victor Hugos Roman „Notre-Dame de Paris". Sie zielt darauf ab, Frollo nicht als den typischen Bösewicht darzustellen, wie er oft in der Popkultur präsentiert wird, sondern ihn als den eigentlichen Helden des Romans zu betrachten, genauer gesagt, als den Helden nach der romantischen Heldenkonzeption.
- Analyse von Frollos Charakter und Motivationen
- Untersuchung der romantischen Heldenkonzeption und deren Anwendung auf Frollo
- Beurteilung von Frollos Handlungen im Kontext der romantischen Ideale
- Rezeption von Frollo in der Literatur und Popkultur
- Betrachtung des Romans „Notre-Dame de Paris" als Beispiel für die romantische Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über den Roman „Notre-Dame de Paris" und seine Bedeutung in der Literatur und Popkultur. Sie stellt die Problematik der Rezeption von Frollo als Bösewicht dar und kündigt die Analyse von Frollo als romantischen Helden an.
Das zweite Kapitel untersucht die romantische Heldenkonzeption anhand von exemplarischen Figuren aus anderen romantischen Werken. Es werden die charakteristischen Merkmale des romantischen Helden herausgearbeitet und in den Kontext der Epoche gestellt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Figurenkonstellation in „Notre-Dame de Paris" und stellt die wichtigsten Figuren vor. Es legt den Fokus auf Frollos Charakter und seine Lebensgeschichte, seine Beziehung zu Esmeralda und seine Forschungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen romantische Heldenkonzeption, Claude Frollo, „Notre-Dame de Paris", Victor Hugo, Liebe, Tod, Schuld, Vergebung, Alchimie, Architektur, Mittelalter, Romantik, Popkultur.
Häufig gestellte Fragen
Ist Claude Frollo der Bösewicht in Victor Hugos Roman?
Die Hausarbeit argumentiert, dass Frollo entgegen moderner Popkultur-Darstellungen (wie bei Disney) eher als tragischer, romantischer Held zu verstehen ist.
Was macht Frollo zu einem „romantischen Helden“?
Seine Zerrissenheit zwischen Glaube, Wissenschaft (Alchimie) und leidenschaftlicher Liebe sowie sein Scheitern an gesellschaftlichen Normen sind typische Merkmale.
Wie unterscheidet sich die Romanfigur von der Disney-Version?
Im Roman ist Frollo ein hochgebildeter Erzdiakon mit einer komplexen Vorgeschichte, während er im Film oft auf einen eindimensionalen Schurken reduziert wird.
Welche Rolle spielt die Wissenschaft in Frollos Leben?
Frollo widmet sich intensiv der Alchimie und den Geheimnissen der Architektur, was seine Suche nach universeller Erkenntnis und seine Isolation widerspiegelt.
Warum ist die Geschichte von Notre-Dame de Paris zeitlos?
Themen wie unerfüllte Liebe, Ausgrenzung (Quasimodo) und der innere Konflikt zwischen Pflicht und Leidenschaft bleiben über Generationen relevant.
- Citar trabajo
- Alissa Carolin Roller (Autor), 2013, Claude Frollo als Typus des romantischen Helden in Victor Hugos "Notre-Dame de Paris", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301730