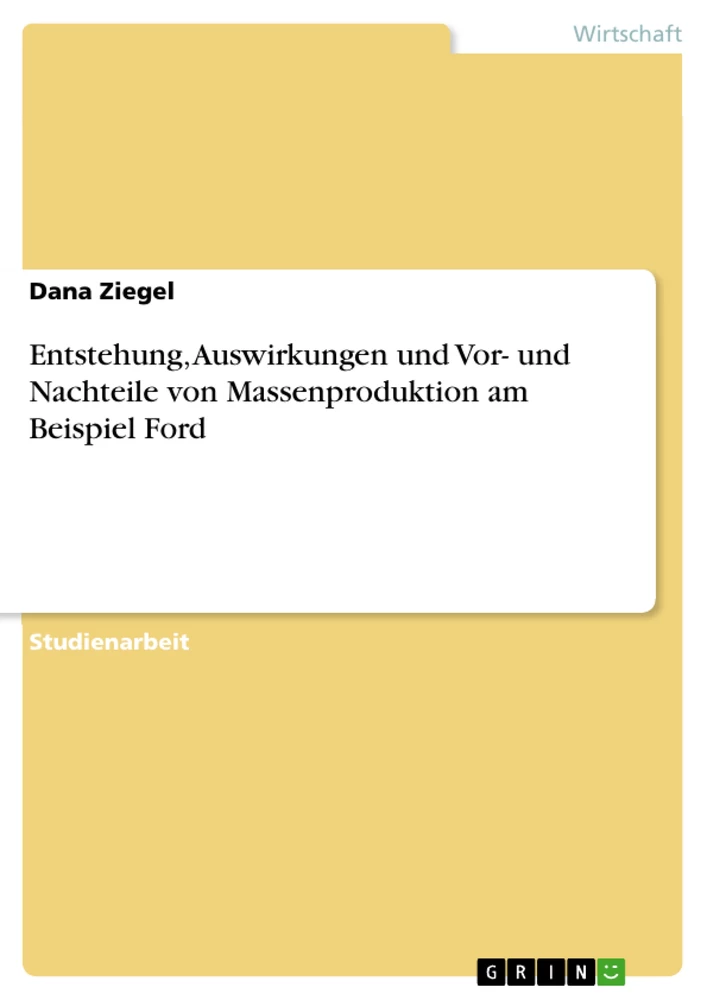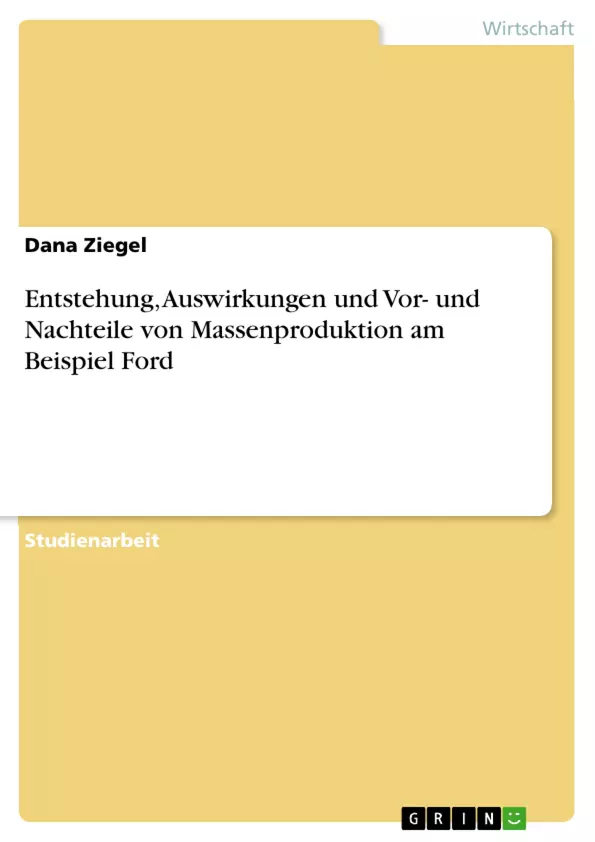Bei meiner Hausarbeit über die Entstehung von Massenproduktion am Bespiel Ford möchte ich nicht sofort mit der Betrachtung der Firma selber beginnen. Vielmehr soll die Frage erörtert werden, weshalb es überhaupt zu einer solchen Produktionsform gekommen ist. Welche Entwicklungen haben die Entstehung der Massenproduktion überhaupt ermöglicht und welche Auswirkungen hatte dieses System auf die Beteiligten?
Um die Ursprünge der Massenproduktion zu verdeutlichen, werde ich daher zuerst darauf eingehen, wie und warum sich die Marktorganisation im Laufe der Jahrhunderte überhaupt verändert hat und welche Auswirkungen das für den Arbeitsprozess an sich, aber auch für Menschen hatte. Da in diesem Zusammenhang vor allem der Begriff der Arbeitsproduktivität zunehmend eine Rolle spielt, werde ich mich im darauffolgenden Teil der Hausarbeit mit einigen Überlegungen von Adam Smith, Frederick Winslow Taylor und natürlich Henry Ford zu diesem Thema befassen. Mit Hilfe dieser Ausführungen werde ich dann die Entwicklung von der Fleißbandarbeit bis hin zur Massenproduktion in der Firma Ford selber verdeutlichen. Um jedoch auch die Chancen und Grenzen dieses Produktionssystems aufzuzeigen, arbeite ich abschließend einige aus der Praxis resultierende Vor- und Nachteile der Massenproduktion heraus.
Bereits im 15. Jahrhundert findet man arbeitsteilige Herstellungsprozesse, wie beispielsweise bei der Ausrüstung von Galeeren in Venedig, die während der Fahrt durch die Kanäle erfolgte. Diese weisen jedoch noch nicht die typischen Merkmale der Massenproduktion für Massenmärkte auf, da die Arbeitsabläufe weder zeitlich getaktet waren, noch ein Fließband existierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Ursprünge der Massenproduktion
- Marktorganisation vor dem 18. Jahrhundert
- Von der Selbstversorgung zur bezahlten Arbeit
- Vom natürlichen Rhythmus zum geregeltem Arbeitstag
- Die Praxis in den Betrieben
- Die Revolutionäre
- Adam Smith
- Frederick Winslow Taylor
- Henry Ford
- Die Firma Ford
- Vom Austauschbau zur Fließfertigung
- Von der Fließfertigung zur Massenproduktion
- Die Chancen und Grenzen der Massenproduktion
- Vorteile der Massenproduktion
- Nachteile der Massenproduktion
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Entstehung der Massenproduktion am Beispiel der Firma Ford. Sie erforscht die historischen Entwicklungen, die zur Etablierung dieses Produktionssystems führten, und untersucht die Auswirkungen auf den Arbeitsprozess und die Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die Veränderungen der Marktorganisation, die Bedeutung von Arbeitsteilung und die Rolle von Schlüsselpersonen wie Adam Smith, Frederick Winslow Taylor und Henry Ford.
- Die Transformation der Marktorganisation vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert
- Der Wandel von der Selbstversorgung zur bezahlten Arbeit
- Die Auswirkungen der Industrialisierung auf den Arbeitsprozess und die Arbeitszeit
- Die Entwicklung von der Fließbandarbeit zur Massenproduktion bei Ford
- Die Vor- und Nachteile der Massenproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach den Ursprüngen der Massenproduktion dar. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der Marktorganisation und zeigt den Wandel von der Selbstversorgung zur bezahlten Arbeit auf. Kapitel 3 stellt die Ideen von Adam Smith, Frederick Winslow Taylor und Henry Ford zur Arbeitsteilung und Produktivitätssteigerung vor. Kapitel 4 untersucht die Entwicklung der Fließbandarbeit und der Massenproduktion in der Firma Ford. Kapitel 5 diskutiert die Vor- und Nachteile der Massenproduktion, die aus der Praxis resultieren.
Schlüsselwörter
Massenproduktion, Fordismus, Marktorganisation, Selbstversorgung, bezahlte Arbeit, Arbeitsteilung, Produktivitätssteigerung, Fließbandarbeit, Arbeitszeit, Industrialisierung, Vorteile und Nachteile der Massenproduktion.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Wegbereiter der modernen Massenproduktion?
Wichtige Vordenker waren Adam Smith (Arbeitsteilung), Frederick Winslow Taylor (wissenschaftliche Betriebsführung) und Henry Ford (Fließbandfertigung).
Wie veränderte Henry Ford den Arbeitsprozess?
Ford führte die Fließbandfertigung ein, die eine enorme Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Produktion für Massenmärkte ermöglichte.
Was sind die Vorteile der Massenproduktion?
Vorteile sind sinkende Stückkosten, eine hohe Verfügbarkeit von Waren und eine Standardisierung der Produkte.
Welche Nachteile bringt dieses Produktionssystem mit sich?
Nachteile sind die Monotonie der Arbeit für die Beschäftigten, geringe Flexibilität bei Produktänderungen und eine starke Abhängigkeit vom Takt des Fließbands.
Wann gab es erste Ansätze von Arbeitsteilung vor der Industrialisierung?
Bereits im 15. Jahrhundert gab es arbeitsteilige Prozesse, etwa bei der Ausrüstung von Galeeren in Venedig, allerdings noch ohne zeitliche Taktung oder Fließband.
- Quote paper
- Dana Ziegel (Author), 2005, Entstehung, Auswirkungen und Vor- und Nachteile von Massenproduktion am Beispiel Ford, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301826