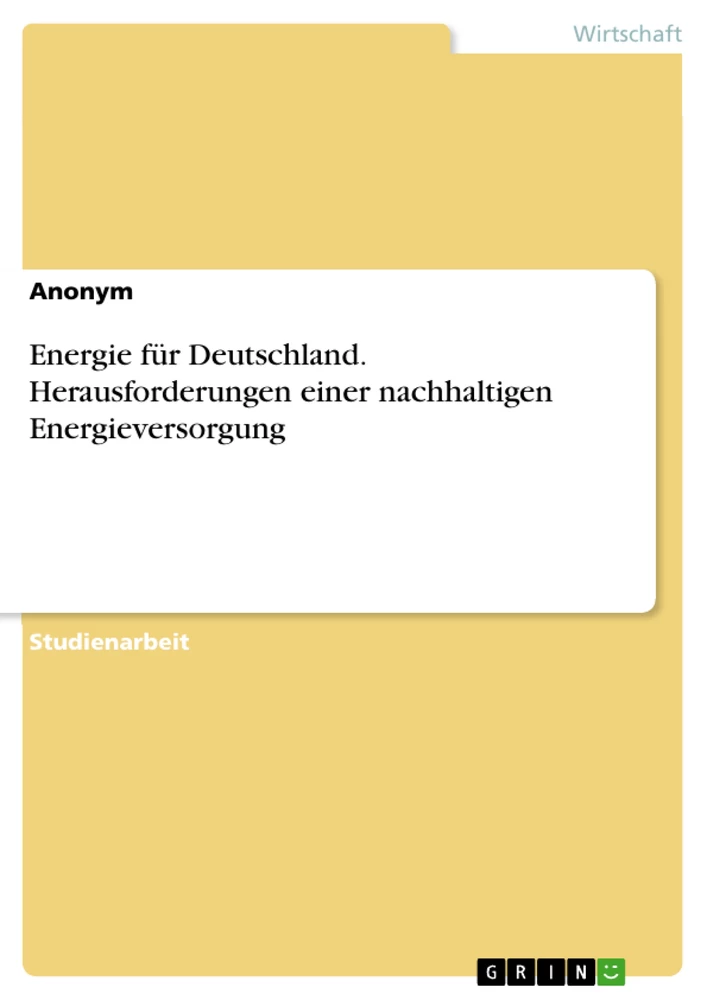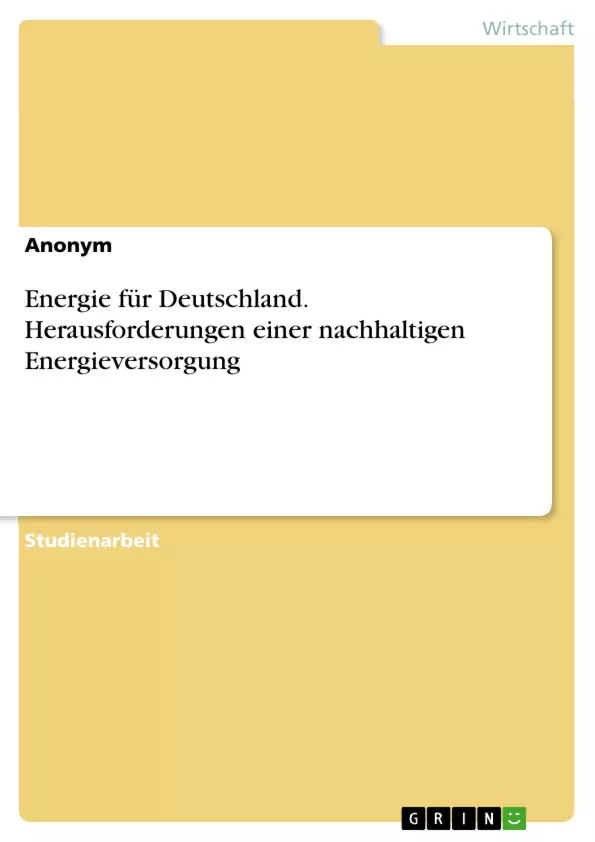„Made in Germany“ – dieser Slogan wird weltweit als Qualitätssiegel für in Deutschland produzierte Waren angesehen. Diese Wahrnehmung ist darauf zurückzuführen, dass die Produktion hochwertiger Güter und komplexer technologischer Produkte eine traditionelle Stärke Deutschlands Wertschöpfung darstellt. Grundlage hierfür sind zum einen die Ausbildung hochqualifizierter Ingenieure und Facharbeiter, sowie andererseits die starke Förderung international anerkannter industrieller Forschung und Entwicklung. Zusammen hat dies zur Entwicklung Deutschlands hin zu einer der führenden Exportnationen geführt.
Alleine die etwa 22.500 Unternehmen, welche im Bereich des verarbeitenden Gewerbes tätig sind, erwirtschafteten im Jahr 2013 einen Umsatz von etwa 1,6 Billionen Euro und beschäftigten über 5 Millionen Mitarbeiter. Besonders stark exportorientierte Branchen sind hierbei der Maschinen und Anlagenbau, die Chemieindustrie und der Automobilbau, wobei der aus Exporten generierte Umsatz in diesen teilweise deutlich mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz beisteuert. Eine Besonderheit der deutschen Industrielandschaft ist, dass dieser Export nicht hauptsächlich durch einige wenige große multinationale Konzerne getragen wird, sondern dass sich die Unternehmensstruktur vielmehr durch eine ausgeglichene Mischung aus eben jenen Großkonzernen sowie innovativen und agilen mittelständischen oft inhabergeführten Unternehmen auszeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Energie in Deutschland
- Entwicklung der deutschen Energienachfrage
- Die Versorgungssicherheit Deutschlands
- Alternative wirtschaftspolitische Modelle
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung in Deutschland. Sie analysiert die Entwicklung der deutschen Energienachfrage, die Versorgungssicherheit des Landes und alternative wirtschaftspolitische Modelle.
- Entwicklung der deutschen Energienachfrage
- Versorgungssicherheit Deutschlands
- Alternative wirtschaftspolitische Modelle
- Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung
- Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung der deutschen Industrie für die nationale Wirtschaft und den internationalen Wettbewerb dar. Sie hebt die Rolle von hochwertigen Gütern und technologischen Produkten sowie die Bedeutung von qualifizierten Fachkräften und Forschung und Entwicklung hervor.
Energie in Deutschland
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der deutschen Energienachfrage und der Versorgungssicherheit des Landes. Es analysiert die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten und die Herausforderungen, die sich aus dieser Abhängigkeit ergeben.
Zusammenfassung und Fazit
Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit zu den Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Energieversorgung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Wirtschaftspolitik, Versorgungssicherheit, alternative Energiequellen, Energieeffizienz, fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien, Import und Export.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Herausforderungen für Deutschlands Energieversorgung?
Die Hauptfaktoren sind die Sicherstellung einer nachhaltigen Versorgung, die Reduzierung der Abhängigkeit von Energieimporten und die Vereinbarkeit von Klimaschutz mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit.
Welche Bedeutung hat die Industrie für den Energiemarkt?
Das verarbeitende Gewerbe ist eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft (z. B. Maschinenbau, Chemie). Diese Branchen sind extrem energieintensiv und hängen von stabilen Energiepreisen ab.
Wie sicher ist die Energieversorgung in Deutschland aktuell?
Die Versorgungssicherheit wird durch eine Mischung aus fossilen Brennstoffen und dem Ausbau erneuerbarer Energien angestrebt, wobei die Importabhängigkeit bei Öl und Gas eine strategische Herausforderung bleibt.
Welche Rolle spielen alternative wirtschaftspolitische Modelle?
Diskutiert werden Modelle, die Anreize für Energieeffizienz setzen und den Übergang zu einer CO2-neutralen Produktion fördern, ohne den Industriestandort Deutschland zu gefährden.
Was trägt Forschung und Entwicklung zur Energiewende bei?
Durch die Förderung komplexer technologischer Produkte und innovativer mittelständischer Unternehmen kann Deutschland neue Lösungen für eine effiziente und nachhaltige Energienutzung exportieren.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Energie für Deutschland. Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301858