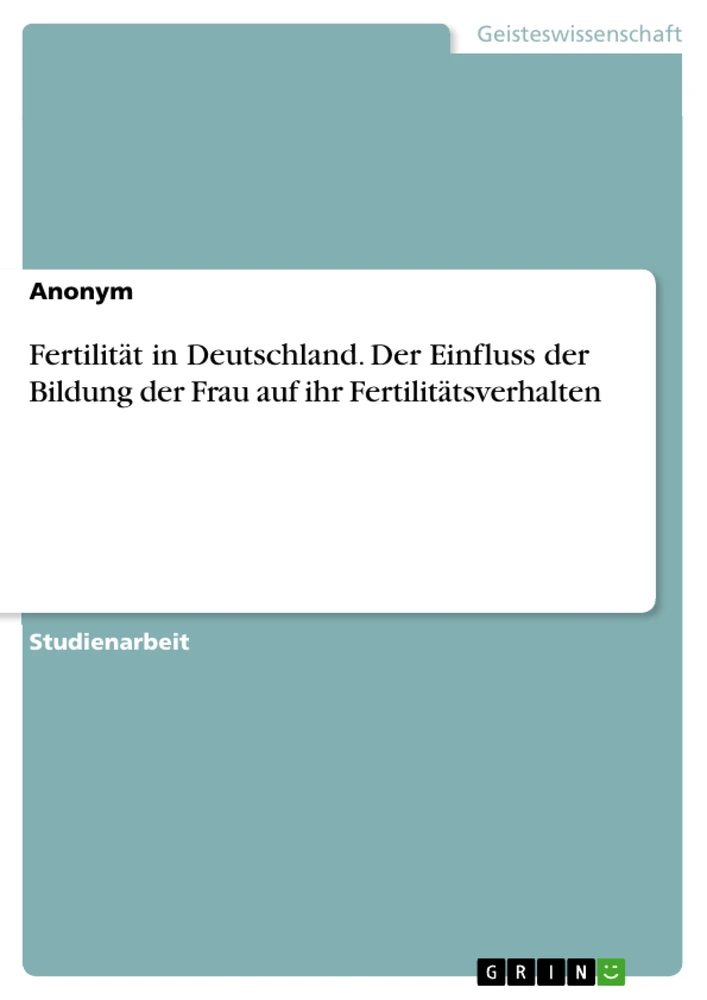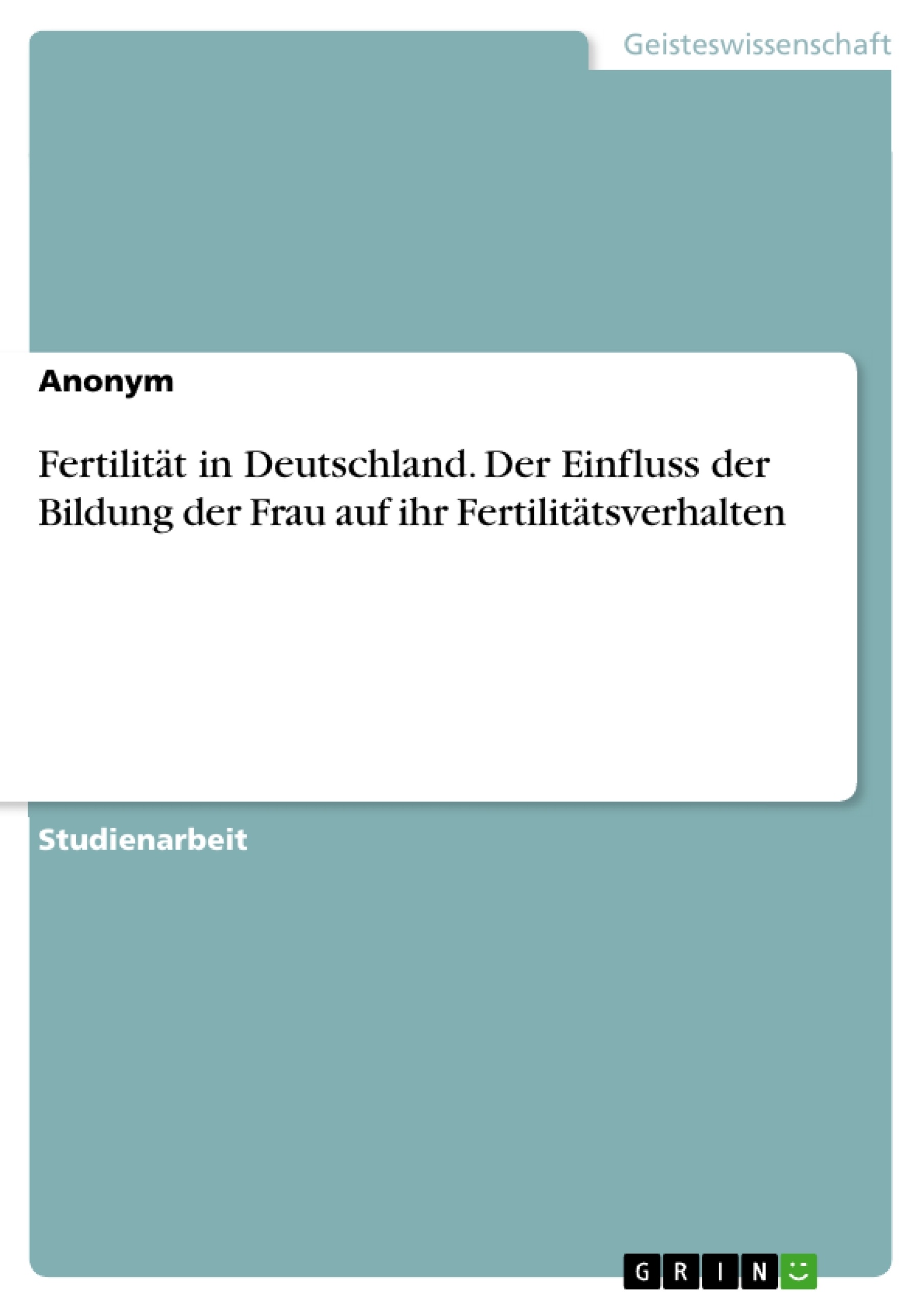Das Thema der Fertilität hat in den letzten Jahren für große Aufmerksamkeit in Deutschland gesorgt. Der Geburtenrückgang, welcher schon seit Mitte der 1960er Jahre zu verzeichnen ist, befindet sich stetig in medialen und politischen Debatten. Im Jahr 2009 sank die durchschnittliche Geburtenziffer in Deutschland mit 1,36 Kinder pro Frau auf ein Rekordtief (Pötzsch 2012). Es gibt neben der gesellschaftlichen Debatte auch eine immense Anzahl an wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die sich mit dem Thema des Geburtenrückgangs und der steigenden Kinderlosigkeit in Deutschland befassen. So hat diese Debatte nicht nur in der Soziologie, auch in der Politik, der Humangeographie und in der Ökonomie Einzug gefunden.
Doch was sind die Gründe dafür, dass insgesamt weniger Kinder geboren werden? Finanzielle Belastungen, fehlende Partner, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, steigende Individualisierung oder fehlende Kinderbetreuung? In der Forschung werden vor allem institutionelle wie auch sozio-kulturelle Gegebenheiten des Individuums als Ursachen für dieses Phänomen betont (Krätschmer-Hahn 2012). Aus sozialwissenschaftlicher Sicht scheint es vor allem wichtig, auf die Ursachen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Überlegungen und Hypothesen
- Ökonomische Theorie der Familie
- Ökonomische Theorie der Fertilität
- Fertilität und Bildungsniveau
- Wertewandel
- Herleitung der Hypothesen
- Daten
- Datensatzbeschreibung
- Verwendete Variablen und Operationalisierung
- Empirische Auswertungen
- Anzahl biologischer Kinder
- Kinderlosigkeit
- Fazit
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau von Frauen und ihrer Fertilität in Deutschland. Sie basiert auf der ökonomischen Theorie der Familie und analysiert, wie die Opportunitätskosten von Bildung und die Entwicklung von Werten die Entscheidung für oder gegen Kinder beeinflussen.
- Einfluss von Bildung und Einkommen auf die Fertilitätsentscheidung
- Opportunitätskosten von Bildung für Frauen
- Wertewandel und Individualisierung in Bezug auf Familie und Kinder
- Analyse des Zusammenhangs zwischen Bildungsniveau und Kinderlosigkeit
- Bedeutung von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Fertilitätsentscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um den Geburtenrückgang in Deutschland und stellt die Forschungsfrage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau von Frauen und ihrer Fertilität. Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, insbesondere die ökonomische Theorie der Familie und die Rolle von Opportunitätskosten. Hier werden auch die Konzepte des Humankapitals und des Wertewandels im Zusammenhang mit der Fertilitätsentscheidung betrachtet. Kapitel 3 beschreibt die Daten und die verwendeten Variablen für die empirische Analyse. Die empirischen Ergebnisse, die in Kapitel 4 vorgestellt werden, untersuchen den Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau von Frauen und der Anzahl ihrer Kinder sowie der Wahrscheinlichkeit für Kinderlosigkeit.
Schlüsselwörter
Fertilität, Bildungsniveau, Opportunitätskosten, Humankapital, Wertewandel, Individualisierung, Kinderlosigkeit, Geburtenrückgang, Deutschland, Familienökonomie.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Bildungsniveau der Frau die Kinderzahl in Deutschland?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass ein höheres Bildungsniveau aufgrund höherer Opportunitätskosten oft zu einer geringeren Kinderzahl oder Kinderlosigkeit führt.
Was sind „Opportunitätskosten“ im Kontext der Fertilität?
Dies beschreibt den Verzicht auf Einkommen und Karrierechancen, den Frauen erbringen, wenn sie sich für die Kindererziehung statt für die Erwerbstätigkeit entscheiden.
Welche Rolle spielt der Wertewandel bei der Geburtenrate?
Steigende Individualisierung und veränderte Lebensentwürfe führen dazu, dass die Familiengründung gegenüber persönlicher Selbstverwirklichung an Priorität verlieren kann.
Ist Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen häufiger?
Die empirische Auswertung der Arbeit analysiert den signifikanten Zusammenhang zwischen hohem Bildungsabschluss und der Wahrscheinlichkeit, kinderlos zu bleiben.
Was sind institutionelle Ursachen für den Geburtenrückgang?
Dazu gehören fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf im deutschen System.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Fertilität in Deutschland. Der Einfluss der Bildung der Frau auf ihr Fertilitätsverhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301939