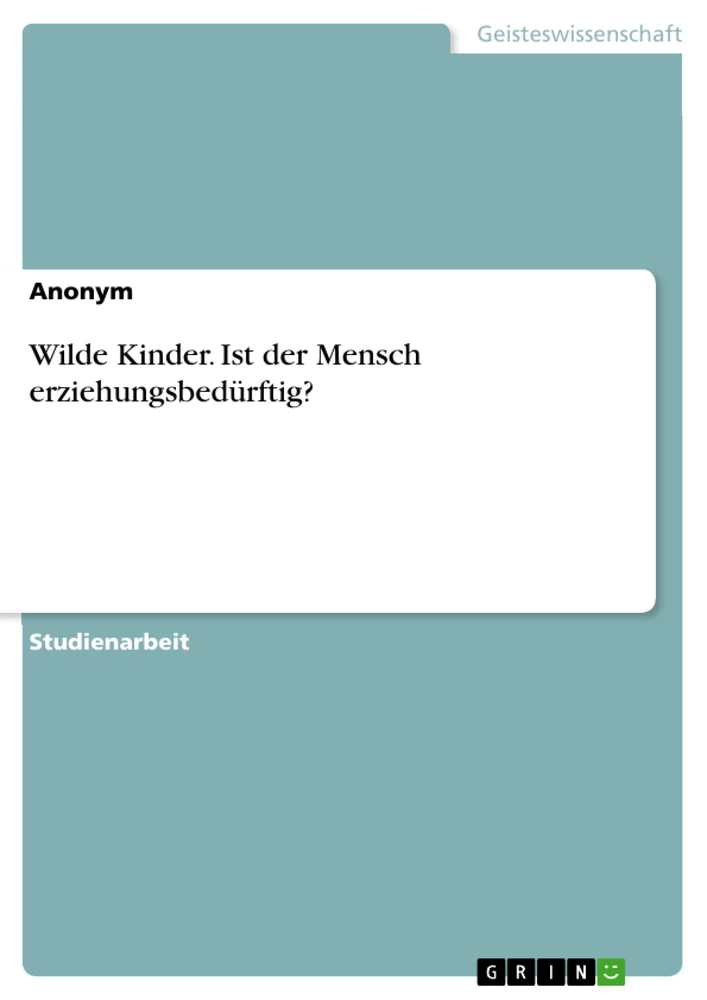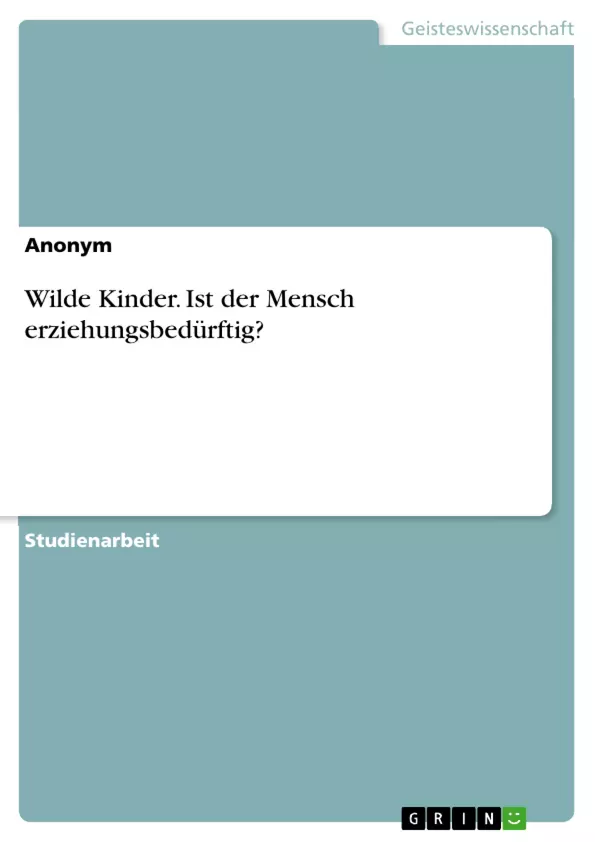Was passiert, wenn ein Mensch von Geburt an isoliert von jeglicher menschlichen Umgebung, Gesellschaft und Erziehung lebt? Wird er sich genauso entwickeln wie Menschen, die eine Erziehung genießen durften? Wird sich in ihm eine Art Naturmensch zeigen? Welche physischen und psychischen Folgen hat dieser Mensch zu tragen? Kann er sprechen? Kann er sich genauso fortbewegen wie alle anderen Menschen auch? Wird er sich in die menschliche Gesellschaft eingliedern können? Und: Kann (und muss) er überhaupt noch erzogen werden?
Diese spannenden Fragen beschäftigen die Wissenschaft bereits seit langer Zeit. Schon der ägyptische König Psammetich I. wollte beispielsweise herausfinden, ob Kinder „spontan, von sich aus eine Sprache entwickelten und welche das wäre“1, indem er sie unter Ziegen aufwachsen ließ. Glücklicherweise sind derartige Isolationsversuche in der heutigen Zeit aus ethischen Gründen nicht möglich, dennoch tauchen in der Geschichte immer wieder Fälle von sogenannten wilden Kindern auf, an denen man die fatalen Folgen eines Lebens ohne Kontakt zu Menschen, ohne Liebe und ohne Erziehung sehen kann.
Im Folgenden soll nun zunächst auf den Begriff der Erziehung und auf den Anlage-Umwelt-Konflikt eingegangen werden. Anschließend werden allgemeine Merkmale und Verhaltensweisen von wilden Kindern erläutert, um daraufhin die Fallbeispiele von Victor von Aveyron, Genie und Kaspar Hauser zu untersuchen und zu vergleichen. Basierend auf diesen theoretischen und exemplarischen Grundlagen wird dann abschließend auf die Frage eingegangen, ob der Mensch erziehungsbedürftig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der Erziehung
- Der Anlage-Umwelt-Konflikt
- Wilde Kinder
- Allgemeine Einführung und Merkmale
- Fallbeispiele
- Victor von Aveyron
- Genie
- Kaspar Hauser
- Vergleich von Victor, Genie und Kaspar
- Abschließende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Mensch erziehungsbedürftig ist. Dabei werden die Folgen eines Lebens ohne Kontakt zu Menschen, ohne Liebe und ohne Erziehung anhand von Fallbeispielen sogenannter „wilder Kinder“ untersucht.
- Der Begriff der Erziehung und seine verschiedenen Definitionen
- Die Bedeutung von Anlage und Umwelt für die Entwicklung des Menschen
- Die Auswirkungen von Deprivation auf die Entwicklung des Menschen
- Die Merkmale und Verhaltensweisen von wilden Kindern
- Die Fallbeispiele von Victor von Aveyron, Genie und Kaspar Hauser
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Erziehungsbedürftigkeit des Menschen und führt in die Thematik der wilden Kinder ein. Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff der Erziehung und seinen verschiedenen Definitionen. Kapitel 3 untersucht den Anlage-Umwelt-Konflikt und die Bedeutung beider Faktoren für die menschliche Entwicklung. Kapitel 4 widmet sich den wilden Kindern, ihren allgemeinen Merkmalen und Verhaltensweisen sowie den Fallbeispielen von Victor von Aveyron, Genie und Kaspar Hauser.
Schlüsselwörter
Erziehung, Anlage-Umwelt-Konflikt, Deprivation, wilde Kinder, Victor von Aveyron, Genie, Kaspar Hauser, Entwicklungspsychologie, Sozialpädagogik, Pädagogik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Wilde Kinder. Ist der Mensch erziehungsbedürftig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302006