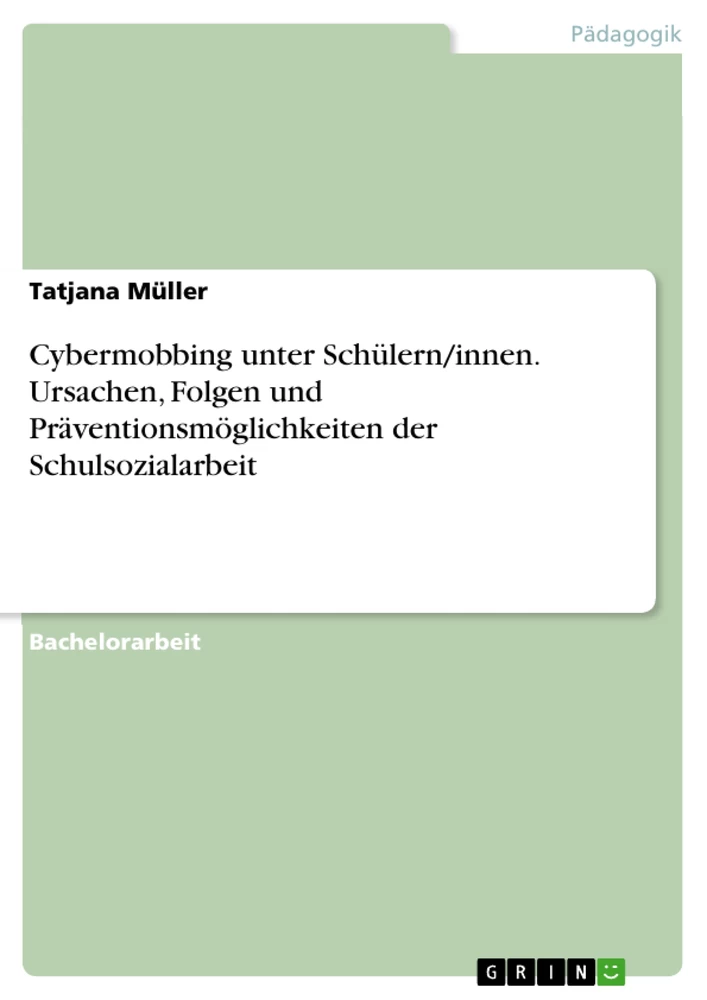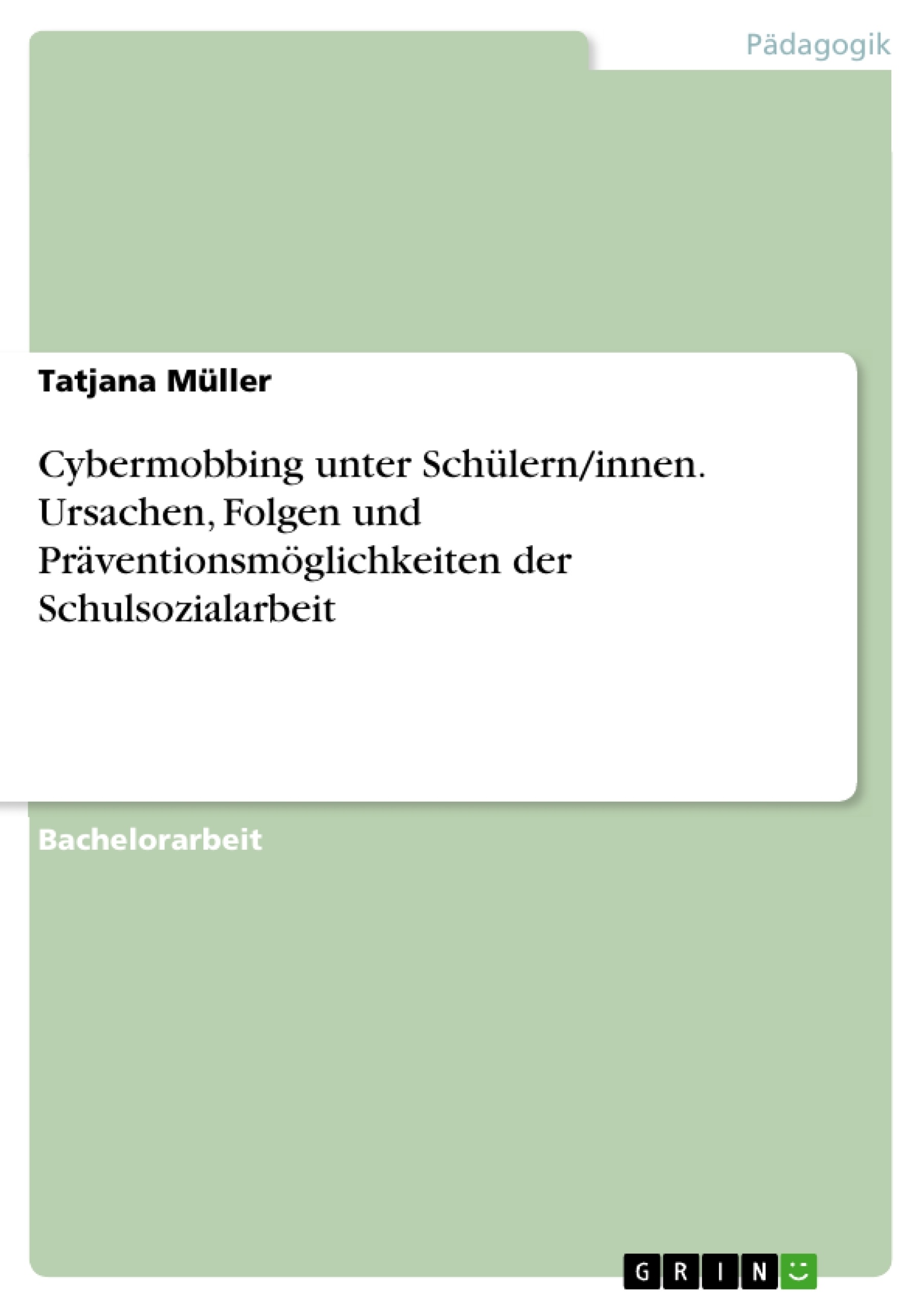„Vor zwei Wochen hat sich Amanda Todd nach jahrelangem Mobbing im Internet und in der Schule umgebracht. Ihr Video war der letzte Versuch, dem Netz Mitgefühl zu entlocken. Seit er gescheitert ist, hat der Clip auf Youtube Millionen Klicks generiert – und in Kanada eine Debatte über Cybermobbing ausgelöst.
Die Geschichte von Amanda Todd ist nicht die erste, die im Netz beginnt und dort endet. Studien belegen, dass in Deutschland jeder dritte Jugendliche schon einmal im Internet belästigt wurde. Jeder zehnte hat nach eigenen Angaben im Netz schon selbst gemobbt, jeder fünfte hält es für möglich, Täter zu werden“ (Kuntz 2012).
Dieser Ausschnitt vom 22. Oktober 2012 aus der Süddeutschen Zeitung spiegelt das immer stärker werdende Problem des Phänomens „Cybermobbing“ wider. Bei dem jungen Mädchen Amanda Todd aus Kanada fing es harmlos an, indem sie in der 7. Klasse anfing im Internet zu chatten, um neue Leute kennenzulernen. Ahnungslos über mögliche Konsequenzen schickte sie ein Foto ihres nackten Oberkörpers an einen fremden Mann. Dieser verbreitete das Foto im Netz, woraufhin es auch an Amandas damalige Schule gelangte. Ihre Mitschüler fingen an sie zu mobben, schlugen sie und filmten die Szenen. „Ich kann das Foto nie zurückholen. Es wird immer irgendwo da draußen sein“, steht auf einem der Zettel in Amandas Video. Sie wechselte mehrmals die Schule, doch dem Mobbing im Netz konnte sie nicht entkommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen „Cybermobbing“ unter Schülern/innen
- 2.1 Das soziale Netzwerk - Begriffserklärung und Bedeutung
- 2.2 Was ist „,Cybermobbing“? – Eine Annäherung
- 2.3 Formen von Cybermobbing
- 2.4 Wie häufig sind Schüler/innen von Cybermobbing betroffen?
- 2.5 Die Ursachen von Cybermobbing
- 2.6 Die Folgen von Cybermobbing – Opfer vs. Täter
- 3. Die Profession der Schulsozialarbeit
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 3.2 Rechtliche Grundlagen der Schulsozialarbeit
- 3.3 Aufgaben der Schulsozialarbeit
- 4. Prävention der Schulsozialarbeit gegen Cybermobbing
- 4.1 Zum Begriff der „Prävention“
- 4.2 Gewaltprävention und Medienerziehung in der Schule
- 4.3 Was die Schulsozialarbeit präventiv gegen Cybermobbing tun kann
- 4.3.1 Prävention auf individueller Ebene
- 4.3.2 Prävention auf Klassenebene
- 4.3.3 Prävention auf Schulebene
- 4.3.4 Zur Wirksamkeit präventiver Maßnahmen
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen Cybermobbing unter Schülern/innen. Sie untersucht die Ursachen und Folgen dieser Form von Gewalt und analysiert die Rolle der Schulsozialarbeit bei der Prävention von Cybermobbing.
- Definition und Verbreitung von Cybermobbing
- Ursachen und Folgen von Cybermobbing
- Die Profession der Schulsozialarbeit
- Präventionsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit gegen Cybermobbing
- Wirksamkeit präventiver Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Cybermobbing anhand des tragischen Falles von Amanda Todd vor und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Das zweite Kapitel beleuchtet das Phänomen Cybermobbing, definiert den Begriff des „sozialen Netzwerks“ und erörtert die Formen, Verbreitung, Ursachen und Folgen des Cybermobbings. Das dritte Kapitel widmet sich der Profession der Schulsozialarbeit, erläutert die rechtlichen Grundlagen und skizziert die Aufgaben der Schulsozialarbeit. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Präventionsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit gegen Cybermobbing. Hier werden verschiedene Handlungsebenen – individuelle, klassen- und schulebene – erläutert und die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Schulsozialarbeit, Prävention, Gewaltprävention, Medienerziehung, soziale Netzwerke, Jugendhilfe, Opfer, Täter, Folgen, Ursachen, Handlungsebenen, Wirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Cybermobbing?
Cybermobbing bezeichnet das absichtliche Beleidigen, Bedrohen oder Belästigen von Personen über digitale Medien wie soziale Netzwerke oder Messenger.
Welche Folgen hat Cybermobbing für die Opfer?
Die Folgen können von sozialem Rückzug und Angstzuständen bis hin zu Depressionen und im schlimmsten Fall Suizid reichen (wie im Fall Amanda Todd).
Wie häufig sind Schüler betroffen?
Studien belegen, dass in Deutschland bereits jeder dritte Jugendliche im Internet belästigt wurde.
Was kann die Schulsozialarbeit zur Prävention tun?
Sie kann Medienerziehung fördern, Projekte zur Gewaltprävention auf Klassenebene durchführen und individuelle Beratung für Betroffene anbieten.
Warum ist Cybermobbing gefährlicher als klassisches Mobbing?
Inhalte verbreiten sich rasend schnell, sind oft dauerhaft im Netz und das Opfer findet selbst im privaten Raum keinen Schutz vor den Angriffen.
- Quote paper
- Tatjana Müller (Author), 2014, Cybermobbing unter Schülern/innen. Ursachen, Folgen und Präventionsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302128