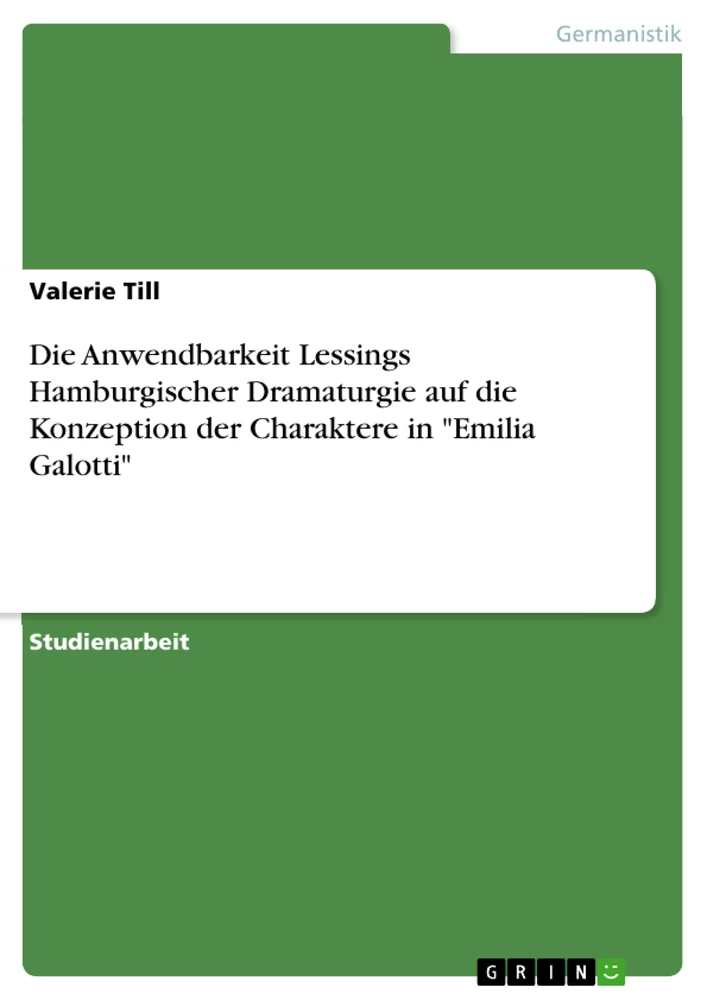Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendbarkeit der Hamburgischen Dramaturgie von Lessing auf sein wenige Jahre später verfasstes Drama "Emilia Galotti".
Zunächst werden die Aussagen der Hamburgischen Dramaturgie bezüglich der Charaktere einer Tragödie und ihrer Wirkung auf den Zuschauer vorgestellt. Anschließend wird die Umsetzung dieser Maßstäbe anhand des Dramas "Emilia Galotti" geprüft. Hierfür werden ausgewählte Figuren analysiert.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse ausgewertet und Sekundärliteratur hinsichtlich der Rezeption des Stücks hinzugezogen. Es soll versucht werden, zu klären, inwieweit sich die von Lessing hergeleiteten Grundsätze in den Charakteren des Dramas "Emilia Galotti" wiederfinden lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hamburgische Dramaturgie
- Emilia Galotti
- Emilia Galotti
- Odoardo Galotti
- Hettore Gonzaga, Prinz von Gustalla
- Marinelli
- Auswertung
- Wirkungsgeschichte
- Die Anwendbarkeit der Hamburgischen Dramaturgie
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Prinzipien Lessings' "Hamburgischer Dramaturgie" auf die Charaktere in seinem Drama "Emilia Galotti". Die Analyse konzentriert sich auf die Umsetzung Lessings' Theorien zur Erzeugung von Mitleid und Furcht im Zuschauer durch die Gestaltung der Figuren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden ausgewertet und mit der Rezeption des Stücks in der Sekundärliteratur verglichen.
- Lessings Theorie der Tragödie in der "Hamburgischen Dramaturgie"
- Die Charakterisierung der Figuren in "Emilia Galotti"
- Die Erzeugung von Mitleid und Furcht beim Zuschauer
- Die Übereinstimmung der Figuren mit Lessings Kriterien
- Rezeption von "Emilia Galotti" im Kontext der "Hamburgischen Dramaturgie"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung der Anwendbarkeit der "Hamburgischen Dramaturgie" auf die Charaktere in Lessings "Emilia Galotti". Es wird der methodische Ansatz skizziert, der die Analyse ausgewählter Figuren und die Berücksichtigung der Sekundärliteratur umfasst. Die zentrale Fragestellung ist, inwieweit sich Lessings dramaturgische Grundsätze in den Charakteren von "Emilia Galotti" widerspiegeln.
Die Hamburgische Dramaturgie: Dieses Kapitel behandelt Lessings "Hamburgische Dramaturgie" und seine Interpretation von Aristoteles' Theorie der Tragödie. Lessing betont die Erzeugung von Mitleid und Furcht als Ziel der Tragödie, wobei er "eleos" und "phobos" nicht mit Mitleid und Schrecken, sondern mit Mitleid und Furcht übersetzt. Er erläutert die Kriterien für glaubwürdige und nachvollziehbare Charaktere, die weder zu perfekt noch zu schlecht sein dürfen, um beim Zuschauer Mitleid und Furcht hervorzurufen. Die Interdependenz von Mitleid und Furcht und deren Rolle in der Katharsis wird ausführlich diskutiert. Der Begriff der Philanthropie wird im Kontext der menschlichen Sympathie eingeführt und in Relation zu Mitleid und Furcht gesetzt.
Emilia Galotti: Dieses Kapitel beinhaltet eine Analyse der Charaktere in Lessings Drama "Emilia Galotti". Es werden die einzelnen Figuren (Emilia Galotti, Odoardo Galotti, Hettore Gonzaga, Marinelli) im Hinblick auf Lessings dramaturgische Prinzipien untersucht und wird im Detail auf deren Handlungen und Motive eingegangen, um zu verstehen, wie sie Mitleid und Furcht beim Zuschauer erzeugen sollen. Hier wird geprüft, ob die Charaktere den in der "Hamburgischen Dramaturgie" aufgestellten Kriterien entsprechen.
Auswertung: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Figuren-Analyse im Kontext der Rezeption von "Emilia Galotti" und der "Hamburgischen Dramaturgie" in der Sekundärliteratur ausgewertet. Es wird überprüft, ob die Erkenntnisse der Analyse die bestehenden Interpretationen des Stückes stützen oder widerlegen. Der Fokus liegt auf der Bewertung der Anwendbarkeit Lessings' Theorien auf das konkrete Beispiel "Emilia Galotti".
Schlüsselwörter
Hamburgische Dramaturgie, Lessing, Emilia Galotti, Tragödie, Mitleid, Furcht, Katharsis, Charakteranalyse, Dramaturgie, Figurengestaltung, Rezeption, Aristoteles, Philanthropie.
Häufig gestellte Fragen zu: Emilia Galotti und die Hamburgische Dramaturgie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, wie gut die Prinzipien aus Lessings „Hamburgischer Dramaturgie“ auf die Charaktere in seinem Drama „Emilia Galotti“ angewendet werden können. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie Lessing Mitleid und Furcht beim Zuschauer durch die Figuren erzeugt und ob dies in „Emilia Galotti“ umgesetzt wurde. Die Ergebnisse werden mit der bisherigen Forschung verglichen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Lessings Theorie der Tragödie in der „Hamburgischen Dramaturgie“, die Charakterisierung der Figuren in „Emilia Galotti“ (Emilia Galotti, Odoardo Galotti, Hettore Gonzaga, Marinelli), die Erzeugung von Mitleid und Furcht beim Zuschauer, den Vergleich der Figuren mit Lessings Kriterien und die Rezeption von „Emilia Galotti“ im Kontext der „Hamburgischen Dramaturgie“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur „Hamburgischen Dramaturgie“, ein Kapitel zur Analyse der Charaktere in „Emilia Galotti“, ein Auswertungskapitel und ein Schlusswort. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und Methodik. Das Kapitel zur „Hamburgischen Dramaturgie“ erklärt Lessings Theorie der Tragödie, insbesondere die Erzeugung von Mitleid und Furcht. Das Kapitel zu „Emilia Galotti“ analysiert die Figuren im Hinblick auf Lessings Prinzipien. Das Auswertungskapitel vergleicht die Ergebnisse mit der Sekundärliteratur. Das Schlusswort fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die „Hamburgische Dramaturgie“ in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Lessings Interpretation von Aristoteles' Tragödientheorie, insbesondere Lessings Betonung von Mitleid und Furcht (eleos und phobos) als Ziel der Tragödie und seine Kriterien für glaubwürdige Charaktere. Die Interdependenz von Mitleid und Furcht und deren Rolle in der Katharsis werden diskutiert, ebenso der Begriff der Philanthropie im Kontext der menschlichen Sympathie.
Wie werden die Figuren in „Emilia Galotti“ analysiert?
Die Figuren Emilia Galotti, Odoardo Galotti, Hettore Gonzaga und Marinelli werden im Detail analysiert. Es wird untersucht, wie ihre Handlungen und Motive Mitleid und Furcht beim Zuschauer erzeugen sollen und ob sie den Kriterien der „Hamburgischen Dramaturgie“ entsprechen.
Wie werden die Ergebnisse ausgewertet?
Die Ergebnisse der Figuren-Analyse werden mit der Rezeption von „Emilia Galotti“ und der „Hamburgischen Dramaturgie“ in der Sekundärliteratur verglichen. Es wird bewertet, ob die Analyseergebnisse bestehende Interpretationen des Stücks stützen oder widerlegen und wie gut Lessings Theorien auf „Emilia Galotti“ angewendet werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hamburgische Dramaturgie, Lessing, Emilia Galotti, Tragödie, Mitleid, Furcht, Katharsis, Charakteranalyse, Dramaturgie, Figurengestaltung, Rezeption, Aristoteles, Philanthropie.
- Citar trabajo
- Valerie Till (Autor), 2015, Die Anwendbarkeit Lessings Hamburgischer Dramaturgie auf die Konzeption der Charaktere in "Emilia Galotti", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302176