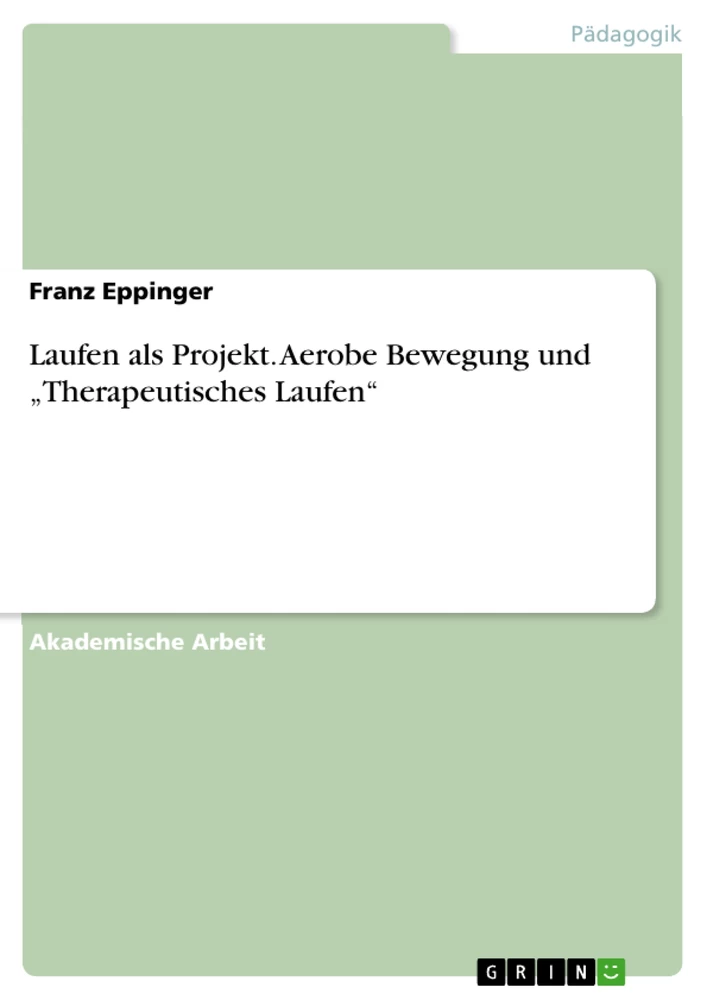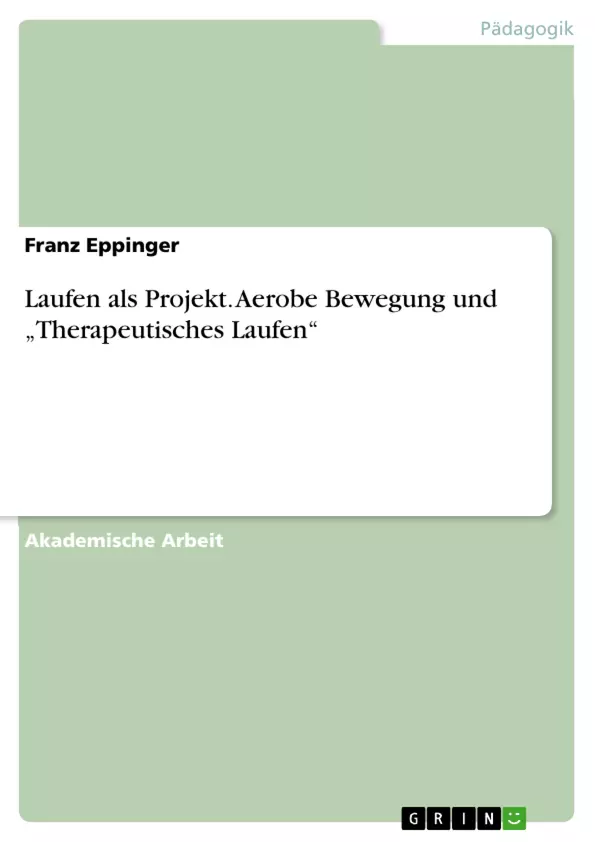Die vorliegende Arbeit beleuchtet den beliebten Sport Laufen aus therapeutischer Sicht. So soll zwischen aerober und anaerober Bewegung unterschieden und aufgezeigt werden, welche Effekte der langsame Dauerlauf auf Körper und Psyche hat.
Kann Laufen als eine Form der Therapie, als Projekt betrachtet werden?
Neben einem Standardlaufprogramm liefert diese Arbeit außerdem Informationen rund um das „Therapeutische Laufen“ und zeigt auf, dass es sich bei diesem Sport um eine unspektakuläre, kostengünstige und effektive Art der Bewegung handelt.
Die dynamische Bewegung großer Muskelgruppen wie sie beim Radfahren, Laufen, Walken, Schwimmen, Rudern, Skilanglauf usw. auftreten, setzen Adaptionsmechanismen in Gang, die aus medizinischer Sicht wegen ihrer gesundheitsfördernden Wirkung als nahezu ideal empfohlen werden.
Voraussetzung hierfür ist, dass die Energie für diese ausdauernden Bewegungsarten im Organismus „aerob“ gewonnen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Aerobe Bewegung und „Therapeutisches Laufen“
- Aerobe vs. anaerobe Bewegung
- Medizinische Forderungen an Präventionsmaßnahmen
- Effekte des langsamen Dauerlaufs
- Körperliche Wirkungen
- Einflüsse auf die Psyche
- Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften
- Ansatz des therapeutischen Laufens („Lauftherapie“)
- Exkurs: Laufen - eine Therapie?
- Implementierung des therapeutischen Laufens
- Projektmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung
- Laufen als Projekt
- Leitfaden Kurs „Therapeutisches Laufen“
- Grenzen der Planbarkeit und didaktische Kompetenz
- Laufen als Angebot auf dem Gesundheitsmarkt
- Laufen - unspektakulär, kostengünstig und effektiv
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Laufen aus therapeutischer Perspektive. Ziel ist es, die Unterschiede zwischen aerober und anaerober Bewegung zu beleuchten, die Auswirkungen langsamen Dauerlaufs auf Körper und Psyche zu analysieren und die Eignung von Laufen als Therapieform und Projekt zu bewerten. Es wird ein Standardlaufprogramm (im Anhang) vorgestellt und die Aspekte des „Therapeutischen Laufens“ hinsichtlich seiner Effektivität, Kosteneffizienz und Unkompliziertheit diskutiert.
- Unterscheidung aerober und anaerober Bewegung und deren Auswirkungen
- Die Effekte von langsamem Dauerlauf auf Körper und Psyche
- „Therapeutisches Laufen“ als Therapieansatz und Projekt
- Implementierung von „Therapeutischem Laufen“ im Kontext von betrieblicher Gesundheitsförderung
- Bewertung der Kosten-Nutzen-Relation des Laufens als gesundheitsfördernde Maßnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Aerobe Bewegung und „Therapeutisches Laufen“: Diese Einleitungsebene differenziert zwischen aerober und anaerober Bewegung, wobei der Fokus auf den positiven gesundheitlichen Effekten des aeroben Trainings liegt, insbesondere des langsamen Dauerlaufs. Es werden die physiologischen und psychologischen Auswirkungen detailliert beschrieben und der Ansatz des therapeutischen Laufens als Präventionsmaßnahme vorgestellt. Der Exkurs zur Lauftherapie eröffnet die Debatte über den Stellenwert des Laufens im therapeutischen Kontext.
Implementierung des therapeutischen Laufens: Dieses Kapitel widmet sich der praktischen Umsetzung des therapeutischen Laufens. Es behandelt Aspekte des Projektmanagements und der betrieblichen Gesundheitsförderung, entwirft einen Leitfaden für einen Kurs „Therapeutisches Laufen“ und adressiert Herausforderungen in der Planung und der didaktischen Umsetzung. Schließlich analysiert es das therapeutische Laufen als Angebot im Gesundheitsmarkt.
Laufen - unspektakulär, kostengünstig und effektiv: Dieses Kapitel fasst die Vorteile des Laufens zusammen. Es betont die Einfachheit, die geringen Kosten und die hohe Effektivität des Laufens als gesundheitsfördernde Maßnahme. Es unterstreicht den Stellenwert des Laufens als effektives und zugängliches Mittel zur Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit.
Schlüsselwörter
Aerobe Bewegung, Anaerobe Bewegung, Therapeutisches Laufen, Lauftherapie, Gesundheitsförderung, Projektmanagement, Prävention, Ausdauertraining, Körperliche und psychische Gesundheit, Kosteneffizienz.
Häufig gestellte Fragen zu "Therapeutisches Laufen"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das therapeutische Laufen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen aerober und anaerober Bewegung, den Auswirkungen des langsamen Dauerlaufs auf Körper und Psyche, sowie der Implementierung von therapeutischem Laufen als Präventionsmaßnahme und Projekt im Kontext der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Welche Arten von Bewegung werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen aerober und anaerober Bewegung. Der Schwerpunkt liegt auf den positiven gesundheitlichen Effekten des aeroben Trainings, insbesondere des langsamen Dauerlaufs.
Welche Auswirkungen hat langsames Dauerlaufen auf Körper und Psyche?
Das Dokument beschreibt detailliert die physiologischen und psychologischen Auswirkungen von langsamem Dauerlauf. Es werden sowohl körperliche Wirkungen als auch Einflüsse auf die Psyche und Veränderungen von Persönlichkeitseigenschaften beleuchtet.
Was versteht man unter „Therapeutischem Laufen“?
„Therapeutisches Laufen“ wird als Präventionsmaßnahme und Therapieansatz vorgestellt. Das Dokument untersucht seine Eignung als Therapieform und Projekt und diskutiert dessen Effektivität, Kosteneffizienz und Unkompliziertheit.
Wie kann „Therapeutisches Laufen“ implementiert werden?
Das Dokument behandelt die praktische Umsetzung von therapeutischem Laufen, inklusive Aspekte des Projektmanagements und der betrieblichen Gesundheitsförderung. Es beinhaltet einen Leitfaden für einen Kurs „Therapeutisches Laufen“ und adressiert Herausforderungen in der Planung und didaktischen Umsetzung. Die Positionierung von therapeutischem Laufen als Angebot im Gesundheitsmarkt wird ebenfalls analysiert.
Welche Vorteile bietet Laufen als gesundheitsfördernde Maßnahme?
Das Dokument betont die Einfachheit, die geringen Kosten und die hohe Effektivität des Laufens als gesundheitsfördernde Maßnahme zur Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die Schlüsselwörter umfassen: Aerobe Bewegung, Anaerobe Bewegung, Therapeutisches Laufen, Lauftherapie, Gesundheitsförderung, Projektmanagement, Prävention, Ausdauertraining, Körperliche und psychische Gesundheit, Kosteneffizienz.
Gibt es ein Standardlaufprogramm?
Das Dokument erwähnt ein Standardlaufprogramm, welches im Anhang (nicht im hier dargestellten HTML-Code enthalten) zu finden ist.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst die Kapitel: Aerobe Bewegung und „Therapeutisches Laufen“, Implementierung des therapeutischen Laufens und Laufen - unspektakulär, kostengünstig und effektiv.
- Arbeit zitieren
- Franz Eppinger (Autor:in), 2008, Laufen als Projekt. Aerobe Bewegung und „Therapeutisches Laufen“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302270