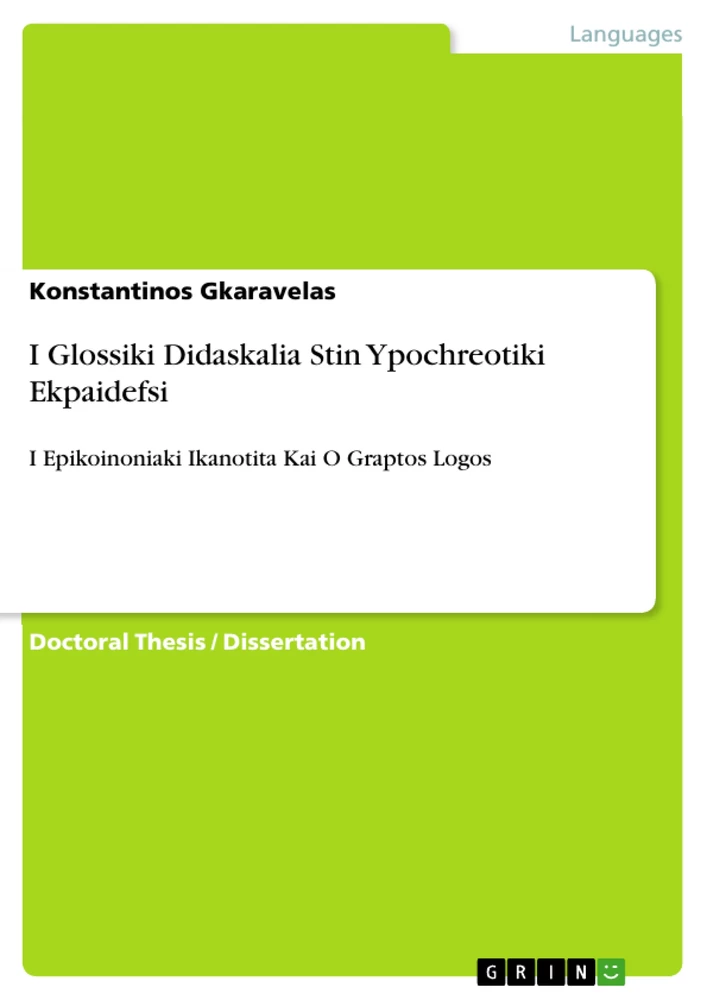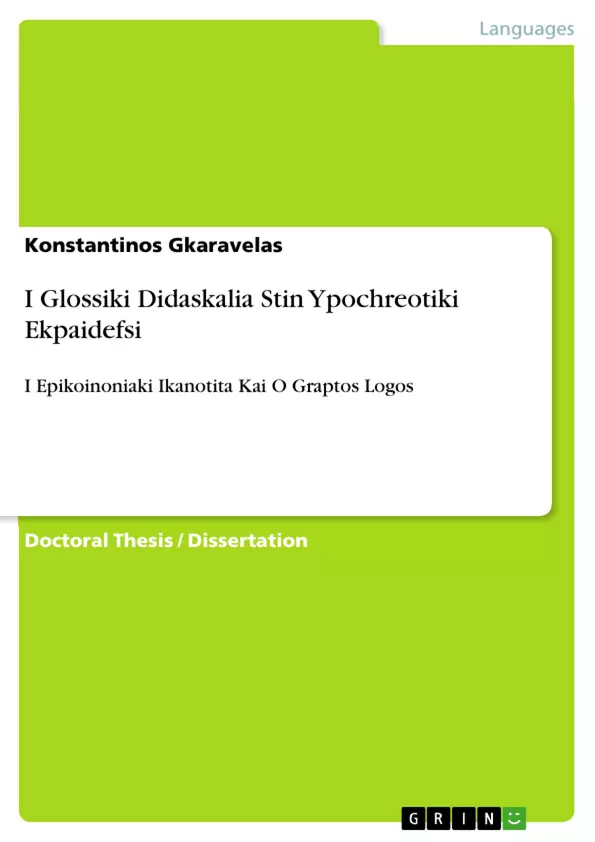In my dissertation I intend to focus on the discussion pertaining to communicative competence regarding reading competence and specific reading skills. In particular, this research investigates whether and to what extent the progress on reading competence is differentiated in relation to factors as sex, place of residence, social position and use of a language other than Greek at home. The experiment presented here took place in the scholar seasons 2004/05 and 2005/06 and examined572 pupils of the 3rd class of Greek High school. These were divided into equal numbers of participants residing in i) a Greek city of more than 1000000 residents (Thessaloniki) ii) a Greek city of about 100000 residents (Ioannina) and iii) Greek villages of 1 to 5000 residents. Data was obtained by means of a test especially designed for the purposes of this work, namely to evaluate student reading skills.
Inhaltsverzeichnis (Inhaltsverzeichnis)
- A. EINSATZ
- 1. DAS ALLGEMEINE RAHMEN DES PROBLEMS
- 2. DIE BEGRÜNDUNG DER STUDIE
- 3. DER ZWECK DER STUDIE
- 4. DIE BEDEUTUNG DER STUDIE
- 5. DIE BESCHREIBUNG DES INHALTS DER DISSERTATION
- B. DIE SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN THEORIEN UND IHRE ANWENDUNGEN IN DER DIDAKTIK
- 1. DER TRADITIONELLE ANSATZ DER SPRACHE
- 2. DER STRUKTURELLE ANSATZ DER SPRACHE
- C. DIE SPRACHE ALS SOZIALE HANDLUNG
- 1. SPRACHE UND GESELLSCHAFT
- 2. DIE SPRACHVARIANTEN
- 3. EINIGE FAKTOREN DER DIFFERENZIERUNG DER SPRACHE
- 3.1. Geschlecht und Sprache
- 3.2. Soziale Schichtung und Sprache
- 3.3. Sprache und geografische Unterschiede
- 3.4. Sprache und multikulturelle Umgebungen
- 4. GESPROCHENE SPRACHE UND KOMMUNIKATION
- 4.1. Der Begriff der Kommunikation
- 4.2. Die Wissenschaft der Ethnographie der Kommunikation
- 4.3. Die Sprachfunktionen
- 4.4. Die Sprechakte
- 4.5. Die kommunikative Kompetenz nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen:
Lernen, Lehren, Beurteilen
- 4.5.1. Die sprachliche Kompetenz
- 4.5.1.1. Die lexikalische Kompetenz
- 4.5.1.2. Die grammatische Kompetenz
- 4.5.1.3. Die semantische Kompetenz
- 4.5.1.4. Die phonologische Kompetenz
- 4.5.1.5. Die orthografische Kompetenz
- 4.5.1.6. Die orthoepische Kompetenz
- 4.5.2. Die soziolinguistische Kompetenz
- 4.5.2.1. Die sprachlichen Indikatoren sozialer Beziehungen
- 4.5.2.2. Die Höflichkeitskonventionen
- 4.5.2.3. Die Ausdrücke der Volksweisheit
- 4.5.2.4. Die Unterschiede im Stilniveau
- 4.5.2.5. Der Dialekt und der Idiom
- 4.5.3. Die pragmatischen Fähigkeiten
- 4.5.3.1. Die Fähigkeit des kontinuierlichen Sprechens
- 4.5.3.2. Die funktionale Kompetenz
- 4.5.3.3. Die Fähigkeit der Planung
- 4.5.1. Die sprachliche Kompetenz
- 4.6. Der kommunikative Ansatz im Sprachunterricht
- D. DAS VERSTEHEN SCHRIFTLICHER TEXTE
- 1. ABGRENZUNG DES BEGRIFFS TEXT IM RAHMEN DES KOMMUNIKATIVEN ANSATZES UND DER TEXTLINGUISTIK
- 1.1. Der Begriff des Textes
- 1.2. Die Arten schriftlicher Texte – Die Domänen des Sprechens
- 2. DIE SCHRIFTLICHE SPRACHE: IHRE EIGENSCHAFTEN UND IHRE UNTERSCHIEDE ZUM GESPROCHENEN
- 3. DER KOMMUNIKATIVE SPRACHPROZESS DES VERSTEHENS SCHRIFTLICHER SPRACHE
- 3.1. Der schriftliche Text – Der Kontext – Die peritextuellen Merkmale
- 3.2. Die Lesestrategien
- 3.3. Die Rezeptionsstrategien
- 3.4. Internationale Studien zur Lesekompetenz
- 3.4.1. Die Studien der Organisationen IEA und NCES
- 3.4.2. Die PISA-Studie
- 3.4.2.1. Was ist die PISA-Studie?
- 3.4.2.2. Die Lesekompetenz in der PISA-Studie
- 3.4.2.3. Die Umstände, die Texte und die Typologie der Übungen, die in der PISA-Studie verwendet wurden
- 3.4.2.4. Wie erfolgte die Bewertung?
- 3.4.2.5. Die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 für Griechenland
- 3.4.2.6. Die Ergebnisse der PISA-Studie 2003 zur Lesekompetenz
- 3.4.2.7. Die Ergebnisse der PISA-Studie 2006 zur Lesekompetenz
- 3.4.2.8. Die Unterschiede zwischen der PISA-Studie und der vorliegenden Studie
- E. DIDAKTISCHE METHODEN UND SPRACHE IN GRIECHENLAND
- 1. DER SPRACHUNTERRICHT VOR DER EINFUHRUNG DES KOMMUNIKATIVEN ANSATZES
- 2. DIE EINFUHRUNG DES KOMMUNIKATIVEN ANSATZES IN GRIECHENLAND
- 2.1. Die ersten Schritte
- 2.2. Die ersten Lehrpläne
- 2.3. Der Gemeinsame Rahmen für Lehrpläne für den Sprachunterricht im Gymnasium und im Lyzeum von 1998 und der Lehrplan für den Sprachunterricht im Gymnasium und im Lyzeum von 1999.
- 2.4. Der neue Interdisziplinäre Gemeinsame Rahmen für Lehrpläne für die Griechische Sprache für das Gymnasium
und der neue Lehrplan für die Griechische Sprache für das Gymnasium (veröffentlicht 2003)
- 2.4.1. Der neue Interdisziplinäre Gemeinsame Rahmen für Lehrpläne für die Griechische Sprache für das Gymnasium (2003)
- 2.4.2. Der neue Lehrplan für die Griechische Sprache für das Gymnasium (2003)
- 2.5. Die nicht vorhergesehenen Lernergebnisse
- F. HYPOTHESEN ZUR UNTERSUCHUNG
- G. DIE METHODOLOGIE DER FORSCHUNG
- 1. DER GEGENSTAND UND DIE FORM DER FORSCHUNG
- 2. DIE BESCHREIBUNG DER METHODOLOGIE DER FORSCHUNG
- 2.1. Die Auswahl der Stichprobe
- 2.2. Das Mittel zur Datenerhebung
- 2.2.1. Das Ziel des Mittels zur Datenerhebung
- 2.2.2. Die Konstruktion des Mittels zur Datenerhebung
- 2.2.2.1. Die Auswahl der Texte
- 2.2.2.2. Die Texte des Mittels zur Datenerhebung
- 2.2.2.3. Die Typologie der Fragen
- 2.2.2.4. Die Indikatoren der kommunikativen Kompetenz für das Verstehen schriftlicher Sprache
- 2.2.2.5. Die Leistung des Mittels zur Datenerhebung
- 2.3. Die Verarbeitung der Daten
- 2.3.1. Die soziale Stellung
- 2.3.2. Die geschlossenen Fragen
- 2.3.3. Die offenen Fragen
- H. DIE ERGEBNISSE DER FORSCHUNG
- 3.1. Die Ergebnisse der deskriptiven statistischen Verarbeitung
- 3.1.1. Die Beschreibung der Stichprobe
- 3.1.2. Die Beschreibung der Leistung der Schüler
- 3.2. Die Ergebnisse der induktiven statistischen Verarbeitung
- 3.2.1. Die Ergebnisse nach Sprachdomäne
- 3.2.1.1. Die Gesamtleistung in den Sprachdomänen
- 3.2.1.2. Die Leistung in den Sprachdomänen nach Geschlecht
- 3.2.1.3. Die Leistung in den Sprachdomänen in Abhängigkeit von der sozialen Stellung
- 3.2.1.4. Die Leistung in den Sprachdomänen in Abhängigkeit vom Wohnort
- 3.2.1.5. Die Leistung in den Sprachdomänen in Abhängigkeit von der Sprache der Kommunikation in der Familie
- 3.2.2. Die Ergebnisse nach einzelner kommunikativer Kompetenz
- 3.2.2.1. Die Gesamtleistung in den einzelnen kommunikativen Kompetenzen
- 3.2.2.2. Die Leistung in den einzelnen kommunikativen Kompetenzen in Abhängigkeit vom Geschlecht
- 3.2.2.3. Die Leistung in den einzelnen kommunikativen Kompetenzen in Abhängigkeit von der sozialen Stellung
- 3.2.2.4. Die Leistung in den einzelnen kommunikativen Kompetenzen in Abhängigkeit vom Wohnort
- 3.2.2.5. Die Leistung in Abhängigkeit von der Sprache der Kommunikation in der Familie
- 3.2.3. Die Ergebnisse in Bezug auf die Kenntnis und Anwendung der Sprache
- 3.2.3.1. Die Gesamtleistung in der Kenntnis und Anwendung der Sprache
- 3.2.3.2. Die Leistung in der Kenntnis und Anwendung der Sprache in Abhängigkeit vom Geschlecht
- 3.2.3.3. Die Leistung in der Kenntnis und Anwendung der Sprache in Abhängigkeit von der sozialen Stellung
- 3.2.3.4. Die Leistung in der Kenntnis und Anwendung der Sprache in Abhängigkeit vom Wohnort
- 3.2.3.5. Die Leistung in der Kenntnis und Anwendung der Sprache in Abhängigkeit von der Sprache der Kommunikation in der Familie
- 3.2.4. Die Ergebnisse nach Schule
- 3.2.5. Die Ergebnisse für Kinder mit Lehrereltern
- 3.2.1. Die Ergebnisse nach Sprachdomäne
- 3.3. Ein qualitativer Ansatz zu den offenen Fragen
- 4. DIE PRÜFUNG DER HYPOTHESEN
- 5. DIE DISKUSSION DER ERGEBNISSE
- 5.1. Allgemeine Bewertung
- 5.2. Leistung und Geschlecht
- 5.3. Leistung und soziale Stellung
- 5.4. Leistung und Wohnort
- 5.5. Leistung und zweisprachige Kinder
- 5.6. Sonstige Ergebnisse
- 6. VORSCHLÄGE
- 3.1. Die Ergebnisse der deskriptiven statistischen Verarbeitung
- I. LITERATUR
- J. ANHANG
Häufig gestellte Fragen
Welche Faktoren beeinflussen die Lesekompetenz griechischer Schüler?
Die Studie untersucht den Einfluss von Geschlecht, Wohnort (Großstadt vs. Dorf), sozialer Stellung und dem Gebrauch einer anderen Sprache als Griechisch im Elternhaus.
Was ist der "kommunikative Ansatz" im Sprachunterricht?
Es handelt sich um eine Methode, die Sprache als soziale Handlung begreift und die Fähigkeit zur erfolgreichen Kommunikation in verschiedenen sozialen Kontexten in den Vordergrund stellt.
Wie schneidet Griechenland in internationalen PISA-Studien ab?
Die Dissertation analysiert die Ergebnisse der PISA-Studien 2000 bis 2006 für Griechenland im Bereich Lesekompetenz und vergleicht diese mit den eigenen Forschungsergebnissen.
Was sind die Bestandteile der kommunikativen Kompetenz?
Dazu gehören laut dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen die sprachliche, soziolinguistische und pragmatische Kompetenz.
Gibt es Leistungsunterschiede zwischen Stadt- und Landkindern?
Die Untersuchung von 572 Schülern in Thessaloniki, Ioannina und Dörfern zeigt signifikante Differenzen in der Lesekompetenz je nach geografischem Wohnort.
- 1. ABGRENZUNG DES BEGRIFFS TEXT IM RAHMEN DES KOMMUNIKATIVEN ANSATZES UND DER TEXTLINGUISTIK
- Quote paper
- Konstantinos Gkaravelas (Author), 2010, I Glossiki Didaskalia Stin Ypochreotiki Ekpaidefsi, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302301