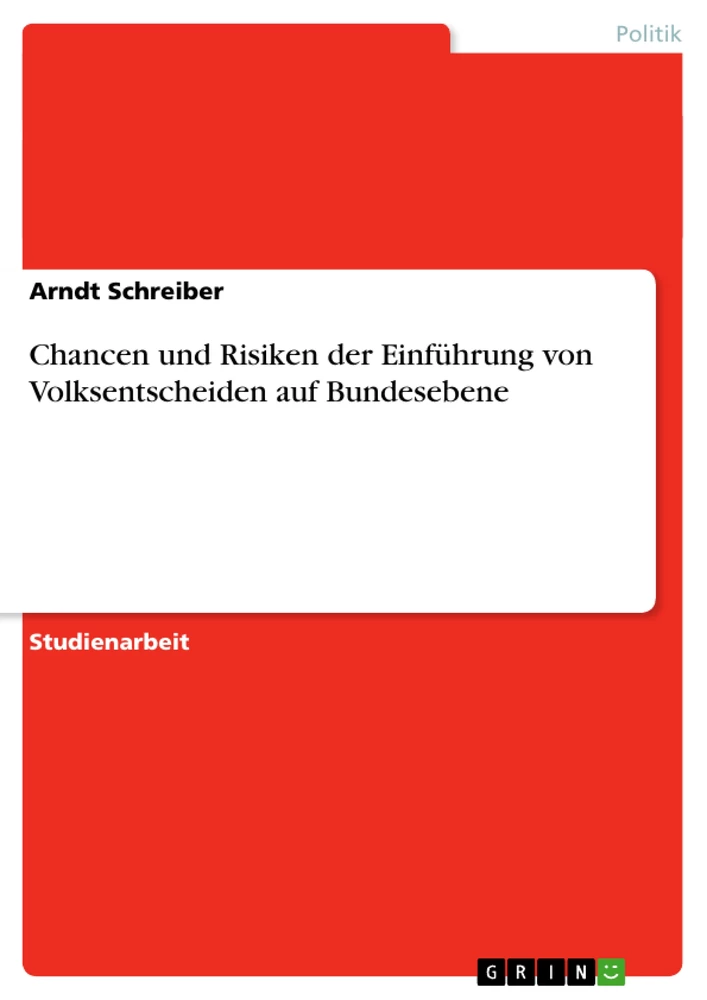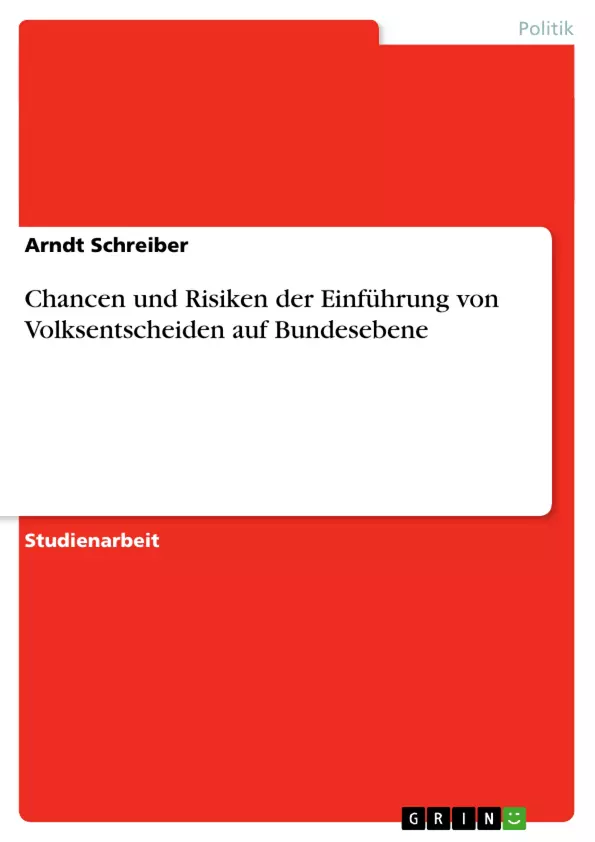Mit der ab etwa 1970 vor allem durch das stark verbesserte Bildungs- und Informationsangebot, die schnelle Erosion alter Sozialbindungen, den wachsenden Wohlstand sowie die zunehmende Mobilität eingeleiteten „individualistischen Wende“ erwachte in vielen Bundesbürgern auch der Wunsch nach mehr politischer Partizipation. Während die deshalb im Februar 1973 vom Bundestag ins Leben gerufene Enquete-Kommission „Verfassungsreform“ in ihrem Schlussbericht vom 2. Dezember 1976 noch eindringlich vor einer Aufnahme der Volksgesetzgebung ins Grundgesetz warnte, weil sie hiervon eine irreversible Schwächung der repräsentativen Demokratie befürchtete , votierte die nach der deutschen Einheit eingesetzte „Gemeinsame Verfassungskommission“ Anfang 1993 bereits mehrheitlich für die Möglichkeit von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden im Bundesstaat. Zwar scheiterten die entsprechenden Anträge am 30. Juni erwartungsgemäß an der für Grundgesetzänderungen im Parlament erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit. In den Verfassungen der meisten Bundesländer trat die direkte Demokratie nach 1990 jedoch geradezu einen sicherlich nicht zuletzt durch die basisdemokratische Revolution in der DDR („Wir sind das Volk“) begünstigten Siegeszug an. Gleichzeitig sprachen sich in Umfragen neben den Bürgern nun auch immer größere Teile der Politikeliten6 für Volksabstimmungen auf Bundesebene aus. Vor diesem Hintergrund legte die im Jahr 1998 ins Amt gewählte Bundesregierung aus SPD und B’90/Grüne dem Deutschen Bundestag am 13. März 2002 erneut einen Gesetzentwurf vor, welcher die Erweiterung des Grundgesetzartikels 82 um ein dreistufiges Volksgesetzgebungsverfahren (Volksinitiative – Volksbegehren – Volksentscheid) vorsah, aber wiederum die dazu notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der Parlamentarier verfehlte.
Der Streit über das Für und Wider von Volksentscheiden im Bund hält indessen an. Um eine angemessene Gewichtung der einzelnen Wortmeldungen bemüht sich jedoch nicht allein die politische Debatte. Auch die Sozialwissenschaften schenken diesem Problem seit etwa 1989/90 verstärkt Beachtung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwei unterschiedliche Demokratiekonzepte
- Einfallstor für Demagogen ?
- Volksgesetzgebung in der Weimarer Republik
- Das antiplebiszitäre Votum des Parlamentarischen Rates 1948/49
- Zur Aktualität der „Weimarer Erfahrungen”
- Inkompetente Stimmbürger?
- Übermacht finanzkräftiger Interessen?
- Tyrannei der Mehrheit oder Dominanz aktiver Minderheiten?
- Volksentscheid und Minderheitenrechte
- Das Problem der Beteiligung
- Aushöhlung der repräsentativen Demokratie ?
- Schluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit analysiert die Argumente gegen die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene in Deutschland. Die Arbeit beleuchtet die potenziellen Gefahren und Risiken, die mit der direkten Demokratie verbunden sind, und untersucht, inwiefern die direkte Demokratie den Bestand der repräsentativen Demokratie in Deutschland gefährden könnte.
- Bewertung der Risiken direktdemokratischer Verfahren im Kontext der Weimarer Republik
- Analyse der Sachkompetenz von Bürgern im Hinblick auf komplexe Gesetzesvorlagen
- Untersuchung des Einflusses finanzstarker Interessengruppen auf Volksentscheidungen
- Diskussion der Auswirkungen von Volksentscheiden auf Minderheitenrechte und die Beteiligung von Bürgern
- Bewertung der Integrierbarkeit direktdemokratischer Partizipation in das parlamentarische Regierungssystem Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der direkten Demokratie in Deutschland ein und erläutert die Hintergründe für die aktuelle Debatte über die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Kapitel 1 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der direkten Demokratie im Vergleich zur repräsentativen Demokratie und stellt die Kontroverse um die Vermittlung des Prinzips der Volkssouveränität im politischen Prozess dar.
Kapitel 2 analysiert die Rolle der Volksgesetzgebung im Kontext der Weimarer Republik. Es untersucht die Ursachen für den Niedergang der Republik und die daraus resultierenden antiplebiszitären Verfassungsbestimmungen des Parlamentarischen Rates. Kapitel 3 und 4 setzen sich kritisch mit der Sachkompetenz von Bürgern bei komplexen Gesetzesvorlagen und dem möglichen Einfluss finanzstarker Interessengruppen auf Volksentscheidungen auseinander.
Kapitel 5 untersucht, inwiefern Volksentscheidungen Minderheitenrechte einschränken und die Beteiligung von Bürgern beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Seminararbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen der direkten Demokratie in Deutschland, insbesondere die potenziellen Gefahren von Volksentscheiden für die Repräsentative Demokratie. Zentrale Begriffe sind: Volksgesetzgebung, Weimarer Republik, Parlamentarischer Rat, Demagogie, Sachkompetenz, finanzstarke Interessengruppen, Minderheitenrechte, politische Partizipation, repräsentative Demokratie, direkte Demokratie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Risiken werden bei Volksentscheiden auf Bundesebene diskutiert?
Diskutiert werden Gefahren wie Demagogie, die Tyrannei der Mehrheit, die Übermacht finanzkräftiger Interessen und die mögliche Aushöhlung der repräsentativen Demokratie.
Welche Erfahrungen aus der Weimarer Republik spielen eine Rolle?
Die negativen Erfahrungen mit der Volksgesetzgebung in der Weimarer Republik führten zu einer antiplebiszitären Haltung des Parlamentarischen Rates bei der Erstellung des Grundgesetzes 1948/49.
Sind Stimmbürger kompetent genug für komplexe Gesetze?
Ein zentraler Kritikpunkt ist die Frage, ob Bürger über die notwendige Sachkompetenz verfügen, um über hochkomplexe politische und rechtliche Vorlagen abzustimmen.
Wie beeinflussen finanzstarke Gruppen Volksentscheide?
Es besteht die Sorge, dass finanzkräftige Interessengruppen durch massive Kampagnen das Abstimmungsverhalten stärker beeinflussen können als in einem rein parlamentarischen System.
Was ist der Unterschied zwischen Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid?
Es handelt sich um ein dreistufiges Verfahren der direkten Demokratie, das in vielen Bundesländern bereits existiert, auf Bundesebene jedoch bisher an der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit scheiterte.
- Citar trabajo
- Arndt Schreiber (Autor), 2004, Chancen und Risiken der Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30234