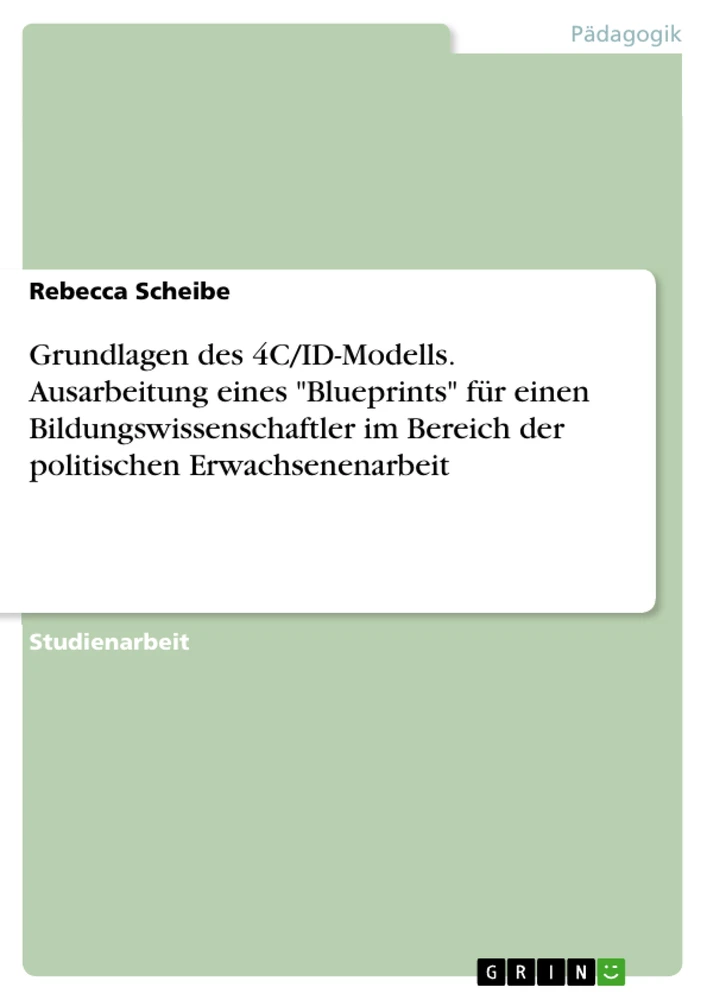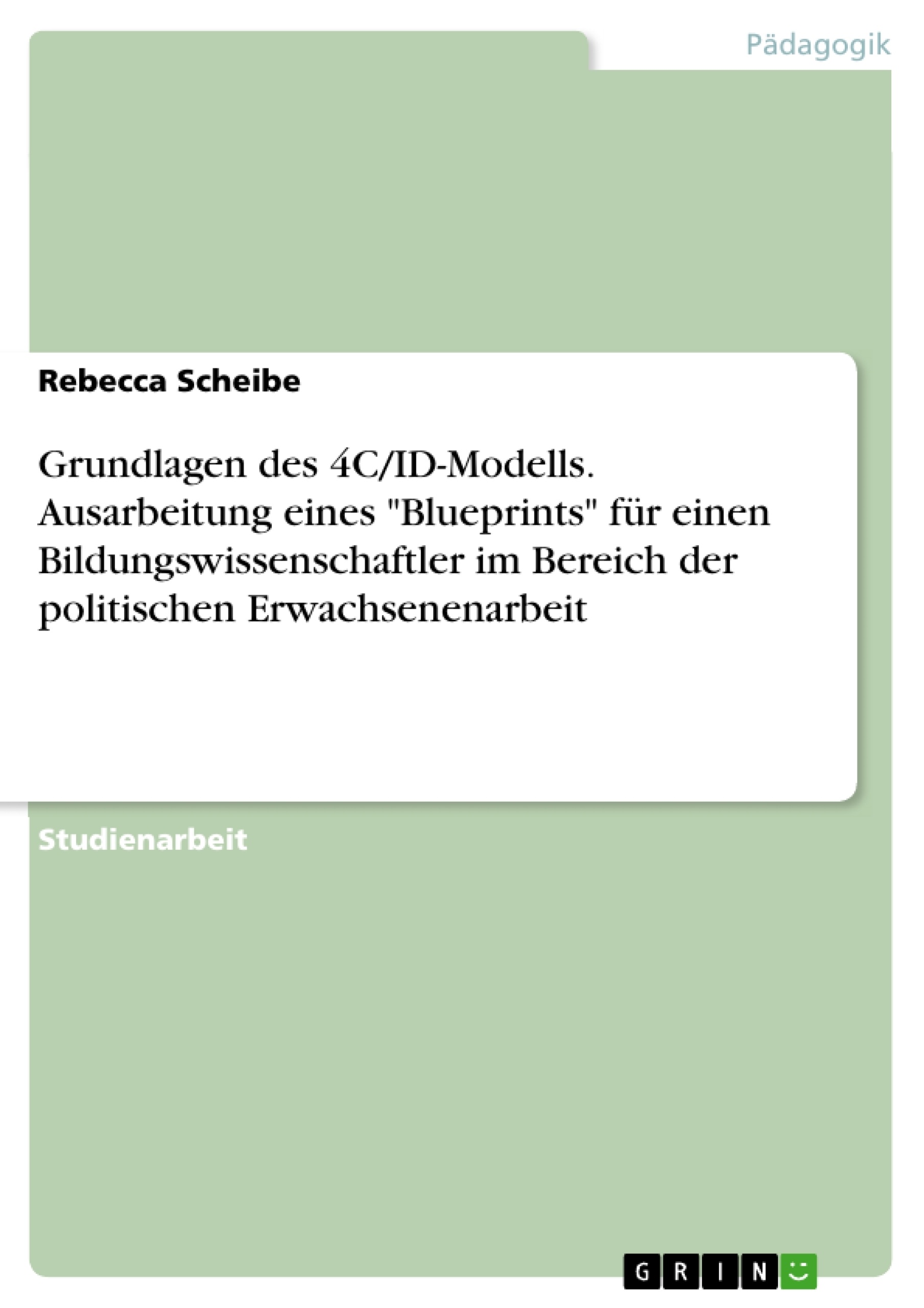Die Hausarbeit behandelt die Grundlagen des 4C/ID-Modells exemplarisch an einem Bildungswissenschaftler im Bereich der politischen Erwachsenenarbeit und beschäftigt sich zudem mit den lerntheoretischen Überlegungen und Aspekten des situierten Lernens.
In einem Zeitalter, in dem kontinuierliches, lebenslanges Lernen immer mehr an Priorität gewinnt, einer „Existenznotwendigkeit“ (Lehr, 2000) gleichkommt, werden auch Trainingsprogramme zur optimalen Kompetenzschulung erforderlicher denn je. Eines davon ist das in den 1990er Jahren von Jeroen G. van Merriënboer entwickelte Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID-Modell), welches komplexes Lernen innerhalb von authentischen Lernumgebungen und individueller Fähigkeit entsprechend fördert (Bastiaens, Deimann, Scharder, Orth, 2012, S. 90).
Der Schwerpunkt in dieser Hausarbeit liegt in der Ausarbeitung eines Blueprints - anhand des oben genannten Modells - für einen Bildungswissenschaftler im Bereich der politischen Erwachsenenarbeit, der sich einem Training zur Durchführung eines Workshops zum Thema Globalisierung unterzieht. Im Anschluss an die Darstellung der praktischen Anwendung des Modells folgen theoretische Überlegungen zu situiertem Lernen, didaktischen Szenarien und der Anwendung unterschiedlicher Medien, ehe die Arbeit mit einem Résumé schließt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des 4C/ID Modell exemplarisch an einem Biwi im Bereich der politischen Erwachsenenarbeit
- Hierarchisierung zur Kompetenzanalyse
- Sequentialisierung der Aufgabenklassen
- Entwurf von Lernaufgaben
- Unterstützende Informationen
- Just-in-time Informationen
- Theoretische Überlegungen zum 4C/ID Modell
- Lerntheoretische Überlegungen und Aspekte des situierten Lernens
- Behaviorismus
- Kognitivismus
- Konstruktivismus
- Situiertes Lernen
- Didaktische Szenarien zur Integration in das 4C/ID Modell
- Geeignete Medien zur Unterstützung des Blueprints
- Lerntheoretische Überlegungen und Aspekte des situierten Lernens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Anwendung des Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modells (4C/ID-Modell) auf ein Trainingsprogramm für Bildungswissenschaftler im Bereich der politischen Erwachsenenarbeit. Das Modell soll zur optimalen Kompetenzschulung im Bereich der Workshop-Durchführung zum Thema Globalisierung beitragen. Die Arbeit untersucht dabei die praktische Anwendung des Modells, beleuchtet theoretische Überlegungen zu situiertem Lernen und geeigneten Medien sowie didaktischen Szenarien, die zur Integration in das 4C/ID-Modell eingesetzt werden können.
- Anwendung des 4C/ID-Modells im Kontext der politischen Erwachsenenarbeit
- Analyse und Hierarchisierung von Kompetenzen im Hinblick auf die Workshop-Durchführung
- Theoretische Grundlagen des 4C/ID-Modells im Kontext von Lerntheorien und situiertem Lernen
- Einsatz geeigneter Medien und didaktischer Szenarien zur Unterstützung des Kompetenztrainings
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert die Bedeutung des 4C/ID-Modells für die Kompetenzschulung im Bereich der politischen Erwachsenenarbeit.
- Grundlagen des 4C/ID-Modells: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und Funktionsweise des 4C/ID-Modells, wobei die vier Komponenten Lernaufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time-Informationen und Part-Task-Practice detailliert erläutert werden. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung des Modells im Kontext der Workshop-Durchführung zum Thema Globalisierung.
- Theoretische Überlegungen zum 4C/ID-Modell: In diesem Kapitel werden die lerntheoretischen Grundlagen des 4C/ID-Modells analysiert. Dabei werden verschiedene Lerntheorien wie Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus und Situiertes Lernen betrachtet, um die theoretische Fundierung des Modells zu beleuchten. Zusätzlich werden geeignete Medien und didaktische Szenarien vorgestellt, die sich zur Integration in das 4C/ID-Modell eignen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID-Modell), Kompetenzentwicklung, situiertem Lernen, politischen Erwachsenenarbeit, Workshop-Durchführung, Globalisierung, Medien und Didaktik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 4C/ID-Modell?
Das Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID) wurde von Jeroen van Merriënboer entwickelt, um komplexes Lernen in authentischen Umgebungen zu fördern.
Welche vier Komponenten umfasst das Modell?
Die Komponenten sind: Lernaufgaben (Learning Tasks), unterstützende Informationen (Supportive Information), Just-in-time-Informationen und Part-Task-Practice.
Wie wird das Modell in der politischen Erwachsenenbildung angewendet?
Die Arbeit zeigt die Anwendung beispielhaft für das Training eines Bildungswissenschaftlers zur Durchführung eines Workshops zum Thema Globalisierung.
Was ist ein "Blueprint" im Kontext des 4C/ID-Modells?
Ein Blueprint ist ein detaillierter Entwurf des Trainingsprogramms, der die Hierarchisierung von Kompetenzen und die Abfolge der Lernaufgaben festlegt.
Welche Lerntheorien liegen dem Modell zugrunde?
Das Modell integriert Aspekte des Kognitivismus und Konstruktivismus, insbesondere das Konzept des situierten Lernens.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2012, Grundlagen des 4C/ID-Modells. Ausarbeitung eines "Blueprints" für einen Bildungswissenschaftler im Bereich der politischen Erwachsenenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302443