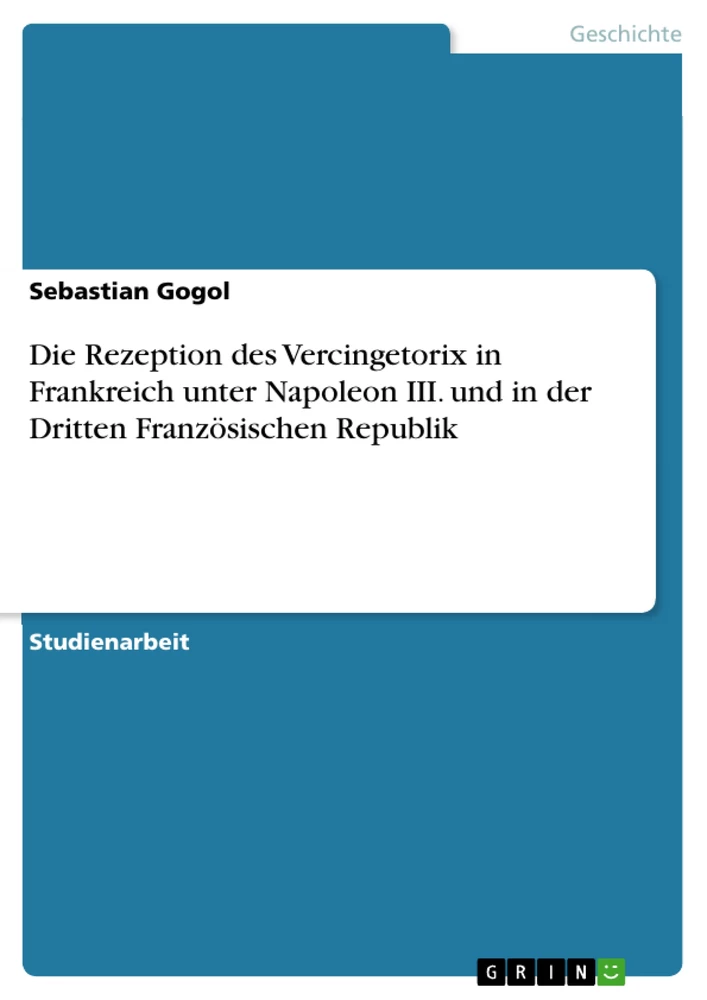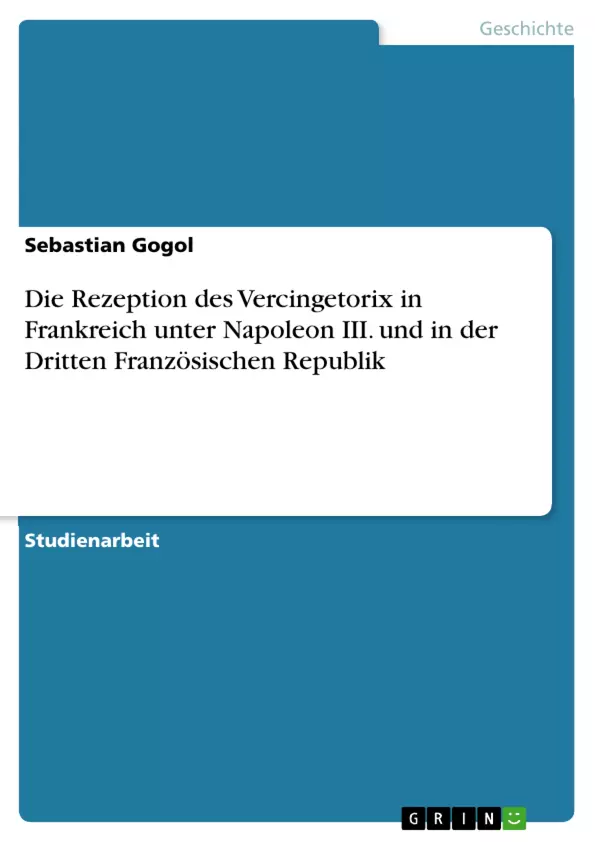Ziel dieser Arbeit ist es, die Rezeption des Vercingetorix im Frankreich unter Kaiser Napoleon III. sowie in der Dritten Französischen Republik zu untersuchen. Weiterhin steht hier nicht die Aufarbeitung aller historischen Ereignisse, welche mit Vercingetorix verbunden sind, im Vordergrund, sondern die Rezeption eines antiken Herrschers.
Im Zweiten Punkt der Arbeit wird der Vercingetorix in den antiken Quellen behandelt, wobei hier das Werk Caesars über den Gallischen Krieg eine bedeutende Rolle einnehmen wird. Ferner sind noch das Werk von Florus, Diodorus Siculus und Plutarch für die Deutung des Vercingetorix und der Gallier bedeutsam.
Die Rezeption des Vercingetorix soll im dritten Punkt Gegenstand der Untersuchung werden. Der Zeitraum, der hier behandelt wird, ist zum einen die Regierungszeit Napoleons III. als Kaiser der Franzosen (1852 – 1870) sowie zum anderen die Phase der Dritten Französischen Republik (1871 – 1940). Beachtenswert für diesen Zeitraum ist, dass die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als Epoche der Nationalstaaten bezeichnet wird, was im Hinblick auf die Rezeptionsgeschichte wichtig wird.
Zwei zentrale Thesen werden gestellt, die dieser Arbeit zugrunde liegen. Die erste These beinhaltet, dass sich der Vercingetorixmythos in Frankreich unter Napoleon III. und in der Dritten Französischen Republik als Nationalsymbol nicht durchsetzen konnte. Aufbauend auf der ersten These ergibt sich die zweite Annahme: Die Auseinandersetzung mit dem Mythos des Arvernerfürsten zeigte die politischen Probleme Frankreichs auf, vor allem in der Dritten Französischen Republik.
Im nächsten Punkt rückt zunächst der antike Vercingetorix in den Vordergrund, der anhand der Quellen von Caesar, Florus, Diodorus Siculus und Plutarch erarbeitet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. VERCINGETORIX IN DEN ANTIKEN QUELLEN
- 2.1 Gaius Julius Caesar – „De Bello Gallico”
- 2.2 Florus -,,Römische Geschichte“
- 2.3 Diodorus Siculus – „Bibliotheca historica”
- 2.4 Plutarch,„,Caesar”
- 3. DIE REZEPTION DES VERCINGETORIX
- 3.1 Napoleon III. und das Denkmal in Alesia
- 3.2 Vercingetorix in der Dritten Französischen Republik
- 4. ZUSAMMENFASSUNG: VERCINGETORIX – EIN NATIONALHELD FRANKREICHS?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption des Vercingetorix in Frankreich unter Napoleon III. und in der Dritten Französischen Republik. Der Fokus liegt nicht auf der vollständigen Aufarbeitung der historischen Ereignisse um Vercingetorix, sondern auf der Interpretation und Verwendung seiner Figur in unterschiedlichen politischen Kontexten. Die Arbeit analysiert die Darstellung Vercingetorix' in antiken Quellen und beleuchtet die Bedeutung von Denkmälern für die Konstruktion seines Mythos.
- Die Darstellung des Vercingetorix in antiken Quellen (Caesar, Florus, Diodorus Siculus, Plutarch)
- Die Instrumentalisierung des Vercingetorix-Mythos unter Napoleon III.
- Die Rezeption Vercingetorix' in der Dritten Französischen Republik und seine Bedeutung für nationale Identität
- Die Rolle von Denkmälern in der Konstruktion des Vercingetorix-Mythos
- Die politische Bedeutung des Vercingetorix-Mythos und seine Widerspiegelung der politischen Herausforderungen Frankreichs
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Rezeption des Vercingetorix in Frankreich während der Herrschaft Napoleons III. und in der Dritten Republik zu untersuchen. Sie betont den Fokus auf die Rezeption als antiker Herrscher, nicht auf die umfassende historische Aufarbeitung der Ereignisse um ihn. Die Einleitung erwähnt wichtige Forschungsarbeiten zum Thema und führt die zentralen Thesen der Arbeit ein: Der Vercingetorix-Mythos konnte sich nicht als nationales Symbol etablieren, und seine Auseinandersetzung spiegelte die politischen Probleme Frankreichs wider.
2. VERCINGETORIX IN DEN ANTIKEN QUELLEN: Dieses Kapitel bietet einen kurzen historischen Überblick über das Leben Vercingetorix' und seine Rolle im gallischen Aufstand gegen Caesar. Es analysiert die Darstellungen Vercingetorix' in den Werken von Caesar, Florus, Diodorus Siculus und Plutarch, wobei besonderes Augenmerk auf Caesars "De Bello Gallico" gelegt wird. Die unterschiedlichen Perspektiven und Charakterisierungen Vercingetorix' in diesen Quellen werden verglichen und im Hinblick auf seine spätere Rezeption in Frankreich diskutiert. Die Kapitel beschreibt Caesars Darstellung Vercingetorix' als fähigen, aber auch brutalen Anführer, der die gallischen Stämme durch verschiedene Mittel, darunter auch Zwang, vereinte. Die Kapitulation Vercingetorix' und dessen Begründung für den Krieg gegen Caesar werden ebenfalls detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Vercingetorix, Napoleon III., Dritte Französische Republik, Antike Quellen, Rezeptionsgeschichte, Nationalmythos, Nationalidentität, Denkmäler, Geschichtspolitik, Gallischer Krieg, Caesar, Mythenbildung, politische Symbolik.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über Vercingetorix
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rezeption der Figur Vercingetorix in Frankreich, insbesondere unter Napoleon III. und in der Dritten Französischen Republik. Der Fokus liegt dabei auf der Interpretation und Verwendung seiner Figur in unterschiedlichen politischen Kontexten, nicht auf einer vollständigen historischen Aufarbeitung seines Lebens.
Welche Quellen werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit analysiert die Darstellung Vercingetorix in antiken Quellen wie Caesar's „De Bello Gallico“, Florus' „Römische Geschichte“, Diodorus Siculus' „Bibliotheca historica“ und Plutarchs „Caesar“. Sie berücksichtigt zudem die Bedeutung von Denkmälern für die Konstruktion seines Mythos in Frankreich.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung Vercingetorix in antiken Quellen, seiner Instrumentalisierung unter Napoleon III., seiner Rezeption in der Dritten Französischen Republik und seiner Bedeutung für die nationale Identität. Die Rolle von Denkmälern in der Mythenbildung um Vercingetorix und die politische Symbolik seiner Figur werden ebenfalls untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Vercingetorix in den antiken Quellen, ein Kapitel über seine Rezeption in Frankreich (Napoleon III. und Dritte Republik) und eine Zusammenfassung. Das Inhaltsverzeichnis gibt einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Vercingetorix-Mythos sich nicht vollständig als nationales Symbol etablieren konnte, und seine Auseinandersetzung die politischen Herausforderungen Frankreichs widerspiegelte. Die Einleitung deutet auf diese zentrale These hin.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vercingetorix, Napoleon III., Dritte Französische Republik, Antike Quellen, Rezeptionsgeschichte, Nationalmythos, Nationalidentität, Denkmäler, Geschichtspolitik, Gallischer Krieg, Caesar, Mythenbildung, politische Symbolik.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit bietet Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und die zentralen Thesen. Das Kapitel über Vercingetorix in den antiken Quellen analysiert die unterschiedlichen Darstellungen in den Werken von Caesar, Florus, Diodorus Siculus und Plutarch.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Gogol (Autor:in), 2014, Die Rezeption des Vercingetorix in Frankreich unter Napoleon III. und in der Dritten Französischen Republik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302470