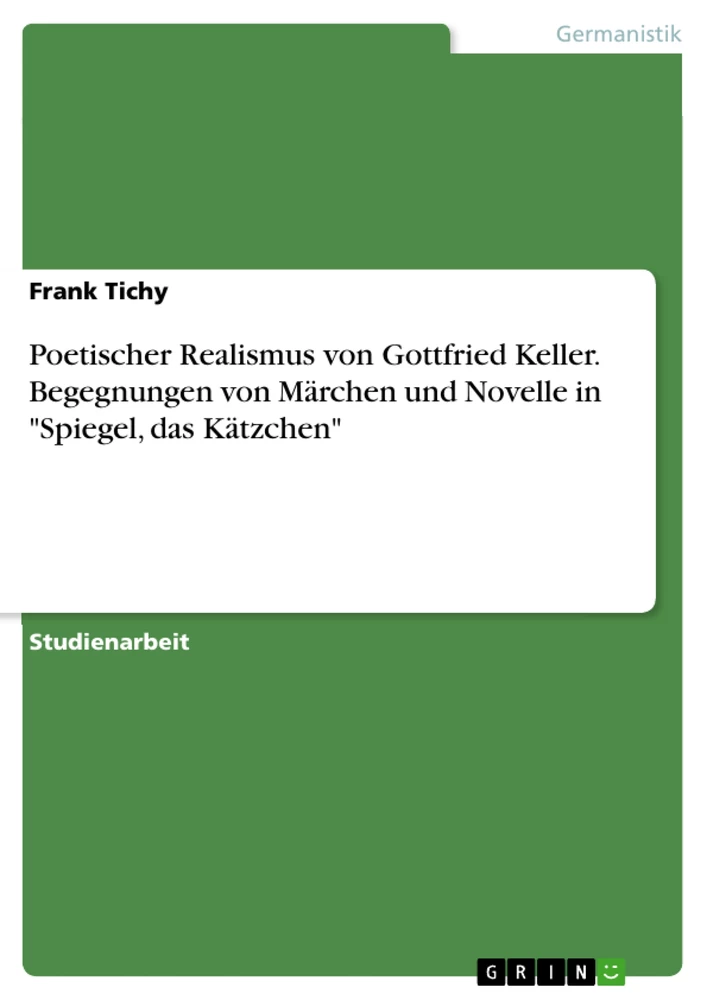Gegenstand dieser Hausarbeit soll die Frage sein, inwieweit durch Begegnungen der Gattungen Märchen und Novelle in und durch Kellers 1856 publizierter Prosa "Spiegel, das Kätzchen" eine konzise künstlerische Umsetzung des poetischen Realismus zu folgern ist. Für dieses Vorhaben ist eine vorangestellte Klärung der Begriffe Märchen, Novelle des 19. Jahrhunderts und poetischer Realismus als Grundlage unabdingbar.
Die Motivation zu diesem Thema ergibt sich aus der augenfälligen Diskrepanz eines besonderen Stellenwerts des Märchens innerhalb des Zyklus "Die Leute von Seldwyla" sowie für Keller und eines merkwürdig geringen Niederschlags in der Literaturwissenschaft. Letzteres mag am befremdlich erscheinenden Widerspruch zwischen der schnell assoziierten Nähe der Gattung "Märchen" zur Romantik und Kellers programmatischen Anspruch eines poetischen Realismus liegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffe
- 2.1 Märchen
- 2.2 Novelle des 19. Jahrhunderts
- 2.3 Poetischer Realismus
- 3 Gottfried Kellers poetischer Realismus aus Begegnungen von Märchen und Novelle in und durch Spiegel, das Kätzchen
- 3.1 Novellen: Die Leute von Seldwyla, Last und Muster
- 3.2 Märchen: Spiegel, das Kätzchen, diminuiertes Wesen hinter Funktion
- 3.3 Novelle im Märchen: Spiegel, Fiktionskünstler und -kunst
- 3.4 Märchen im Zyklus: Spiegel, schöpfend und reproduzierend
- 4 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, inwieweit die Begegnung der Gattungen Märchen und Novelle in Gottfried Kellers "Spiegel, das Kätzchen" (1856) zu einer künstlerischen Umsetzung des poetischen Realismus führt. Die Arbeit klärt zunächst die Begriffe Märchen, Novelle des 19. Jahrhunderts und poetischer Realismus. Die Analyse konzentriert sich auf den Stellenwert des Märchens im Zyklus "Die Leute von Seldwyla" und dessen Verhältnis zu Kellers poetischem Realismus.
- Der poetische Realismus bei Gottfried Keller
- Das Verhältnis von Märchen und Novelle in Kellers Werk
- Die Rolle von "Spiegel, das Kätzchen" im Zyklus "Die Leute von Seldwyla"
- Analyse der Erzählstruktur und des Erzählstils in "Spiegel, das Kätzchen"
- Die Integration des Märchenhaften in die realistische Darstellung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage nach dem Beitrag der Begegnung von Märchen und Novelle in Kellers "Spiegel, das Kätzchen" zum poetischen Realismus. Sie benennt die Diskrepanz zwischen dem Stellenwert des Märchens in "Die Leute von Seldwyla" und der geringen wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit. Die Einleitung thematisiert den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Märchenhaften und Kellers poetischem Realismus und verweist auf Interpretationsansätze, die das Märchenhafte als Verstärker des Wirklichen verstehen. Sie skizziert den Forschungsweg der Arbeit, der über die Analyse des novellistischen Charakters in "Die Leute von Seldwyla", die Einordnung von "Spiegel, das Kätzchen" und die Untersuchung des Verhältnisses von Rahmen- und Binnenerzählung zur Lokalisierung von Kellers poetischem Realismus führt.
2 Begriffe: Dieses Kapitel bietet prägnante Definitionen der Begriffe Märchen, Novelle des 19. Jahrhunderts und poetischer Realismus, die für die Arbeit relevant sind. Es wird die Vielseitigkeit der Begriffsverwendung in Literatur und Forschung hervorgehoben und auf die Notwendigkeit einer konzisen Darstellung für die Zwecke der Arbeit hingewiesen. Die Definition des Märchens betont die Aufhebung der Wirklichkeitsbedingungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Silhouette der Wirklichkeit. Die Novelle des 19. Jahrhunderts wird als relativ kurze Prosafom mit einem hervorgehobenen Ereignis charakterisiert, das Vor- und Nachgeschichte gegenüberstellt. Der Fokus liegt auf alltäglichen Konflikten einzelner Menschen und der künstlerischen Gestaltung eines Ausschnitts der Gesellschaft. Die Bedeutung des Erzählers und der Reflektiertheit wird betont.
3 Gottfried Kellers poetischer Realismus aus Begegnungen von Märchen und Novelle in und durch Spiegel, das Kätzchen: Dieses Kapitel analysiert die Interaktion von Märchen und Novelle in Kellers "Spiegel, das Kätzchen" im Kontext seines poetischen Realismus. Es untersucht Parallelen im Erzählstil und kompositorischen Aufbau zwischen dem Märchen und den Seldwyla-Novellen, beispielsweise durch ein märchenhaftes Vokabular, lange Aufzählungen und die Verwendung von Rahmen- und Binnenerzählungen. Ziel ist es, die Positionierung von Kellers poetischem Realismus in diesem Komplex herauszuarbeiten. Der Abschnitt betrachtet "Spiegel, das Kätzchen" als ein komplexes literarisches Gebilde, das Elemente aus beiden Gattungen vereint und damit Kellers poetischen Realismus auf besondere Weise veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Gottfried Keller, Poetischer Realismus, Märchen, Novelle, Die Leute von Seldwyla, Spiegel, das Kätzchen, Erzähltechnik, Gattungsvermischung, Wirklichkeitsdarstellung, Rahmenhandlung, Binnenerzählung.
Häufig gestellte Fragen zu: Gottfried Kellers poetischer Realismus in "Spiegel, das Kätzchen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht, wie die Verbindung von Märchen und Novelle in Gottfried Kellers "Spiegel, das Kätzchen" (1856) zu seiner Umsetzung des poetischen Realismus beiträgt. Sie analysiert den Stellenwert des Märchens innerhalb des Zyklus "Die Leute von Seldwyla" und dessen Beziehung zu Kellers poetischem Realismus.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert prägnant die zentralen Begriffe Märchen, Novelle des 19. Jahrhunderts und poetischer Realismus. Dabei wird die Vielschichtigkeit der Begriffsverwendung in der Literatur und Forschung berücksichtigt. Das Märchen wird als eine Form beschrieben, die die Wirklichkeitsbedingungen aufhebt, aber gleichzeitig die Silhouette der Wirklichkeit beibehält. Die Novelle des 19. Jahrhunderts wird als eine relativ kurze Prosafom mit einem hervorgehobenen Ereignis definiert, das Vor- und Nachgeschichte gegenüberstellt und alltägliche Konflikte einzelner Menschen im Kontext der Gesellschaft darstellt. Der poetische Realismus wird im Kontext von Kellers Werk beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die die Forschungsfrage formuliert und den Forschungsweg skizziert; ein Kapitel mit Definitionen der Schlüsselbegriffe; ein Hauptkapitel, das die Interaktion von Märchen und Novelle in "Spiegel, das Kätzchen" im Kontext des poetischen Realismus analysiert; und abschließend ein Fazit und Ausblick.
Wie wird "Spiegel, das Kätzchen" analysiert?
Das Kapitel 3 analysiert die Interaktion von Märchen und Novelle in "Spiegel, das Kätzchen". Es untersucht Parallelen im Erzählstil und kompositorischen Aufbau zwischen dem Märchen und den Seldwyla-Novellen (z.B. märchenhaftes Vokabular, lange Aufzählungen, Rahmen- und Binnenerzählungen), um Kellers poetischen Realismus in diesem Kontext herauszuarbeiten. "Spiegel, das Kätzchen" wird als ein komplexes literarisches Gebilde betrachtet, das Elemente beider Gattungen vereint und Kellers poetischen Realismus auf besondere Weise veranschaulicht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den poetischen Realismus bei Gottfried Keller, das Verhältnis von Märchen und Novelle in seinem Werk, die Rolle von "Spiegel, das Kätzchen" in "Die Leute von Seldwyla", die Analyse der Erzählstruktur und des Erzählstils in "Spiegel, das Kätzchen", und die Integration des Märchenhaften in die realistische Darstellung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gottfried Keller, Poetischer Realismus, Märchen, Novelle, Die Leute von Seldwyla, Spiegel, das Kätzchen, Erzähltechnik, Gattungsvermischung, Wirklichkeitsdarstellung, Rahmenhandlung, Binnenerzählung.
- Citar trabajo
- Frank Tichy (Autor), 2015, Poetischer Realismus von Gottfried Keller. Begegnungen von Märchen und Novelle in "Spiegel, das Kätzchen", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302500