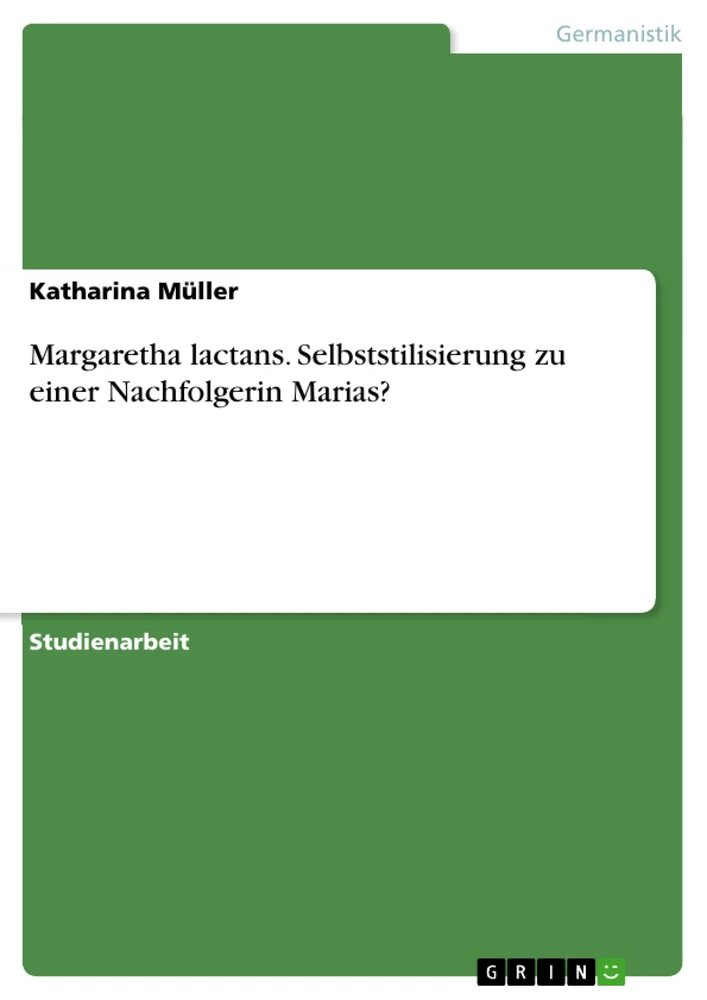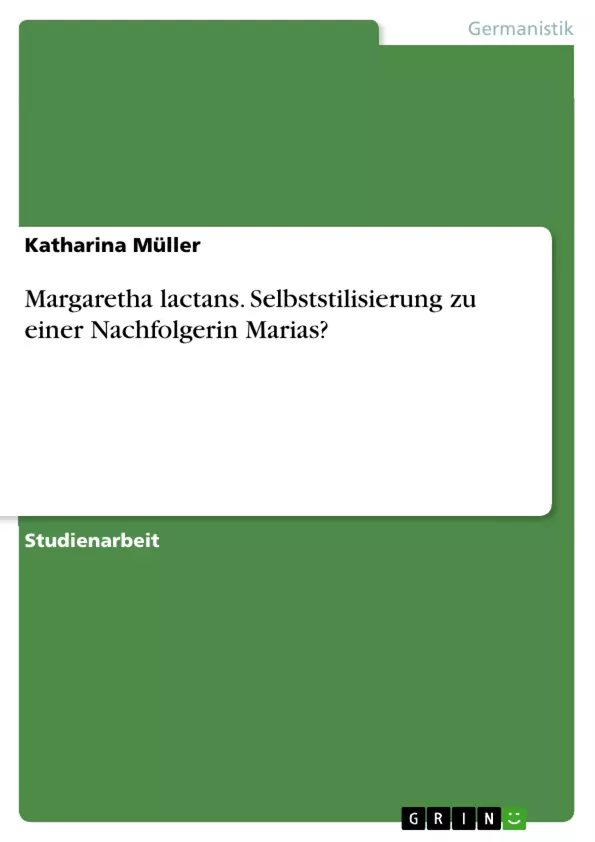Heinrich von Nördlingen – Margarethas guter Freund und Beichtvater – betitelt Margaretha Ebner in einem seiner Briefe an sie als maria lactans, die der gesamten Christenheit Gnaden bringen kann, indem sie diese an ihrer Brust stillt. Heinrich bezeichnet Margaretha als selige nachvolgerin Marias und wünscht sich von ihr: "[…] das du uns usz deinen mutterlichen vollen megdlichen brusten weiszlich und freintlich gesögen kanst." Es bleibt jedoch zu fragen, ob sich Margaretha in ihren Texten auch selbst zur Gottesmutter stilisiert, die Jesus Christus als ihr eigenes Kind annimmt und zu einer maria lactans wird?
Um diese Frage hinreichend zu beantworten, soll zunächst der Bildtypus der maria lactans untersucht werden, um in einem zweiten Schritt einen Vergleich zwischen den Ausführungen Margarethas und Heinrichs von Nördlingen anstellen zu können. Primär werden Margarethas Offenbarungen als Quellengrundlage dienen.
Der Fokus dieser Arbeit wird auf die inhaltliche Betrachtung Margarethas Mutterschafts und vor allem Stillvisionen gelegt. Die an Margaretha gerichteten Briefe Heinrichs von Nördlingen wurden gemeinsam mit den Offenbarungen 1882 von Philipp Strauch editiert und können ebenso hilfreich sein, um Erkenntnisse über Margaretha zu gewinnen. Als Sekundärliteratur zu Margaretha Ebner und zu mittelalterlicher Frauenmystik im Allgemeinen dienen insbesondere die Forschungsergebnisse von Peter Dinzelbacher, Caroline Walker Bynum, Uta Sörmer – Caysa, Bruno Quast, Urban Federer und Johannes Janota.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Maria lactans – die nährende Maria
- Margaretha Ebner
- Die Offenbarungen der Margaretha Ebner.
- Margaretha lactans – Margaretha Ebners Stillvisionen.
- Fazit.
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Stillvisionen in den Offenbarungen der Mystikerin Margaretha Ebner im Kontext mittelalterlicher Frauenmystik. Sie untersucht, inwiefern sich Margaretha selbst als "maria lactans" stilisiert und welche Rolle die Stillvisionen im Rahmen ihrer Leidensmystik und ihrer Verbindung zu Jesus Christus spielen.
- Der Bildtypus der "maria lactans" in der christlichen Tradition.
- Die Rolle der Stillvisionen in Margaretha Ebners Offenbarungen.
- Margaretha Ebners Beziehung zu Jesus Christus und ihre "imitatio Christi".
- Die Deutung der Stillvisionen als Ausdruck von Mutterschaft und Fürsorge.
- Die Bedeutung der Stillvisionen im Kontext der mittelalterlichen Frauenmystik.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der mittelalterlichen Mystik und die Rolle von Stillvisionen in der christlichen Tradition ein. Das Kapitel "Maria lactans – die nährende Maria" beleuchtet die Entstehung des Bildtypus der stillenden Gottesmutter Maria und seine Bedeutung in der christlichen Kunst und Theologie. Das Kapitel über Margaretha Ebner analysiert ihre Offenbarungen, insbesondere ihre Stillvisionen und ihre besondere Beziehung zu Jesus Christus. Hier wird auch auf die Rolle von Heinrich von Nördlingen als Margarethas Beichtvater und Freund eingegangen, der sie als "maria lactans" bezeichnet. Die Arbeit untersucht, ob sich Margaretha selbst in ihren Texten als stillende Gottesmutter darstellt und die Stillvisionen als Ausdruck ihrer "imitatio Christi" und ihrer spirituellen Verbindung zu Jesus Christus interpretiert.
Schlüsselwörter
Maria lactans, Margaretha Ebner, Stillvisionen, mittelalterliche Mystik, Frauenmystik, "imitatio Christi", Leidensmystik, Jesus Christus, Gottesmutter, Kirche, Mutterschaft, Fürsorge, Heinrich von Nördlingen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Margaretha Ebner?
Margaretha Ebner war eine bedeutende Mystikerin des Mittelalters, bekannt für ihre „Offenbarungen“ und ihre enge spirituelle Verbindung zu Jesus Christus.
Was bedeutet der Begriff „Maria lactans“?
„Maria lactans“ bezeichnet den christlichen Bildtypus der stillenden Gottesmutter Maria, der Gnade und mütterliche Fürsorge symbolisiert.
Was sind die Stillvisionen der Margaretha Ebner?
In ihren Visionen erlebt Margaretha, wie sie das Jesuskind stillt. Diese Visionen werden als Ausdruck ihrer „imitatio Christi“ und ihrer Identifikation mit der Rolle Marias gedeutet.
Welche Rolle spielte Heinrich von Nördlingen?
Heinrich von Nördlingen war Margarethas Beichtvater und Freund. Er bezeichnete sie in Briefen als „selige Nachfolgerin Marias“ und bestärkte sie in ihrer mystischen Stilisierung.
In welchem Kontext steht die Arbeit?
Die Arbeit ordnet Margarethas Erlebnisse in die mittelalterliche Frauenmystik ein und untersucht Themen wie Leidensmystik, Mutterschaft und die spirituelle Verbindung zur Kirche.
- Arbeit zitieren
- Katharina Müller (Autor:in), 2015, Margaretha lactans. Selbststilisierung zu einer Nachfolgerin Marias?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302535