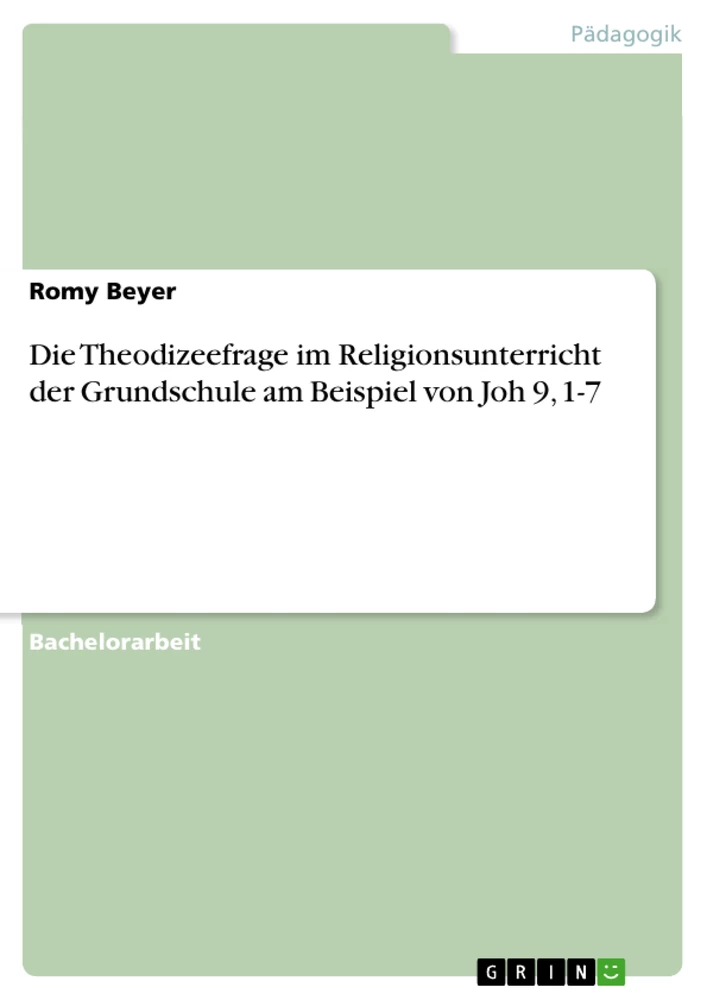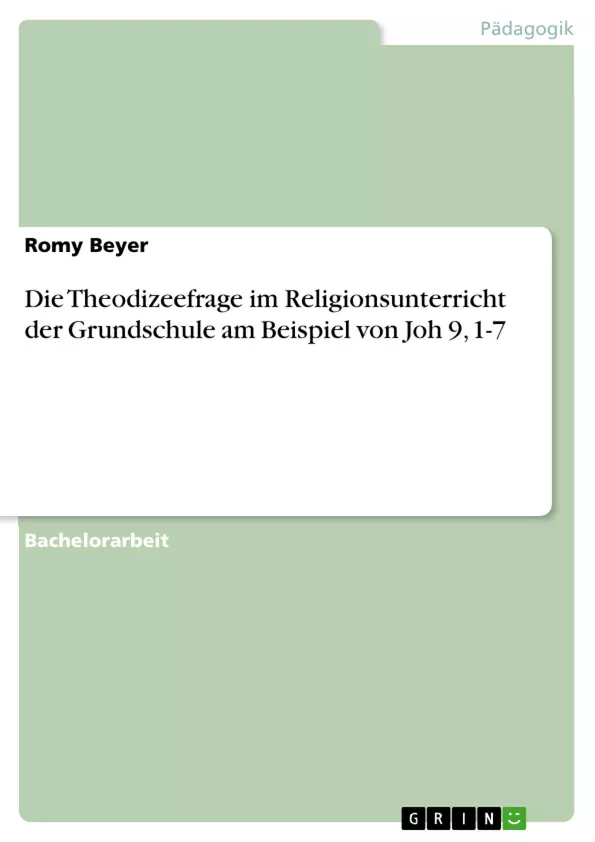In der vorliegenden Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema der Theodizeefrage unter der Fragestellung, ob und wie diese im Religionsunterricht der Grundschule behandelt werden kann. Dies werde ich am Beispiel der Bibelstelle Johannes 9, 1-7 „Die Heilung des Blindgeborenen“ diskutieren, und einen Unterrichtsentwurf zu diesem Thema vorstellen.
Für eine Beantwortung der Frage, wie und ob Kinder eine Verbindung zwischen Gott und Leid sehen, halte ich eine Auseinandersetzung mit dem dazugehörigen Bild der heutigen Gesellschaft für elementar. Daher beschäftige ich mich zunächst mit Leiderfahrungen von Kindern und der Frage nach ihrem Empfinden in Bezug auf Gott und Leid, um den pädagogischen Einstieg in die Thematik herzustellen.
Nur wenn man sich bewusst ist, dass dem Thema des Leidens in der heutigen Gesellschaft aufgrund von Verdrängung und Veralltäglichung eine nicht ausreichende Aufmerksamkeit zukommt, wird einem die Bedeutung der Thematik und die damit verbundene Wichtigkeit über diese bereits in der Grundschulzeit zu sprechen, bewusst.
Anschließend werde ich die Theodizeefrage in der Bibel und der Theologie darstellen um daraufhin die Frage nach Gottes Allmacht zu klären. Außerdem werde ich versuchen eine Antwort auf die Frage zu finden, warum Gott Leid zulässt und persönlich Stellung zu diesem Thema beziehen. Das Wissen über die christlichen Vorstellungen zur Theodizeefrage ist gleichzeitig unerlässlich, wenn man diese im Religionsunterricht bearbeiten möchte.
Um der Bachelorarbeit einen Rahmen zu geben, behandle ich das Thema an dem biblischen Text einer Wundererzählung. „Die Heilung eines Blindgeborenen“ (Joh 9, 1-7) erschien mir geeignet, um die Frage nach dem Ursprung des Unglücks zu beantworten und diesbezüglich zu erklären, wie man trotzdem von einem ‚guten Gott‘ sprechen kann. Als abschließenden Punkt der Hausarbeit gestalte ich einen Unterrichtsentwurf zum genannten Bibeltext. In dem anschließenden Fazit nehme ich Stellung zu den Schwierigkeiten während der Erstellung der Bachelorarbeit, welche persönlichen Antworten ich dabei gefunden habe und wie ich selber zu der Thematik der Hausarbeit stehe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Persönliche Motivation
- Warum ist es wichtig mit Kindern über Leid in Bezug auf Gott zu sprechen?
- Was denken Kinder über Leid und Gott?
- Was ist die Theodizeefrage?
- Die Allmacht Gottes
- Warum lässt Gott das Leid zu?
- Die Bibelstelle oh 9, 1-7
- Relevanz des Themas für die Schülerinnen und Schüler
- Bezug zum Lehrplan
- Kompetenzerwartungen und Ziele der Unterrichtseinheit
- Thema der Unterrichtsstunde (Inhalt und Intention)
- Fachwissenschaftliche Analyse zum Lerninhalt der Unterrichtsstunde
- Fachdidaktische und methodische Begründung
- Schwerpunktziel
- Fachbezogene Einzelziele
- Verlaufsplanung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Theodizeefrage im Kontext des Religionsunterrichts in der Grundschule. Sie analysiert, ob und wie diese Thematik am Beispiel der Bibelstelle Johannes 9, 1-7 behandelt werden kann. Die Arbeit betrachtet die Perspektive von Kindern, ihre Erfahrungen mit Leid und ihre Vorstellungen von Gott. Sie analysiert den biblischen Text und seine Relevanz für den Religionsunterricht und entwickelt einen Unterrichtsentwurf, der die Theodizeefrage altersgerecht zugänglich macht.
- Die Wahrnehmung von Leid durch Kinder und ihre Interpretation im Bezug auf Gott
- Die Theodizeefrage in der Bibel und in der Theologie
- Die Allmacht Gottes und die Frage nach der Zulässigkeit von Leid
- Die Relevanz der Bibelstelle Johannes 9, 1-7 für den Religionsunterricht
- Die Entwicklung eines Unterrichtsentwurfs zur Theodizeefrage für die Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Theodizeefrage im Kontext des Religionsunterrichts. Das zweite Kapitel beschreibt die persönliche Motivation der Autorin, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Kapitel 3 und 4 untersuchen die Perspektive von Kindern und ihre Erfahrungen mit Leid im Bezug auf Gott. Kapitel 5 definiert die Theodizeefrage und beleuchtet die Allmacht Gottes, während Kapitel 6 die Frage nach der Zulässigkeit von Leid diskutiert. Kapitel 7 analysiert den biblischen Text Johannes 9, 1-7 und seine Relevanz für den Religionsunterricht. Kapitel 8 entwickelt einen Unterrichtsentwurf, der die Theodizeefrage für Grundschüler zugänglich macht. Das abschließende Kapitel zieht ein Fazit und reflektiert die persönlichen Erkenntnisse der Autorin.
Schlüsselwörter
Theodizeefrage, Religionsunterricht, Grundschule, Leid, Gott, Johannes 9, 1-7, Wundererzählung, Blindgeborener, Allmacht, Unterrichtsentwurf, Kinderperspektive, pädagogische Didaktik, Theologie
- Quote paper
- Romy Beyer (Author), 2014, Die Theodizeefrage im Religionsunterricht der Grundschule am Beispiel von Joh 9, 1-7, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302642