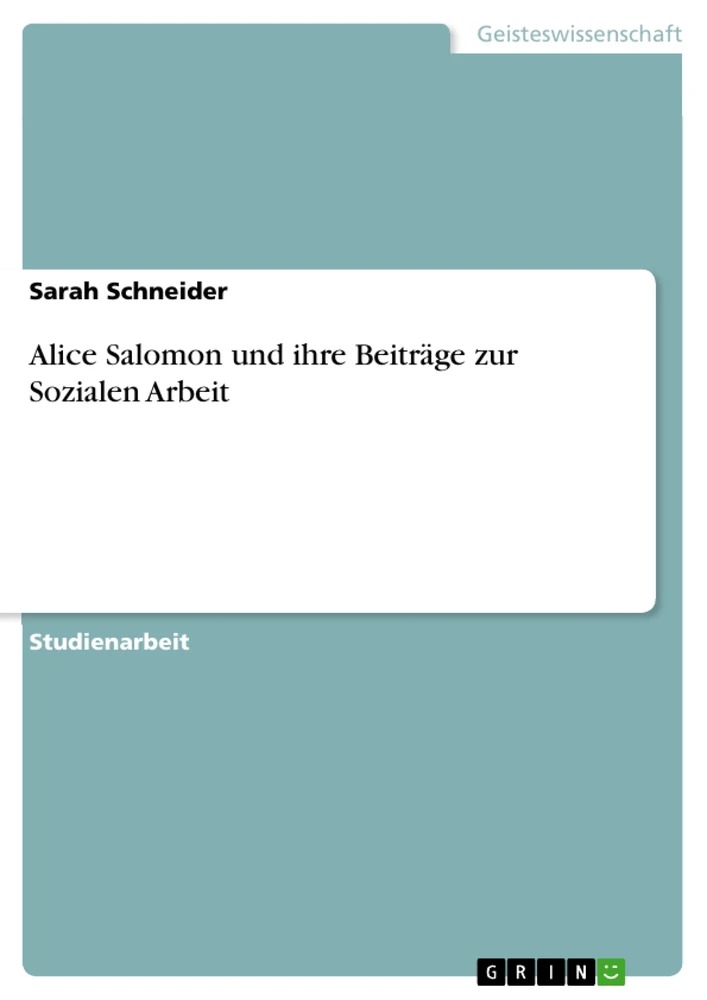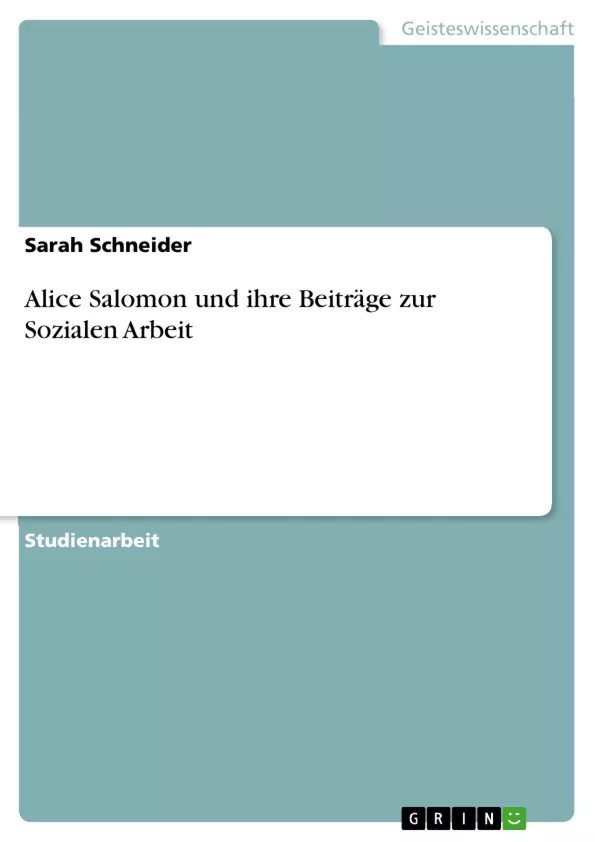Alice Salomon ist eine der bekanntesten Pionierinnen der Sozialen Arbeit, welche wohl den wesentlichsten und prägendsten Einfluss auf die Entwicklung der sozialen Berufsarbeit in Deutschland nahm. Die Hausarbeit widmet sich dem biographischen Hintergrund Alice Salomons und ihren Beiträgen zur Entwicklung der sozialen Berufsarbeit in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographie
- Kindheit und Jugend
- Einstieg in die soziale Hilfsarbeit
- Emigration und Aberkennung
- Alice Salomons Beiträge zur Sozialen Arbeit
- Exkurs: Gesellschaftliche und Geschichtliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung internationaler Kontakte
- Soziale Diagnose nach Mary Richmond
- Settlement-Bewegung nach Jane Addams
- Innovation einer sozialen Frauenschule
- Schlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Leben und Wirken von Alice Salomon, einer der bedeutendsten Pionierinnen der Sozialen Arbeit in Deutschland. Das Ziel ist es, ihre wichtigsten Beiträge zur Entwicklung des sozialen Berufsfeldes aufzuzeigen und deren Relevanz für die heutige Soziale Arbeit zu verdeutlichen. Dabei wird besonders auf die Zeit des 19. Jahrhunderts und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingegangen, um Salomons Handeln und Motivation besser zu verstehen.
- Alice Salomons Biographie und ihre prägenden Lebensereignisse
- Der Einstieg in die soziale Hilfsarbeit und die Entwicklung der Mädchen- und Frauengruppe für soziale Hilfsarbeit
- Alice Salomons Beiträge zur Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, insbesondere die Einführung neuer Methoden und Ansätze
- Die Bedeutung von Alice Salomons Engagement für die Frauenbewegung und die Emanzipation der Frau
- Die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf Alice Salomons Leben und Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Alice Salomon als eine der wichtigsten Pionierinnen der Sozialen Arbeit in Deutschland vor und erläutert die Zielsetzung und die Struktur der Hausarbeit.
Biographie
Kindheit und Jugend
Dieser Abschnitt skizziert Alice Salomons frühes Leben in Berlin und beschreibt ihre familiäre Umgebung sowie ihre frühen Erfahrungen mit Bildung und gesellschaftlichen Normen.
Einstieg in die soziale Hilfsarbeit
Hier wird der Beginn von Alice Salomons sozialem Engagement in Berlin im Jahr 1893 dargestellt. Es wird auf die Gründung der Mädchen- und Frauengruppe für soziale Hilfsarbeit und die Bedeutung dieser Organisation für die Entwicklung der Sozialen Arbeit eingegangen.
Emigration und Aberkennung
Dieser Abschnitt befasst sich mit Alice Salomons Emigration und den Folgen des Nationalsozialismus für ihre Arbeit.
Alice Salomons Beiträge zur Sozialen Arbeit
Exkurs: Gesellschaftliche und Geschichtliche Rahmenbedingungen
Dieser Abschnitt stellt die gesellschaftlichen und historischen Rahmenbedingungen des 19. Jahrhunderts dar, um den Kontext von Alice Salomons Handeln und ihrer Zeit zu verstehen.
Entwicklung internationaler Kontakte
Hier wird die Bedeutung von Alice Salomons internationalen Kontakten zu Persönlichkeiten wie Mary Richmond und Jane Addams für die Entwicklung der Sozialen Arbeit in Deutschland beleuchtet.
Innovation einer sozialen Frauenschule
Dieser Abschnitt befasst sich mit Alice Salomons Gründung einer sozialen Frauenschule und ihrer innovativen Ansätze in der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind Alice Salomon, Soziale Arbeit, Frauenbewegung, Sozialreform, Deutschland, 19. Jahrhundert, Hilfsarbeit, Frauenschule, Settlementbewegung, Mary Richmond, Jane Addams, Nationalsozialismus.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Alice Salomon?
Alice Salomon (1872–1948) war eine deutsche Sozialreformerin und eine der wichtigsten Pionierinnen der Sozialen Arbeit als akademischer Beruf.
Was war Salomons wichtigster Beitrag zur Sozialen Arbeit?
Sie gründete 1908 die erste soziale Frauenschule in Berlin und trug maßgeblich zur Professionalisierung und Akademisierung der sozialen Hilfsarbeit bei.
Was versteht man unter der "Sozialen Diagnose"?
Inspiriert durch Mary Richmond führte Salomon systematische Methoden zur Analyse sozialer Probleme ein, um eine gezielte und wissenschaftlich fundierte Hilfe zu ermöglichen.
Welchen Einfluss hatte die Frauenbewegung auf Alice Salomon?
Alice Salomon war aktiv in der bürgerlichen Frauenbewegung tätig und sah die Soziale Arbeit als ein Feld, in dem Frauen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und sich emanzipieren konnten.
Was geschah mit Alice Salomon während des Nationalsozialismus?
Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und ihrer politischen Überzeugungen wurde sie 1937 aus Deutschland vertrieben und emigrierte in die USA; ihre akademischen Grade wurden ihr aberkannt.
- Citar trabajo
- Sarah Schneider (Autor), 2015, Alice Salomon und ihre Beiträge zur Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302663