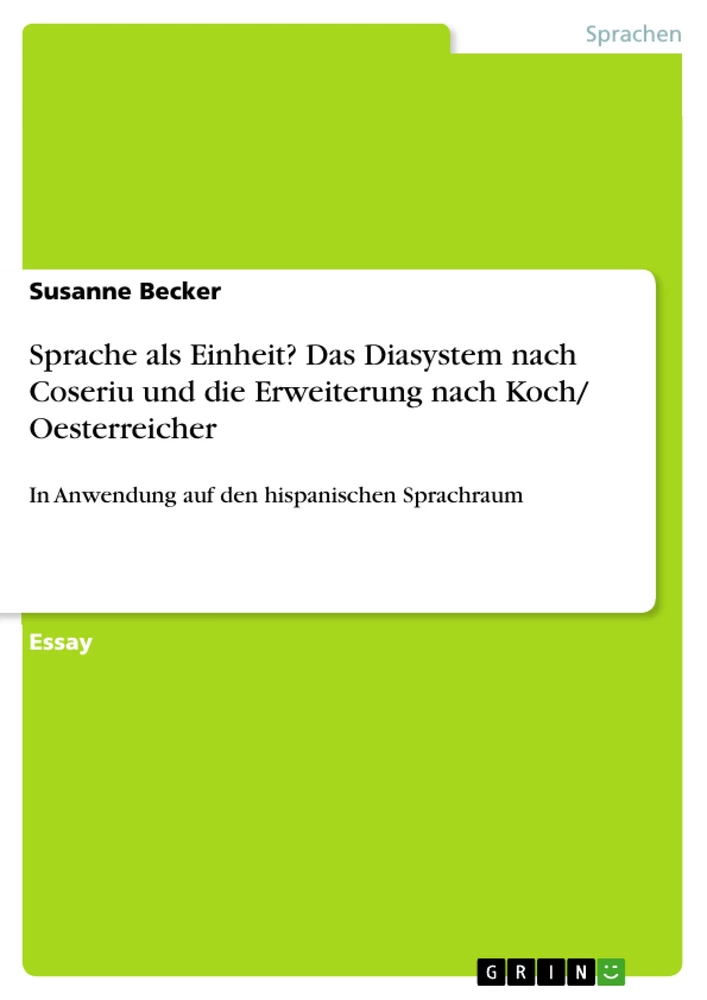Im Zuge der Beschäftigung mit wissenschaftlicher Literatur zum Thema Sprachwissenschaft wird man ebenso wie bei der Lektüre von Grammatiken und Wörterbüchern nicht selten auf diverse Definitionen von Sprache stoßen, die den Eindruck erwecken, dass es sich dabei um ein homogenes Kommunikationsmittel handelt. Doch dies ist so nicht richtig, ist doch selbst einem Laien der Sprachwissenschaft bewusst, dass Einzelsprachen wie etwa das Französische und das Spanische keineswegs eine Einheit miteinander bilden.
Dringt man weiter in eine Einzelsprache ein, stellt man fest, dass auch auf dieser inneren Sprachebene unterschiedliche Realisierungsformen vorliegen. Die logische Konsequenz ist also die Existenz von Sprachvarietät, die verschiedene Dimensionen unterscheidet.
Der Romanist Eugenio Coseriu definiert diese im Rahmen des Diasystems, ein Begriff, der von Uriel Weinreich eingeführt wurde und Sprache als ein System von Einzelsystemen (Varietäten) innerhalb einer geschlossenen Architektur auffasst.
Inhaltsverzeichnis
- Sprache - Eine Einheit?
- Das Diasystem nach Coseriu und die Erweiterung nach Koch/Oesterreicher in Anwendung auf den hispanischen Sprachraum
- Diatopische Variation
- Diastratische Variation
- Diaphasische Variation
- Die Erweiterung des Diasystems nach Koch/Oesterreicher
- Die vierte Dimension: Diamesische Variation
- Varietätenkette
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Vielfältigkeit der spanischen Sprache im Kontext des Diasystems, einem Modell, das Sprache als ein System von Varietäten innerhalb einer geschlossenen Architektur auffasst. Der Text analysiert die diatopische, diastratische und diaphasische Variation im Spanischen und stellt die Erweiterung des Diasystems durch Koch und Oesterreicher vor, die die diamesische Variation als vierte Dimension hinzufügt.
- Das Diasystem nach Coseriu und seine Erweiterung durch Koch/Oesterreicher
- Die diatopische, diastratische und diaphasische Variation im Spanischen
- Die diamesische Variation als vierte Dimension
- Die Varietätenkette und ihre Bedeutung für die Sprachvariation
- Die Unterscheidung zwischen Nähesprache und Distanzsprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problematik der Einheitlichkeit von Sprache dar und führt das Diasystem als Modell zur Beschreibung von Sprachvariation ein.
- Der Abschnitt über diatopische Variation beleuchtet die geographischen Unterschiede im Spanischen, z.B. in der Aussprache und im Wortschatz.
- Die diastratische Variation wird anhand der Schichtenspezifität der Tilgung des intervokalischen -d- und der Jugendsprache erläutert.
- Die diaphasische Variation beschreibt die Unterschiede in Gesprächsstilen, z.B. zwischen formellem und informellem Sprachgebrauch.
- Die Erweiterung des Diasystems durch Koch und Oesterreicher führt die diamesische Variation ein, die die Unterscheidung zwischen gesprochenen und geschriebenen Sprache berücksichtigt.
- Die Varietätenkette beschreibt die fließenden Übergänge zwischen den verschiedenen Dimensionen des Diasystems.
Schlüsselwörter
Diasystem, Sprachvariation, diatopische Variation, diastratische Variation, diaphasische Variation, diamesische Variation, Nähesprache, Distanzsprache, Koch/Oesterreicher, Coseriu, hispanischer Sprachraum.
- Arbeit zitieren
- Susanne Becker (Autor:in), 2010, Sprache als Einheit? Das Diasystem nach Coseriu und die Erweiterung nach Koch/ Oesterreicher, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302760