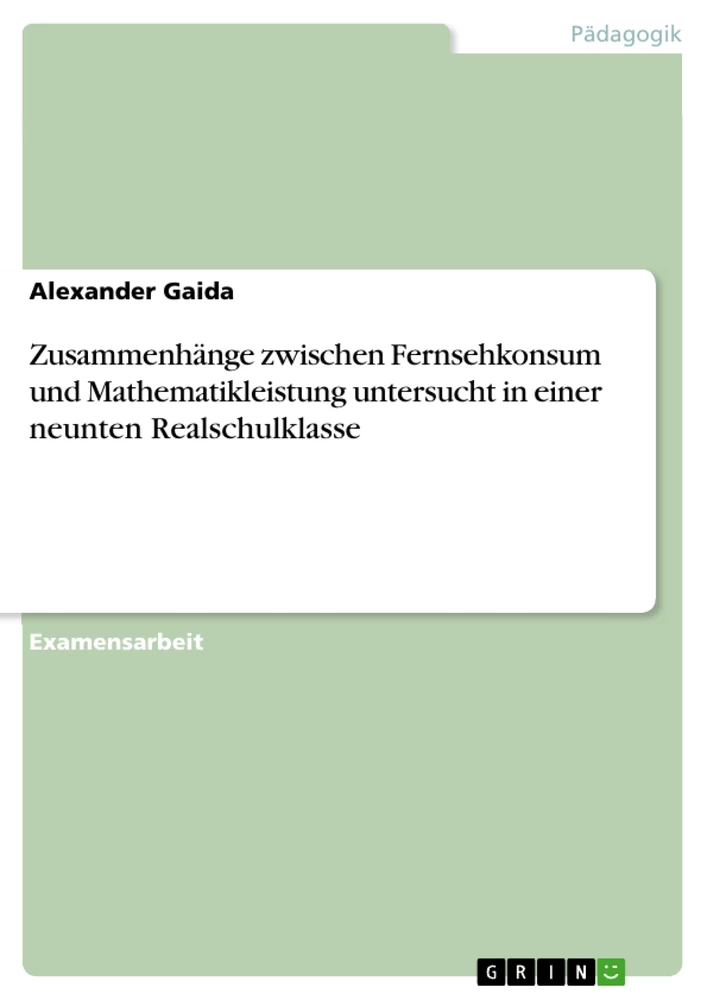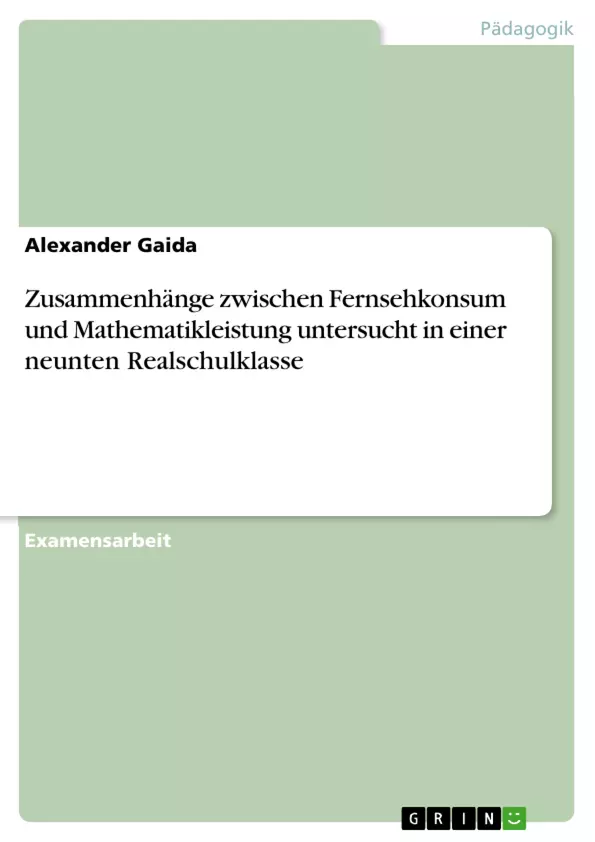Es ist bekannt, dass die Kulturtechnik "Mathematik" einer hohen Anzahl von Kindern große Schwierigkeiten bereitet, welche sich im Falle eines negativen Einflusses von Medien noch verstärken könnten. Da der Fernseher, dies zeigen später vorgestellte Studien, in fast jedem Elternhaus zu finden ist, kann die Frage zugelassen werden, ob das Konsumieren von Fernsehsendungen und -filmen Auswirkungen auf die Schulleistung hat. Diese Fragestellung soll in der Arbeit diskutiert werden. Aufgrund dessen lautet der Titel dieser Staatsarbeit "Zusammenhänge zwischen Fernsehkonsum und der Mathematikleistung untersucht in einer neunten Realschulklasse".
Die Arbeit ist in drei Hauptkapitel unterteilt, die wie folgt lauten:
Diskussion des Begriffs der Rechenstörung
In diesem Kapitel wird über eine Definition von Mathematikschwierigkeiten diskutiert, die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben wird. Bei der Diskussion werden kritische Autoren hinzugezogen, welche den vorgeschlagenen Definitionsversuch für problematisch halten. Zudem wird unter Berücksichtigung der Kritik an der erwähnten Definition eine eigene Stellungnahme versucht. Anschließend folgt die Vorstellung dreier Fallbeispiele, um einen konkreten Eindruck davon gewinnen zu können, wie sich größere Rechenprobleme im Leben von betroffenen Kindern äußern. Hier wird unter anderem auch beobachtet, ob sich bei den vorgestellten Kindern ein verstärkter Medienkonsum zeigt, der eventuell die Schulleistungen beeinträchtigen könnte.
Medien und Bildung
In diesem Kapitel wird auf die möglichen Auswirkungen des Fernsehkonsums auf die Bildung eingegangen. Dabei werden zuallererst Studien vorgestellt, die das Fernsehverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ergründet haben. Anschließend werden Meinungen, die innerhalb unserer Gesellschaft weit verbreitet sind, zum Themenkomplex Fernsehkonsum vorgestellt und überprüft, inwieweit sie wissenschaftlichen Studien standhalten, die sich vor allem mit der Frage beschäftigt haben, inwieweit Fernsehkonsum die Schulleistung beeinflusst.
Empirische Untersuchung
Im dritten und letzten Kapitel werden dann die Ergebnisse der selbst durchgeführten Erhebung vorgestellt, die an einer neunten Realschulklasse vollführt wurde. Dabei werden Forschungsergebnisse der zuvor vorgestellten Studien dahingehend überprüft, inwieweit sie mit den eigenen Forschungsergebnissen übereinstimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Beschreibung der Rechenschwierigkeiten
- Reaktionen auf die Rechenschwierigkeiten
- Ursachenvermutungen
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Diskussion des Begriffs der Rechenstörung
- Rechenstörungen laut dem Klassifikationskatalog der WHO
- Die Diskrepanzdefinition der WHO in der Kritik
- Kritische Autoren
- Hans Grissemann
- Michael Gaidoschik
- Hans-Dieter Gerster
- Karin Landerl und Liane Kaufmann
- Jens Holger Lorenz und Hendrik Radatz
- Wilhelm Schipper
- Zusammenfassung der Hauptkritikpunkte und Stellungnahme
- Illustration von Rechenschwierigkeiten anhand dreier Fallberichte
- Der siebenjährige Kai
- Vorstellung des Kindes
- Beschreibung der Rechenschwierigkeiten
- Reaktionen auf die Rechenschwierigkeiten
- Langfristige Auswirkungen
- Ursachenvermutungen
- Die achtjährige Melanie
- Vorstellung des Kindes
- Beschreibung der Rechenschwierigkeiten
- Reaktionen auf die Rechenschwierigkeiten
- Langfristige Auswirkungen
- Ursachenvermutungen
- Der zehnjährige Adam
- Vorstellung des Kindes
- Beschreibung der Rechenschwierigkeiten
- Reaktionen auf die Rechenschwierigkeiten
- Langfristige Auswirkungen
- Ursachenvermutungen
- Medien und Bildung
- Fernsehverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
- KIM-Studie und JIM-Studie im Vergleich
- Gerätebesitz
- Freizeitaktivitäten
- Medienbindung
- Konsumverhalten
- Lieblingssendungen
- Forschungsergebnisse der FIM-Studie
- Langfristige Veränderungen im Medienverhalten
- Zusammenfassung der Studienergebnisse
- Weitere Studienprojekte: mini-KIM-Studie und FIM-Studie
- Forschungsergebnisse der mini-KIM-Studie
- Ergebniszusammenfassung der vier Studienprojekte
- Populäre Meinungen zu Fernsehkonsum und Bildung
- Öffentliche Haltungen zu Fernsehen und Bildung
- Fernsehkritiker versus Fernsehbefürworter
- Kritiker des Fernsehapparates: Manfred Spitzer
- Kritik an Spitzers Thesen
- Befürworter des Fernsehens: Steven Johnson
- Kritik an Johnsons Thesen
- Untersuchungen zu Fernsehkonsum und Bildung
- KFN-Studie
- Zum Gerätebesitz der Viertklässler
- Gerätebesitz und Konsumverhalten
- Schulleistung
- Winterstein-Experiment
- Sisimpur-Studie
- Fazit
- Empirische Untersuchung
- Erhebung durch Schülerfragebögen und Lehrerbewertungsbogen
- Datenerhebungstabelle
- Datenaufbereitung
- Aufbereitung nach der Dauer des Fernsehkonsums
- Aufbereitung nach der Art des Fernsehkonsums
- Aufbereitung nach der Art der sonstigen Freizeitgestaltung
- Explorative Datenanalyse
- Divisive hierarchische Analyse
- Aufbau der Grafiken
- Auswertung der hierarchischen Analyse
- Interpretationen
- Tabellarische Analyse
- Gesamtpopulation
- Feminine Teilpopulation
- Maskuline Teilpopulation
- Auswertung der tabellarischen Analyse
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
- Fernsehkonsum und seine Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung
- Der Einfluss von Medien auf die schulische Leistung
- Die Rolle von Freizeitaktivitäten für die Entwicklung von mathematischen Fähigkeiten
- Die Bedeutung von individueller Förderung in der Mathematikdidaktik
- Der Einfluss von Geschlechterrollen auf die mathematische Leistung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und Mathematikleistung in einer neunten Realschulklasse. Ziel ist es, herauszufinden, ob und in welcher Weise sich das Fernsehverhalten auf die mathematischen Fähigkeiten von Schülern auswirkt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition und Kritik des Begriffs der Rechenstörung. Es werden verschiedene Definitionen aus dem Klassifikationskatalog der WHO vorgestellt und kritisch beleuchtet. Anschließend werden Fallbeispiele von Kindern mit Rechenschwierigkeiten präsentiert, um das Thema zu veranschaulichen.
Das zweite Kapitel behandelt das Fernsehverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Hier werden Ergebnisse verschiedener Studien wie der KIM-Studie, der JIM-Studie und der FIM-Studie vorgestellt und analysiert. Darüber hinaus werden populäre Meinungen zu Fernsehkonsum und Bildung sowie wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema diskutiert.
Das dritte Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde. Es werden die Erhebungsmethode, die Datenerhebungstabelle und die Datenaufbereitung erläutert. Schließlich werden die Ergebnisse der explorativen Datenanalyse vorgestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Rechenstörung, Fernsehkonsum, Mathematikleistung, Mediennutzung, Freizeitverhalten, kognitive Entwicklung, Geschlechterrollen, empirische Untersuchung, Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Beeinflusst Fernsehkonsum die Mathematikleistung?
Die Untersuchung geht der Frage nach, ob hoher Medienkonsum kognitive Ressourcen bindet und somit negative Auswirkungen auf die Schulleistung in Mathematik hat.
Was ist eine Rechenstörung laut WHO?
Die WHO definiert Rechenstörungen (Dyskalkulie) als Beeinträchtigung grundlegender Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch Intelligenz oder Beschulung erklärbar sind.
Was sagen die KIM- und JIM-Studien aus?
Diese Studien untersuchen das Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und zeigen Trends bei Gerätebesitz und Konsumdauer auf.
Gibt es Geschlechterunterschiede bei der Mathematikleistung?
Die empirische Untersuchung analysiert getrennte Daten für feminine und maskuline Teilpopulationen, um geschlechtsspezifische Zusammenhänge zu prüfen.
Welche Rolle spielen Freizeitaktivitäten?
Die Arbeit vergleicht den Fernsehkonsum mit anderen Freizeitbeschäftigungen, um zu sehen, ob ein ausgewogener Lebensstil die schulische Leistung stützt.
- Quote paper
- Alexander Gaida (Author), 2015, Zusammenhänge zwischen Fernsehkonsum und Mathematikleistung untersucht in einer neunten Realschulklasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302868