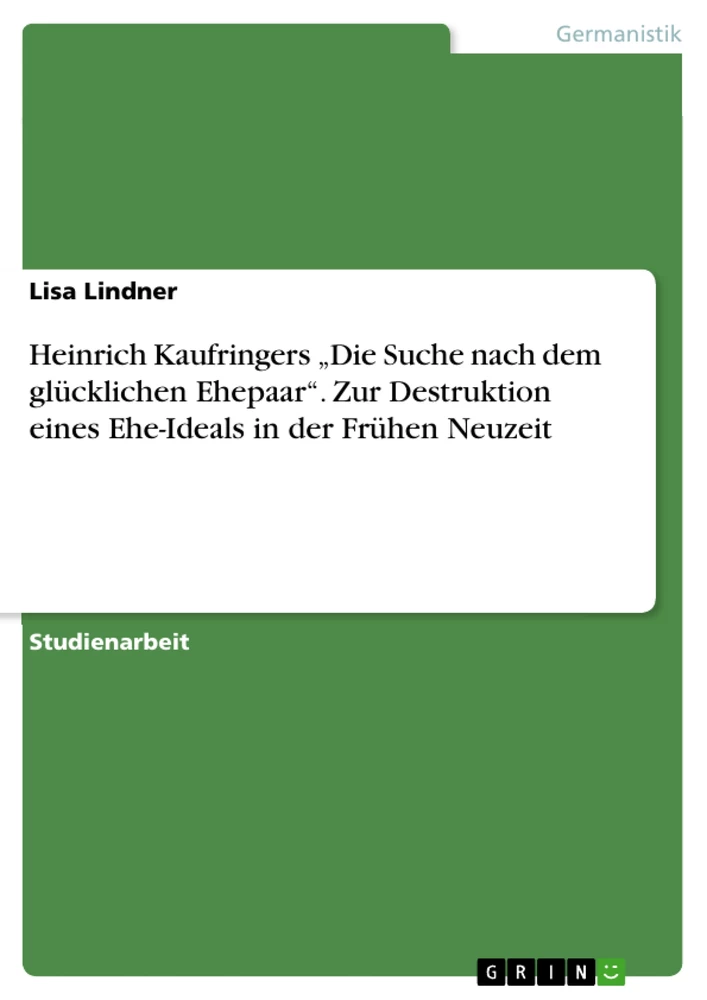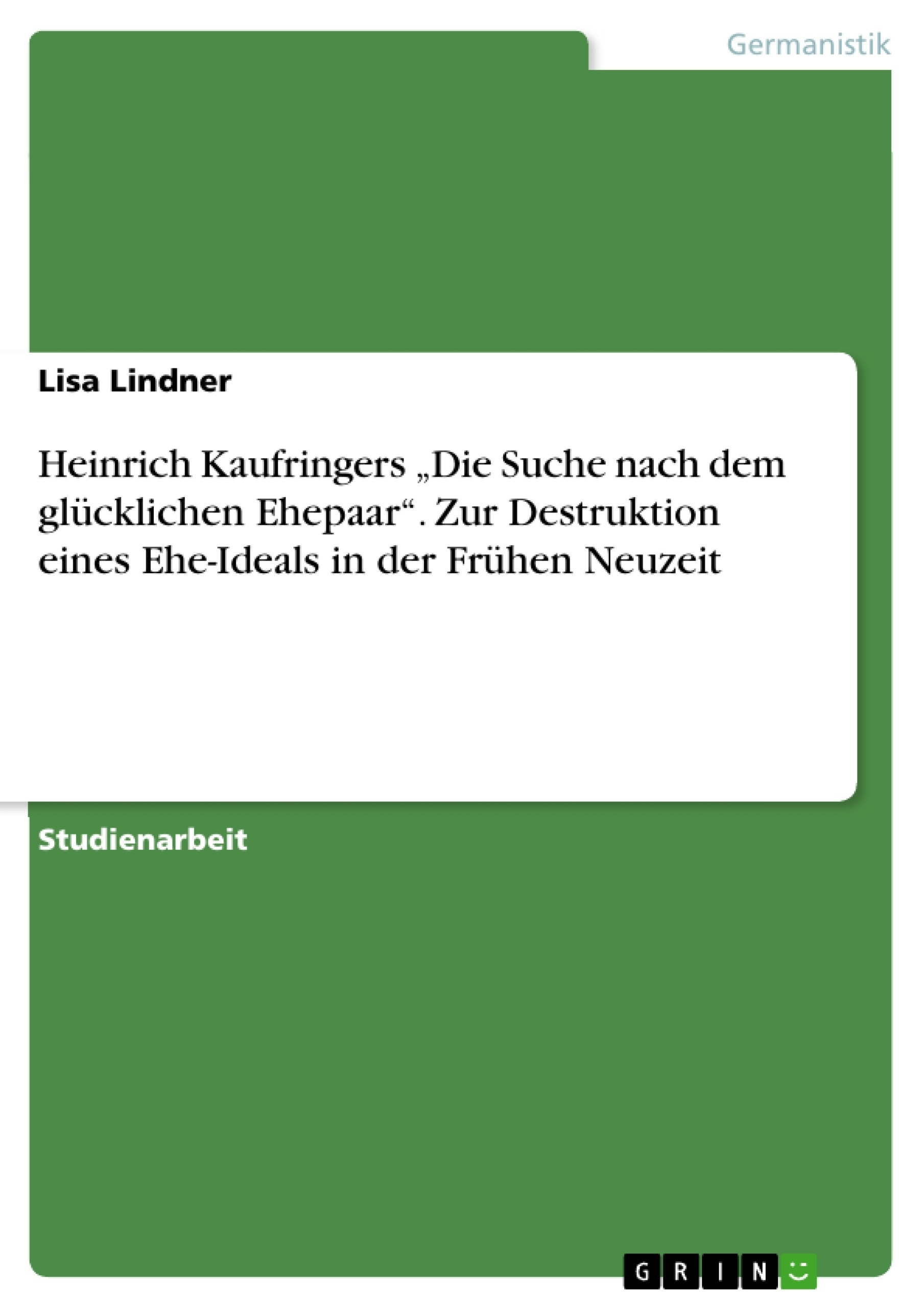Als ein hervorstechendes Merkmal der Literatur Heinrich Kaufringers wird der Grobianismus angeführt, eine Form des Anstößigen und des Extremen. Auch das Märe „Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar“, das in der vorliegenden Arbeit als Bestandteil einer Analyse der frühneuzeitlichen Ehenormen dienen soll, zeugt von eben jenen charakteristischen Merkmalen der Literatur des Autors. Nicht zuletzt auf seiner Irrfahrt auf der Suche nach einem vermeintlich harmonisch zusammenlebenden Ehepaar wird darin die Person eines Kaufmanns zweimalig Zeuge einer Perversion an abstrusen Vorstellungen der „rechten“ Ehe in der Frühen Neuzeit. In dieser Arbeit soll in einem ersten Teil ein historisches Abbild der idealen Ehe und die damit verbundene Anforderung an die Frau skizziert werden, deren Illusionen auch Kaufringers Hauptcharakter unterliegt.
In einem zweiten Teil erfolgt die Desillusionierung eben jener Ideale durch die abstrakten Beispiele einer abstrusen Eheführung bei Kaufringer. „List und Verschleierung, Heimlichkeiten und Betrug, das ist genau das Bild, das sich Zeitgenossen von den Aktivitäten der Frauen machten.“ Vitentexte, Hagiographen und rechtspraktische Quellen des 12. und 13. Jahrhunderts schildern gleichermaßen eben jene Strategien, welche eine Ehefrau „als gesellschaftlich und körperlich Unterlegene wählte[...], das sie sich nicht auf Macht und Ansehen berufen konnte[...],“ um dennoch ihre Stellung und ihre Rechte im Familiengefüge einzufordern. Der Ehealltag wurde in der historischen Forschung jedoch bislang nur wenig und kaum ausführlich erfasst.
Im Hinblick auf strukturelle als auch auf individuelle Aspekte wird dabei gerade in den letzten Jahren das Fehlen einer akteurszentrierten Erforschung frühneuzeitlicher Ehen formuliert.
Die hier vorliegende Arbeit will es sich dennoch zur Aufgabe machen, aus den wenigen Ressourcen zu schöpfen, um in einer analytischen Herangehensweise die Ideale einer frühneuzeitlichen Ehe zu sondieren. Als Quellen wurden in der Sekundärliteratur in erster Linie Gerichtsakten herangezogen, die durch die Verhandlung ehelicher Konflikte ein detailgetreues Abbild der Frühen Neuzeit zeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- VERPFLICHTUNGEN IN EINER RECHTEN EHE
- THEORIE DER IDEALEN EHEFRAU
- INNEREHEliche MachtBALANCE
- GRENZEN DER EHEHERRLICHEN GEWALT
- DISKREPANZ VON IDEAL UND WIRKLICHKEIT
- DifferenzeN ZWISCHEN ÖFfentlicher WaHRNEHMUNG UND „HAIMLICHER“ ENTZWEIUNG – AUFEINANDERTREFFEN MIT DEM ERSTEN EHEPAAR
- FUNKTION DER EHE ALS LEGITIMER ORT SEXUELLER, REPRODUKTIVER UND ÖKONOMISCHER AKTIVITÄTEN - AUFEINANDERTREFFEN MIT DEM Zweiten EhepaaR
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die frühneuzeitlichen Ehenormen anhand des Märes „Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar“ von Heinrich Kaufringer. Sie untersucht die Destruktion des Ehe-Ideals durch die Darstellung von abstrusen Eheführungen, die Kaufringers Hauptcharakter auf seiner Suche nach einem harmonischen Ehepaar begegnet.
- Die ideale Ehefrau in der Frühen Neuzeit: Gehorsam, Hingebung, eheliche Pflichten
- Machtbalance und Ehediskurse: Konflikte zwischen idealen Vorstellungen und der Realität
- Die Funktion der Ehe: Sexuelle, reproduktive und ökonomische Aspekte
- Die Destruktion des Ehe-Ideals durch Kaufringers Darstellung von abstrusen Eheführungen
- Die Rolle von Gewalt und anderen drastischen Maßnahmen in der Ehe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Märe „Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar“ als Beispiel für die Darstellung von abstrusen Eheführungen in Kaufringers Werk vor. Die Arbeit will die idealen Vorstellungen der Ehe in der Frühen Neuzeit beleuchten und deren Destruktion anhand der Beispiele aus dem Märe aufzeigen.
Kapitel 1 beschreibt die idealen Normen einer Ehe in der Frühen Neuzeit, insbesondere die Anforderungen an die Ehefrau. Es werden die Themen Gehorsam, Hingebung, eheliche Sexualität und die Bedeutung von Nachkommen für die Adelsgesellschaft behandelt.
Kapitel 2 beleuchtet die Diskrepanz zwischen idealen Vorstellungen und der Realität. Es wird die Machtbalance zwischen Mann und Frau, die Grenzen der eheherrlichen Gewalt und die Funktion der Ehe als Ort sexueller, reproduktiver und ökonomischer Aktivitäten untersucht. Die Beispiele aus dem Märe „Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar“ werden herangezogen, um diese Diskrepanz zu veranschaulichen.
Das Kapitel „Zusammenfassung und Ausblick“ fasst die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammen und bietet eine Perspektive auf die weitere Forschung.
Schlüsselwörter
Ehe-Ideal, Frühe Neuzeit, Heinrich Kaufringer, „Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar“, Machtbalance, Ehediskurse, Gewalt, Sexualität, Reproduktion, Ökonomie, Diskrepanz, Ideal und Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Kaufringers Märe „Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar“?
Das Werk thematisiert die Diskrepanz zwischen dem gesellschaftlichen Ideal der harmonischen Ehe und der oft grausamen oder abstrusen Realität in der Frühen Neuzeit.
Wie wurde die ideale Ehefrau in der Frühen Neuzeit definiert?
Die ideale Ehefrau sollte gehorsam, hingebungsvoll und sittsam sein, wobei die Erfüllung ehelicher Pflichten und die Fortpflanzung im Vordergrund standen.
Was versteht man unter Grobianismus in Kaufringers Literatur?
Grobianismus bezeichnet eine literarische Form des Anstößigen, Drastischen und Extremen, die Kaufringer nutzt, um gesellschaftliche Missstände und menschliche Schwächen aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt Gewalt in der Darstellung frühneuzeitlicher Ehen?
Die Arbeit zeigt auf, dass Gewalt oft als Mittel zur Aufrechterhaltung der innerfamilären Machtbalance oder als Folge ehelicher Entzweiung in den Quellen (z. B. Gerichtsakten) erscheint.
Welche Funktionen hatte die Ehe in der Adelsgesellschaft?
Die Ehe diente primär als legitimer Ort für sexuelle Aktivitäten, die Sicherung der Erbfolge (Reproduktion) und als ökonomische Zweckgemeinschaft.
- Citation du texte
- Lisa Lindner (Auteur), 2014, Heinrich Kaufringers „Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar“. Zur Destruktion eines Ehe-Ideals in der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302898