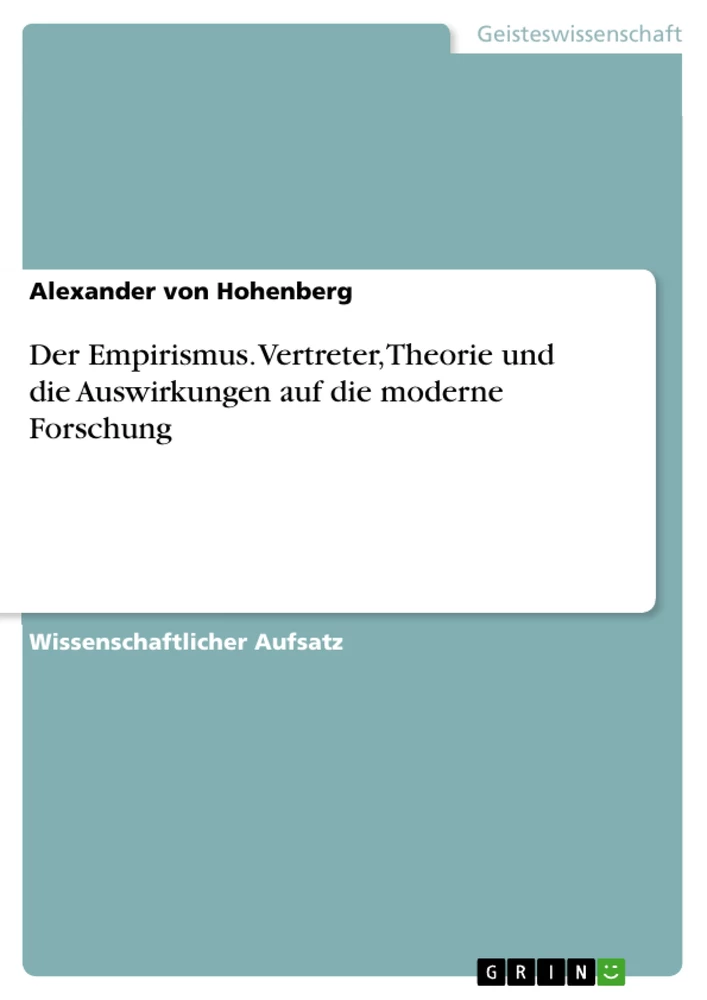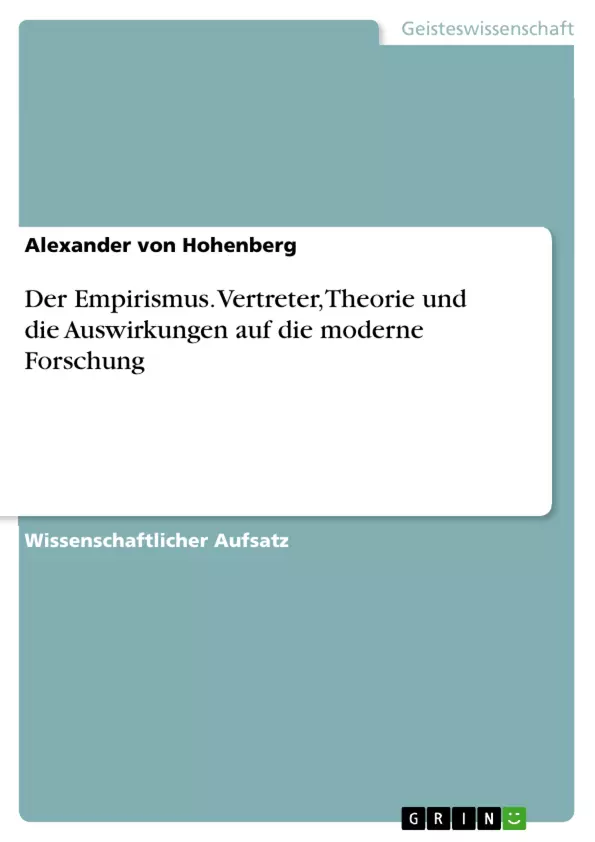Ideale Lektüre für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Im Rahmen dieser Arbeit soll der Empirismus, als eine der wichtigsten Denkströmungen der Neuzeit, näher beleuchtet werden. Dabei gilt es nicht nur die Entstehungsgeschichte und die wichtigsten Vertreter jener Zeit zu nennen. In dieser Arbeit sollen vor allem die Interdependenzen der verschiedenen Vertreter hervorgehoben werden und eine Einordnung in die Gedankengänge jener Zeit erfolgen. Dazu sollen auch konträre und ergänzende Strömungen kurz angeschnitten und beleuchtet werden. Welche Vertreter gab es und was haben Sie mit Ihrem individuellen Schaffen am Gesamtkonzept des Empirismus beigetragen?
Das weitere Ziel dieser Arbeit besteht in der genauen Darstellung der einzelnen Elemente des Empirismus. Es gilt hierbei, das komplette Gedankengut und die einzelnen Theorien der verschiedenen Vertreter verständlich zu machen. Die Theorien sollen auf Nachvollziehbarkeit hin überprüft und in einigen Punkten kritisch beleuchtet werden, um so eine vollständige Vorstellung des „Kerns der empirischen Forschungslehre“ zu erhalten. Was macht also die empirische Denkweise aus und welche Sicht der Dinge haben die Vertreter des Empirismus?
Um die verschiedenen Strömungen jener Zeit voneinander abzugrenzen soll in der vorliegenden Arbeit auch auf die spezifischen Unterschiede der diversen Formen des Empirismus eingegangen werden. Es haben sich örtliche wie auch zeitliche Differenzen in der Interpretation der empirischen Lehre ergeben, welche es genauer zu erörtern gilt. Wo liegen also die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Denkweisen jener Zeit?
Zur Abrundung des historischen Bildes des Empirismus und um einen Bogen in die Gegenwart und die Relevanz des Empirismus am heutigen Tage zu spannen, sollen Teildisziplinen der heutigen Forschung näher beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsfragen
- 1 Einführung
- 2 Historisches und Entwicklung des Empirismus
- 2.1 Aufklärung – Hintergründe
- 2.2 Entstehung des Empirismus
- 2.3 Denkströmungen der Zeit
- 2.3.1 Rationalismus
- 2.3.2 Skeptizismus
- 2.3.3 Materialismus
- 2.4 Entwicklung des Empirismus
- 2.4.1 Britischer Empirismus/Sensualismus
- 2.4.1.1 Merkmale des Britischen Empirismus
- 2.4.1.2 Britischer Pre-Empirismus (ca. 1600 – 1680 n. Chr.)
- 2.4.1.3 Hauptzeit des Britischen Empirismus (ca. 1680 - 1770 n. Chr.)
- 2.4.2 Logischer Empirismus/Neopositivismus
- 2.4.3 Konstruktiver Empirismus
- 2.4.1 Britischer Empirismus/Sensualismus
- 3 Die Vertreter des klassischen Empirismus
- 3.1 John Locke
- 3.1.1 Leben
- 3.1.2 Hauptwerk
- 3.1.3 Die gesellschaftliche Auswirkung von Lockes Werken
- 3.2 David Hume
- 3.2.1 Leben
- 3.2.2 Werke
- 3.3 Thomas Hobbes
- 3.3.1 Leben
- 3.3.2 Werk
- 3.1 John Locke
- 4 Wesentliche Bausteine der empirischen Erkenntnistheorie
- 4.1 Alle Erkenntnis muss auf Erfahrungen zurückgeführt werden
- 4.2 Annahme einer vom Wahrnehmenden unabhängigen materiellen Wirklichkeit
- 4.3 Alle Begriffe und Konventionen sind relativ
- 4.3.1 Der Begriff der Wahrheit
- 4.3.2 Der Begriff des Wissens
- 5 Probleme des Ideensystems
- 5.1 Das Induktionsproblem
- 5.2 Lösungsvorschläge zum Induktionsproblem
- 6 Empirismus in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen
- 6.1 Überblick über Empirismus in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen
- 6.2 Empirismus in der Betriebswirtschaftslehre
- 6.2.1 Kultur und interkulturelle Geschäftsbeziehungen
- 6.2.2 Exportzahlen in der genaueren Betrachtung
- 6.3 Empirismus in den Naturwissenschaften am Beispiel der Medizin
- 6.4 Empirismus in den Sozialwissenschaften
- 6.4.1 Stichprobenziehung von Ehepaaren
- 6.4.2 Simulieren oder Fragen?
- 7 Zusammenfassung und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie befasst sich mit dem Empirismus, einer zentralen Denkströmung der Neuzeit. Sie verfolgt das Ziel, die Entstehung und Entwicklung des Empirismus sowie seine bedeutendsten Vertreter und ihre Werke zu beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung des Empirismus im historischen Kontext.
- Die wichtigsten Vertreter des Empirismus und ihre Beiträge.
- Die zentralen Theorien des Empirismus und ihre Anwendung in der Forschung.
- Die Herausforderungen des Empirismus, insbesondere das Induktionsproblem.
- Die Relevanz des Empirismus für die moderne Forschung in verschiedenen Disziplinen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Forschungsfragen und den Fokus der Untersuchung. Im zweiten Kapitel wird die historische Entwicklung des Empirismus beleuchtet, von seinen Wurzeln in der Aufklärung bis zu den verschiedenen Strömungen wie dem Britischen Empirismus, dem Logischen Empirismus und dem Konstruktiven Empirismus. Das dritte Kapitel stellt wichtige Vertreter des klassischen Empirismus wie John Locke, David Hume und Thomas Hobbes vor.
Kapitel 4 widmet sich den zentralen Bausteinen der empirischen Erkenntnistheorie, darunter die Betonung von Erfahrung als Grundlage für Erkenntnis, die Annahme einer objektiven Realität und die Relativität von Begriffen und Konventionen. Kapitel 5 diskutiert das Induktionsproblem, eine der zentralen Herausforderungen des Empirismus, und beleuchtet verschiedene Lösungsansätze.
Im sechsten Kapitel wird die Anwendung des Empirismus in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen untersucht, darunter die Betriebswirtschaftslehre, die Naturwissenschaften und die Sozialwissenschaften. Schließlich bietet das siebte Kapitel eine Zusammenfassung und kritische Würdigung des Empirismus und seiner Bedeutung für die moderne Forschung.
Schlüsselwörter
Empirismus, Erkenntnistheorie, Erfahrung, Beobachtung, Induktion, Rationalismus, Skeptizismus, Materialismus, Britischer Empirismus, Logischer Empirismus, Konstruktiver Empirismus, John Locke, David Hume, Thomas Hobbes, Wissenschaft, Forschung, Methoden, Betriebswirtschaftslehre, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften.
- Arbeit zitieren
- Alexander von Hohenberg (Autor:in), 2014, Der Empirismus. Vertreter, Theorie und die Auswirkungen auf die moderne Forschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302982