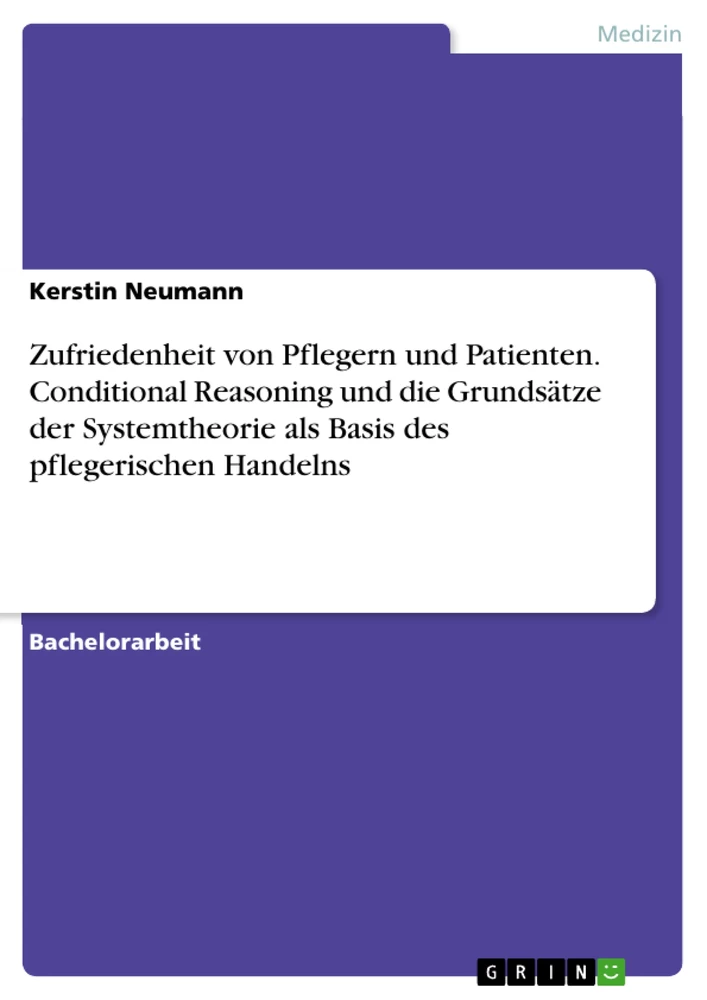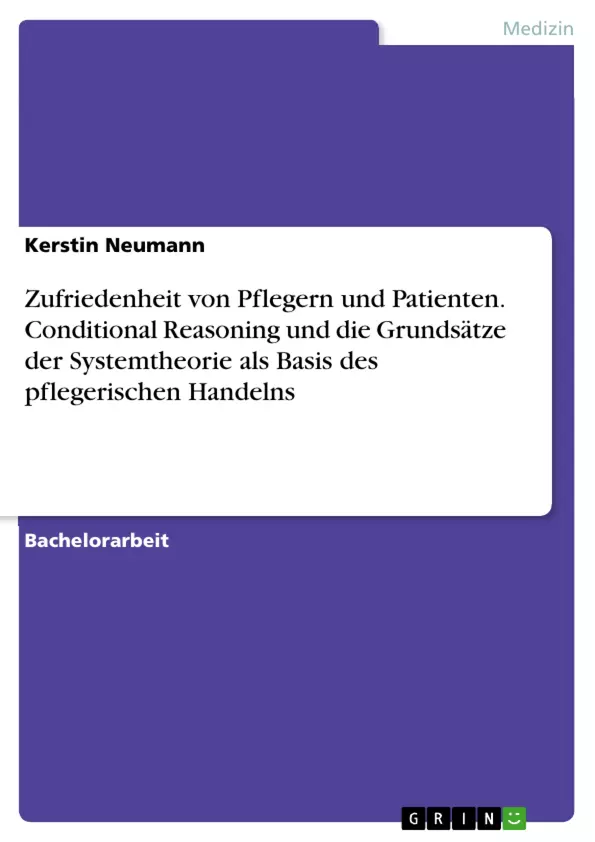Ist es möglich, in der Pflege die komplette „Ganzheit“ des Menschen zu erfassen?
Die Pflegekräfte haben sich zu sehr in die sogenannte „biomedizinische Denkweise“ der Mediziner hineindrängen lassen. Hier wird der Patient ähnlich wie eine Maschine wahrgenommen. Es wird nach dem Prinzip: Krankheit-Therapie-Genesung gedacht und gehandelt. Wie man allerdings die vorhandene Gesundheit erhält, oder inwieweit Familie, Herkunft, finanzieller Stand, Kultur und so weiter eine Rolle spielen, darüber wird hierbei nur selten nachgedacht.
Um aber den aktuellen Entwicklungen und dabei auch vor allem den vielen Patienten gerecht zu werden, wäre es in meinen Augen wichtig, pflegerisch zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Patienten zu kommen. Das heißt den einzelnen Patienten mit all seinen Problemen, seinem gesamten sozialen Umfeld und seinem Erleben wahrzunehmen. Dies ist auch schon immer die Grundlage der Palliativmedizin gewesen.
Doch ist es in der heutigen Zeit überhaupt durchführbar, auf der Basis des Conditional Reasoning und den Grundlagen der Systemtheorie zu pflegen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Hintergründe der Themenwahl
- 1.2. Fragestellungen
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 2. Erklärung und nähere Ausführung wichtiger Begriffe
- 2.1. Clinical Reasoning
- 2.2. Conditional Reasoning
- 2.3. Grundsätze der Systemtheorie
- 2.3.1. Allgemein
- 2.3.2. Das System selbst
- 2.3.3. Weitere systemtheoretische Begriffe
- 2.3.4. Wie funktioniert ein System?
- 2.3.5. Das Systemdenken in der Medizin
- 2.4. Pflege
- 2.4.1. Allgemein
- 2.4.2. Die Entwicklung der Pflege
- 2.4.3. Haupteinflussfaktoren auf die Pflege
- 2.4.4. Die Entwicklung der Pflege zum Beruf
- 2.4.5. Die Pflegetheorien
- 3. Aktuelle Problematik
- 3.1. Demographische Entwicklung
- 3.2. Rahmenbedingungen der Pflegeberufe
- 3.3. Wandel der Krankheitscharakteristik
- 4. Das Conditional Reasoning und die Grundsätze der Systemtheorie als Basis pflegerischen Handelns
- 4.1. Pflegeanamnese
- 4.1.1. Das biologische System
- 4.1.2. Das psychische System
- 4.1.3. Das soziale System
- 4.2. Pflegeziele
- 4.3. Pflegerische Wahrnehmung
- 4.3.1. Beobachtung
- 4.3.2. Kommunikation
- 4.4. multiprofessionelle Pflege
- 4.5. Der Pflegeprozess
- 4.6. Weitere Voraussetzungen für die Durchführung des Pflegeprozesses
- 4.6.1. Risikofaktoren
- 4.6.2. Alternative Behandlungsmethoden
- 4.7. Prospektives und Retrospektives Denken
- 5. Kasuistik
- 5.1. Chronische Erkrankung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Conditional Reasoning und den Grundsätzen der Systemtheorie als Basis pflegerischen Handelns. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Konzepte für die praktische Pflegearbeit zu beleuchten und ihre Anwendung in der Pflegeanamnese, der Festlegung von Pflegezielen, der pflegerischen Wahrnehmung und dem Pflegeprozess zu verdeutlichen.
- Analyse des Conditional Reasoning und seiner Relevanz für die Entscheidungsfindung in der Pflege
- Anwendung systemtheoretischer Prinzipien zur ganzheitlichen Betrachtung des Patienten
- Verdeutlichung der Bedeutung der multiprofessionellen Zusammenarbeit im Pflegeprozess
- Entwicklung einer praxisorientierten Herangehensweise an die Anwendung des Conditional Reasoning und der Systemtheorie in der Pflege
- Bewertung der Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen auf die Pflege und die Rolle des Conditional Reasoning und der Systemtheorie als Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Hintergründe der Themenwahl und die Fragestellungen der Arbeit vor. Kapitel 2 definiert und erläutert wichtige Begriffe wie Clinical Reasoning, Conditional Reasoning und die Grundsätze der Systemtheorie. Kapitel 3 beleuchtet die aktuelle Problematik in der Pflege, die sich aus der demographischen Entwicklung, den Rahmenbedingungen der Pflegeberufe und dem Wandel der Krankheitscharakteristik ergibt. Kapitel 4 untersucht die Anwendung des Conditional Reasoning und der Systemtheorie in der Pflegepraxis, wobei die Schwerpunkte auf der Pflegeanamnese, den Pflegezielen, der pflegerischen Wahrnehmung und dem Pflegeprozess liegen. Kapitel 5 enthält eine Kasuistik, die die Anwendung der theoretischen Konzepte in einem konkreten Fallbeispiel verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Conditional Reasoning, Systemtheorie, Pflege, Pflegeanamnese, Pflegeprozess, multiprofessionelle Zusammenarbeit, ganzheitliche Betrachtung, Patientenorientierung, Gesundheitswesen, Demographische Entwicklung, Krankheitscharakteristik
Häufig gestellte Fragen
Was ist „Conditional Reasoning“ in der Pflege?
Conditional Reasoning ist eine Denkform, bei der Pflegekräfte über den aktuellen Zustand hinausdenken, um mögliche Zukünfte des Patienten unter Berücksichtigung seines sozialen und persönlichen Kontextes zu antizipieren.
Wie hilft die Systemtheorie dem pflegerischen Handeln?
Sie ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung, bei der der Patient nicht als „Maschine“, sondern als Teil eines komplexen Systems (biologisch, psychisch, sozial) wahrgenommen wird.
Was wird an der „biomedizinischen Denkweise“ kritisiert?
Kritisiert wird die Reduzierung des Patienten auf seine Krankheit nach dem Schema „Krankheit-Therapie-Genesung“, ohne individuelle Lebensumstände oder Kultur einzubeziehen.
Warum ist multiprofessionelle Zusammenarbeit wichtig?
Da Gesundheit von vielen Faktoren abhängt, müssen verschiedene Berufsgruppen (Ärzte, Pfleger, Therapeuten) kooperieren, um dem Patienten ganzheitlich gerecht zu werden.
Was ist der Unterschied zwischen prospektivem und retrospektivem Denken?
Retrospektives Denken analysiert die Ursachen der aktuellen Situation, während prospektives Denken die zukünftige Entwicklung und notwendige Pflegeziele plant.
- Quote paper
- Kerstin Neumann (Author), 2013, Zufriedenheit von Pflegern und Patienten. Conditional Reasoning und die Grundsätze der Systemtheorie als Basis des pflegerischen Handelns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303050