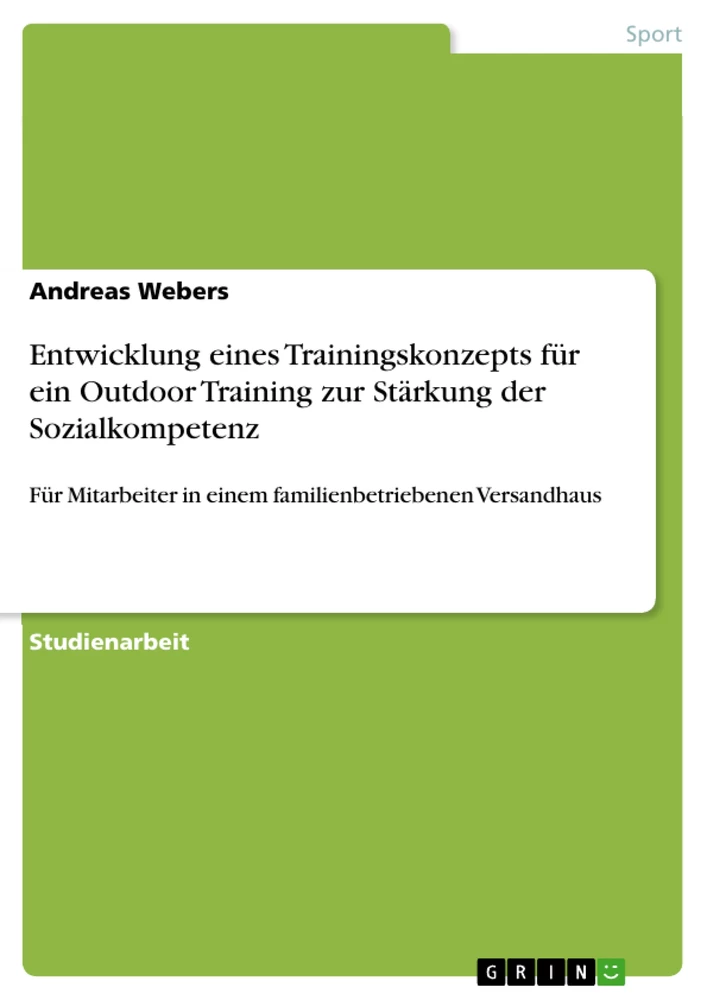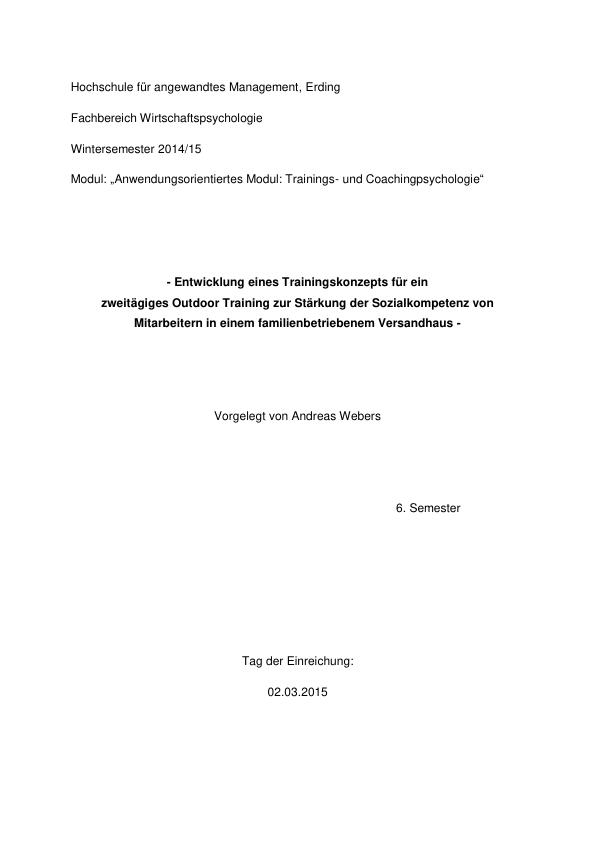Der Begriff Erlebnispädagogik fällt heutzutage immer wieder in sozialen Kontexten, gerade im Bereich der Arbeitswelt. Die Relevanz in diesem Zusammenhang hat eine immer höhere Bedeutung, denn durch verschiedene Methoden können zielgruppen-spezifische Elemente in einem sozialen Umfeld angesteuert und verbessert werden. Sei es in Unternehmen in denen die Teamarbeit Defizite hat oder Führungskräfte die Probleme mit ihren Untergebenen (oder umgekehrt) haben.
Die Schlüsselqualifikationen im sozialen und gerade im beruflichen Alltag sind essentiell für die Handlungskompetenz. Die Methoden der Erlebnispädagogik zielen u.a. auf diese Kompetenzen ab um den Teilnehmern einen Steigerung von beispielsweise der sozialen Kompetenz zu ermöglichen. Doch was macht den Erfolg und die langfristige Verbesserung der Erlebnispädagogik und dem damit verbundenen Handlungslernen aus?
Anhand eines exemplarischen Beispiels wird in dieser Studienarbeit erläutert werden, wie Menschen in einem neuen Umfeld unter dem Einwirken von Methoden der Erlebnispädagogik ihr Verhalten verändern, um so einen positiven Effekt auf den Alltag zu erleben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1. Einführung in die Erlebnispädagogik
- 2.2. Handlungslernen
- 2.3. Lernphasen
- 2.4. Reflexionsmodelle
- 2.5. Transfer
- 3. Beschreibung des Trainingsthemas
- 3.1. Sozialkompetenz
- 3.1.1. Kommunikation
- 3.1.1.1. Fragetechniken
- 3.1.1.2. Zuhörtechniken
- 3.1.1.3. Feedbacktechniken
- 3.1.2. Konfliktmanagement
- 3.1.3. Teamfähigkeit und Teamentwicklung
- 4. Praktischer Teil
- 4.1. Das Unternehmen „BW“
- 4.2. Auftragsklärung
- 4.3. Bedarfsanalyse
- 4.4. Analyse der Teilnehmer
- 4.5. Erfolgreiche Umsetzung – spezifische Lernziele
- 5. Grobkonzept und Didaktik
- 5.1. Einleitung
- 5.2. Hauptteil
- 5.3. Trainingsausstieg – Der Evaluationsprozess
- 6. Abschlussbewertung
- 6.1. Qualitätskriterien
- 6.2. Sicherheitsstandards
- 6.3. Neurodidaktik
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines zweitägigen Outdoor-Trainings zur Stärkung der Sozialkompetenz von Mitarbeitern in einem familiengeführten Versandhaus. Ziel ist es, ein praxisnahes und effektives Training zu konzipieren, das die Teilnehmer in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung unterstützt.
- Erlebnispädagogische Methoden und Handlungslernen
- Entwicklung und Förderung von Kommunikations-, Konfliktmanagement- und Teamfähigkeit
- Spezifische Lernziele und Indikatoren für die Messung des Lernerfolgs
- Einbindung von Qualitätskriterien, Sicherheitsstandards und neurodidaktischen Prinzipien
- Transfer der im Training erworbenen Kompetenzen in den Arbeitsalltag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Zielsetzung des Trainingskonzepts einführt. Im theoretischen Teil werden die Grundlagen der Erlebnispädagogik, Handlungslernens, Lernphasen, Reflexionsmodelle und des Transfers beleuchtet. Im Kapitel „Beschreibung des Trainingsthemas“ wird die Bedeutung von Sozialkompetenz im Berufsleben erläutert, wobei die Schwerpunkte auf Kommunikation, Konfliktmanagement und Teamfähigkeit liegen. Der praktische Teil befasst sich mit dem Unternehmen „BW“, der Auftragsklärung, der Bedarfsanalyse und der Analyse der Teilnehmer. Es werden spezifische Lernziele für das Training definiert. Das Kapitel „Grobkonzept und Didaktik“ skizziert die Struktur und den Ablauf des Trainings, während die Abschlussbewertung die Qualitätskriterien, Sicherheitsstandards und neurodidaktischen Prinzipien beleuchtet. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Sozialkompetenz, Erlebnispädagogik, Handlungslernen, Kommunikation, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Trainingskonzept, Outdoor-Training, Bedarfsanalyse, Lernziele, Qualitätskriterien, Sicherheitsstandards, Neurodidaktik
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Outdoor-Trainingskonzepts?
Das Ziel ist die Stärkung der Sozialkompetenz (Kommunikation, Teamfähigkeit, Konfliktmanagement) von Mitarbeitern durch Methoden der Erlebnispädagogik.
Was versteht man unter "Handlungslernen"?
Handlungslernen ist ein pädagogischer Ansatz, bei dem Teilnehmer durch praktisches Tun und anschließende Reflexion neue Verhaltensweisen erproben und verinnerlichen.
Welche Kommunikationstechniken werden im Training vermittelt?
Der Fokus liegt auf Fragetechniken, aktiven Zuhörtechniken und professionellen Feedbacktechniken.
Warum ist der "Transfer" in den Alltag so wichtig?
Der Transfer stellt sicher, dass die im geschützten Trainingsumfeld erworbenen Kompetenzen langfristig im realen Berufsalltag angewendet werden können.
Welche Rolle spielt die Neurodidaktik im Konzept?
Die Neurodidaktik nutzt Erkenntnisse der Hirnforschung, um Lernprozesse so zu gestalten, dass Informationen besser verarbeitet und im Langzeitgedächtnis gespeichert werden.
Wie wird der Erfolg des Trainings gemessen?
Durch einen strukturierten Evaluationsprozess am Ende des Trainings, der spezifische Lernziele und Indikatoren abgleicht.
- Quote paper
- Andreas Webers (Author), 2015, Entwicklung eines Trainingskonzepts für ein Outdoor Training zur Stärkung der Sozialkompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303102