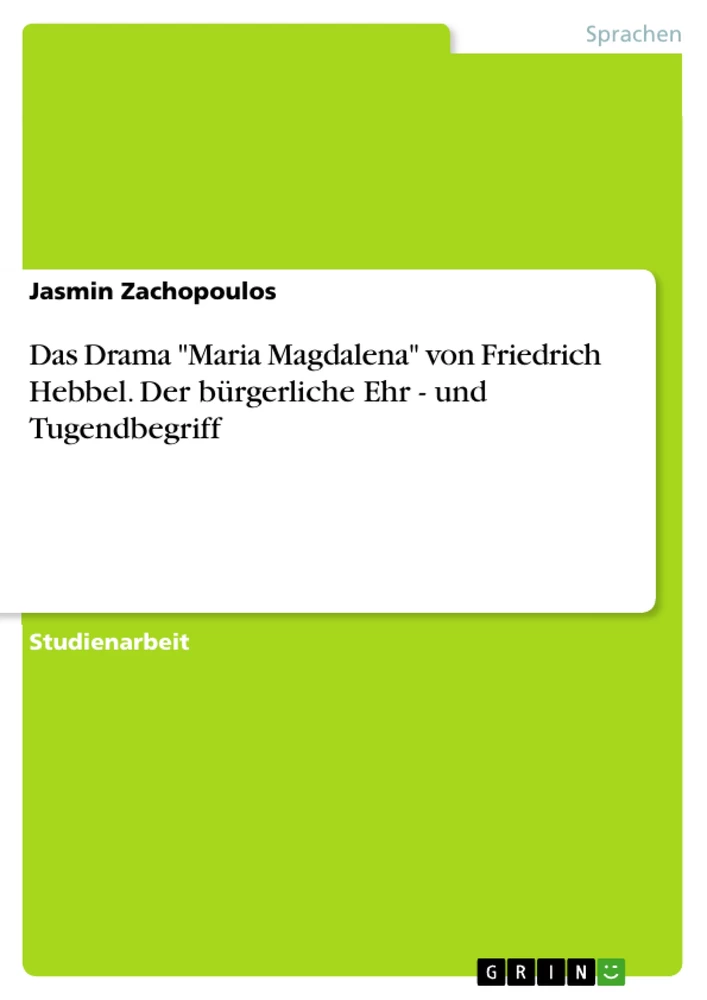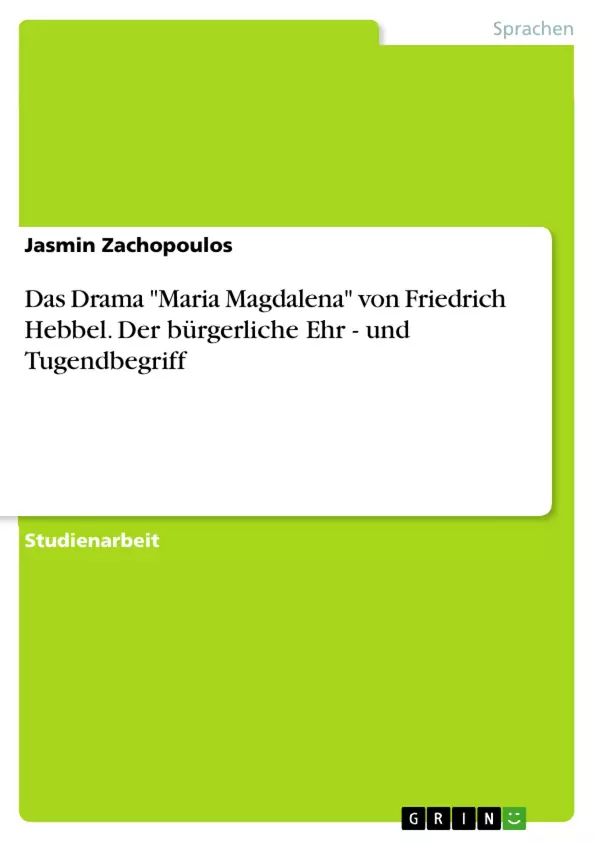In meiner vorliegenden Hausarbeit habe ich mich eingehend mit Friedrich Hebbels Drama "Maria Magdalena" auseinandergesetzt. Dieses Stück steht in der Tradition des Familiendramas, „einer Tradition, in der das, was Diderot als höchstes Gut gilt, als der einzige Ort, an dem der Mensch glücklich sein kann [gemeint ist die Familie] allmählich zur Hölle pervertiert.“ Die Welt von Meister Antons Familie ist gekennzeichnet von einer bedrückenden Enge, einer Enge, die unheilvoll über die Figuren des Dramas schwebt und sie sowohl in ihren Verhaltensweisen, als auch Entscheidungsmöglichkeiten einengt und beschränkt.
Ziel meiner Arbeit ist es am Beispiel diverser Figuren aufzuzeigen, wie der Begriff von Ehre und Tugend in diesem tragischen Trauerspiel eine Sinnentleerung erfährt. Bei Hebbel resultiert die Darstellung von menschlichem Leiden und Untergang nicht aus einem zufälligen Unglück, sondern ist die Folge „einer Verfehlung, des Schicksals oder geschichtlich- gesellschaftlicher Umstände“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hebbels Maria Magdalena im Vergleich zum traditionellen bürgerlichen Trauerspiel des 18. Jahrhunderts
- Die Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs
- Klaras Mutter: Letzte Instanz des herkömmlichen Tugendbegriffs
- Leonhard: Loslösung von Ehre und Tugend
- Meister Anton: Übersteigerter Ehrbegriff führt in die Katastrophe
- Klara: Das Selbstopfer einer gehorsamen Tochter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Friedrich Hebbels Drama "Maria Magdalena" im Kontext des bürgerlichen Trauerspiels des 18. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs anhand verschiedener Figuren aufzuzeigen und zu untersuchen, wie gesellschaftliche Bedingungen und die Enge der kleinbürgerlichen Welt das menschliche Leiden und den Untergang beeinflussen.
- Der Vergleich von Hebbels "Maria Magdalena" mit traditionellen bürgerlichen Trauerspielen.
- Die Entwicklung und Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs im Drama.
- Die Rolle der Familie und der gesellschaftlichen Bedingungen im tragischen Verlauf.
- Die Charakterisierung der Hauptfiguren und ihre individuellen Konflikte.
- Die Analyse der dramaturgischen Struktur und der verwendeten literarischen Mittel.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die zentralen Fragestellungen und den Untersuchungsgegenstand: Friedrich Hebbels Drama "Maria Magdalena" und die darin dargestellte Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs im Kontext des bürgerlichen Trauerspiels. Sie skizziert die Methode der Analyse, die sowohl werkimmanente als auch soziohistorische und psychologische Aspekte berücksichtigt, und betont die Zwangsläufigkeit der tragischen Ereignisse im Drama, die nicht auf Zufall, sondern auf Verfehlungen und gesellschaftliche Umstände zurückzuführen sind. Die Einleitung dient als Grundlage für die tiefergehende Analyse der folgenden Kapitel.
Hebbels Maria Magdalena im Vergleich zum traditionellen bürgerlichen Trauerspiel des 18. Jahrhunderts: Dieses Kapitel vergleicht Hebbels Drama mit den bürgerlichen Trauerspielen des 18. Jahrhunderts. Während letztere das Bürgertum als tragikfähige Figur in den Mittelpunkt stellten und zum Mitleid anregten, fokussiert Hebbel auf die Enge und Scheinmoral der kleinbürgerlichen Welt innerhalb der Familie. Das Kapitel verdeutlicht, wie der Begriff „Bürgertum“ in beiden Kontexten unterschiedlich interpretiert wird: im 18. Jahrhundert als Synonym für Menschlichkeit und Erhabenheit, bei Hebbel als Ausdruck von Begrenztheit und Unfähigkeit, sich in schwierigen Situationen zu helfen. Hebbels Ziel war es, das Tragische nicht aus dem Konflikt mit dem Adel, sondern aus der bürgerlichen Welt selbst abzuleiten.
Die Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs: Dieses Kapitel analysiert die Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs anhand der Figuren des Dramas. Es beginnt mit einer Beschreibung der dramaturgischen Struktur, wobei die langsame Enthüllung der Zusammenhänge im Fokus steht. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Klaras Mutter als Vertreterin des traditionellen Tugendbegriffs und die Gegenüberstellung zu anderen Figuren, welche die beschränkende und letztlich zerstörerische Natur dieser Moral aufzeigen. Die Vorahnung des Todes und die tragischen Folgen werden eingehend beleuchtet. Der Abschnitt enthält eine Analyse von Klaras Mutter, die das herkömmliche Tugendverständnis repräsentiert. Weitere Figuren und ihre Beziehungen werden in diesem Kapitel vertieft behandelt, um die verschiedenen Aspekte der Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs zu illustrieren.
Schlüsselwörter
Maria Magdalena, Friedrich Hebbel, bürgerliches Trauerspiel, Ehre, Tugend, Scheinmoral, Familie, Kleinbürgertum, gesellschaftliche Bedingungen, Tragödie, Sinnentleerung, analytisches Drama.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Friedrich Hebbels "Maria Magdalena"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Friedrich Hebbels Drama "Maria Magdalena" im Kontext des bürgerlichen Trauerspiels des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs und deren Auswirkungen auf das menschliche Leiden und den Untergang der Figuren im Drama.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vergleich von Hebbels "Maria Magdalena" mit traditionellen bürgerlichen Trauerspielen, die Entwicklung und Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs, die Rolle der Familie und gesellschaftlicher Bedingungen, die Charakterisierung der Hauptfiguren und ihre Konflikte, sowie die Analyse der dramaturgischen Struktur und der verwendeten literarischen Mittel.
Wie wird die Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs analysiert?
Die Sinnentleerung des Ehr- und Tugendbegriffs wird anhand verschiedener Figuren analysiert: Klaras Mutter repräsentiert den traditionellen Tugendbegriff, während Leonhard, Meister Anton und Klara dessen Beschränkungen und zerstörerische Natur aufzeigen. Die Analyse beleuchtet die Vorahnung des Todes und die tragischen Folgen der festgefahrenen Moralvorstellungen.
Welche Rolle spielt der Vergleich mit bürgerlichen Trauerspielen des 18. Jahrhunderts?
Der Vergleich mit bürgerlichen Trauerspielen des 18. Jahrhunderts verdeutlicht den Unterschied in der Interpretation des „Bürgertums“: Während im 18. Jahrhundert das Bürgertum als tragikfähig und mitfühlenswert dargestellt wurde, zeigt Hebbel die Enge und Scheinmoral der kleinbürgerlichen Welt als Quelle des Tragischen auf.
Welche Figuren werden im Detail analysiert?
Die Hausarbeit analysiert im Detail die Figuren Klara, ihre Mutter, Leonhard und Meister Anton. Die Analyse konzentriert sich auf deren jeweilige Interpretation und Umsetzung von Ehre und Tugend und deren Konsequenzen.
Welche Methode wird in der Analyse verwendet?
Die Analyse berücksichtigt sowohl werkimmanente als auch soziohistorische und psychologische Aspekte. Die Zwangsläufigkeit der tragischen Ereignisse wird nicht auf Zufall, sondern auf Verfehlungen und gesellschaftliche Umstände zurückgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Maria Magdalena, Friedrich Hebbel, bürgerliches Trauerspiel, Ehre, Tugend, Scheinmoral, Familie, Kleinbürgertum, gesellschaftliche Bedingungen, Tragödie, Sinnentleerung, analytisches Drama.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist strukturiert in Einleitung, Vergleich mit traditionellen bürgerlichen Trauerspielen, Analyse der Sinnentleerung von Ehre und Tugend (einschließlich Einzelanalysen der Figuren), und Fazit.
- Quote paper
- Jasmin Zachopoulos (Author), 2014, Das Drama "Maria Magdalena" von Friedrich Hebbel. Der bürgerliche Ehr - und Tugendbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303148