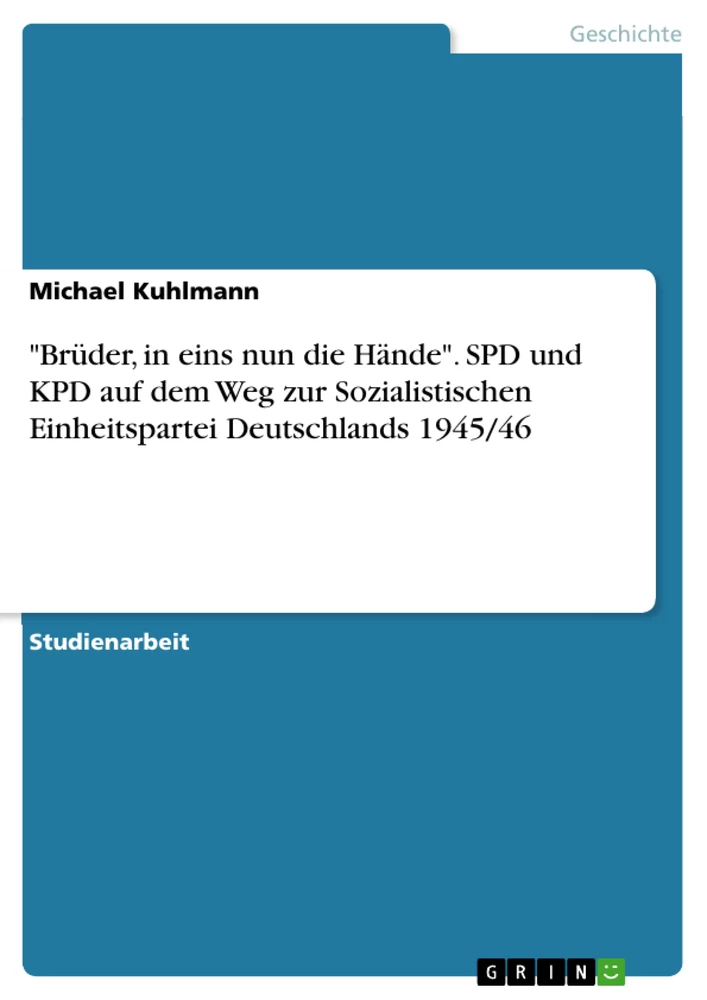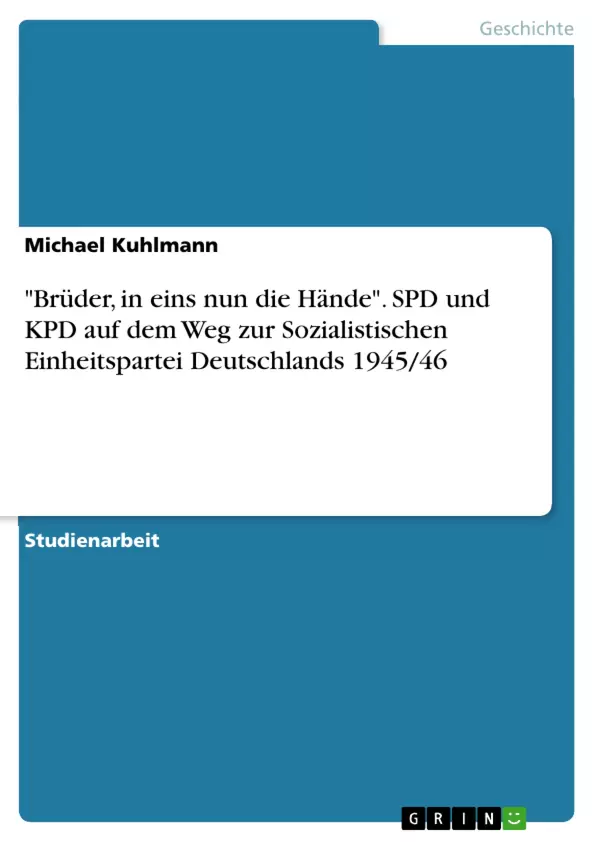"Damals habe ich die große Hoffnung gehabt, [...] die militante Kampfbereitschaft der Kommunisten würde sich mit den demokratischen Traditionen und demokratischen Umgangsformen der Sozialdemokraten zu einer neuen, besseren Linkspartei zusammenfassen. Damals, da ich viele Dinge nicht kannte, war ich optimistisch und habe mich damals dafür eingesetzt, aber schon sehr bald erkannt, daß meine Hoffnungen eine Illusion waren."
Gemeinsam mit einigen Hundert sozialdemokratischer und kommunistischer Delegierter hatte sich der junge Kommunist Wolfgang Leonhard am 21. April 1946 im Berliner Admiralspalast eingefunden, um einen entscheidenden Schritt ostdeutscher Nachkriegsgeschichte zu vollziehen: die Vereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Drei Jahrzehnte nach Ausbruch des Zwistes in der Sozialdemokratischen Partei schien die verhängnisvolle Spaltung endlich überwunden - wenn auch nur in einem Teil Deutschlands. Begleitet von großen Hoffnungen, aber auch von tiefer Besorgnis begann die SED ihre politische Arbeit, deren Resultate nicht nur den Idealisten Leonhard sehr bald enttäuschen sollten.
"Wat, schon wieder 'ne Partei? Ick hab noch von der vorigen die Neese voll!" Wer wie dieser Berliner in der Nachkriegswelt des Frühsommers 1945 Tag für Tag ums Überleben kämpfen mußte, zeigte für Parteigründungen wie diejenige der KPD kaum Interesse. Das politische Leben, das sich trotz Not und Kriegszerstörungen, trotz aller Überlebenssorgen bereits im Deutschland der ersten Nachkriegsmonate wieder entfaltete, beschränkte sich auf kleinere Kreise, war gleichwohl von hoher Intensität.
Die Arbeit befaßt sich mit der Politik von SPD und KPD in der Sowjetischen Besatzungszone, die elf Monate nach Kriegsende zur Verschmelzung beider Parteien führte. Wiewohl kaum umfassend zu beantworten, drängen sich doch immer wieder die Fragen auf, ob die KPD 1945/46 wirklich eine parlamentarische Demokratie anstrebte und ob der Akt von Ostern 1946 seitens der SPD ein freiwilliger Schritt war.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Vereinigung von SPD und KPD
- 1. Frühsommer 1945: Pluralistische Demokratie in der SBZ?
- 2. Das programmatische Rückgrat der KPD: Anton Ackermann und der „Besondere Deutsche Weg zum Sozialismus“
- 3. Sommer 1945: Die SPD drängt auf Vereinigung
- 4. Herbst 1945: Die Einheitkampagne der KPD beginnt
- 5. Wennigsen: Die SPD in Ost und West
- 6. Die Bemühungen der KPD fruchten: Die erste „Sechziger-Konferenz“
- 7. „Dreißig Jahre Bruderkampf finden in diesem Augenblick ihr Ende“: Der Parteitag vom 21./22. April 1946
- III. „Da war eine echte Begeisterung...“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die politischen Prozesse, die zur Vereinigung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im Jahr 1946 führten. Sie analysiert die politischen Ziele und Strategien beider Parteien in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und beleuchtet die Faktoren, die zur Verschmelzung führten.
- Die politische Situation in der SBZ nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die unterschiedlichen politischen Ziele und Programme von SPD und KPD
- Die Rolle der Sowjetischen Besatzungsmacht im Vereinigungsprozess
- Die Debatte um die Freiwilligkeit oder Zwangsvereinigung der Parteien
- Die Auswirkungen der SED-Gründung auf die weitere Entwicklung der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der SED-Gründung ein und beleuchtet die historische Bedeutung des Ereignisses. Sie stellt den Kontext der Nachkriegszeit und die unterschiedlichen Perspektiven auf die SED-Gründung dar.
Das zweite Kapitel analysiert die politische Situation in der SBZ im Frühsommer 1945. Es beschreibt die Ankunft der KPD-Funktionäre in der SBZ und ihre Bemühungen, Schlüsselpositionen zu besetzen. Es beleuchtet die unterschiedlichen Konzepte für die Politik im Nachkriegsdeutschland, die von der KPD entwickelt wurden.
Das dritte Kapitel fokussiert auf die Entwicklungen im Sommer 1945 und die wachsenden Spannungen zwischen SPD und KPD. Es diskutiert die politischen Ziele und Strategien beider Parteien und analysiert die Bemühungen der SPD, eine eigene politische Linie in der SBZ zu etablieren.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Einheitkampagne der KPD im Herbst 1945. Es beschreibt die strategischen Schritte der KPD, um die SPD zur Vereinigung zu bewegen, und die Rolle der sowjetischen Besatzungsmacht in diesem Prozess.
Das fünfte Kapitel behandelt die Wennigsen-Konferenz der SPD im Herbst 1945. Es analysiert die Diskussionen innerhalb der SPD über die politische Ausrichtung in der SBZ und die Frage der Vereinigung mit der KPD.
Das sechste Kapitel beschreibt die erste „Sechziger-Konferenz“ im Herbst 1945, die als wichtiger Schritt auf dem Weg zur SED-Gründung gilt. Es beleuchtet die Verhandlungen zwischen SPD und KPD und die Rolle der Sowjetischen Besatzungsmacht.
Das siebte Kapitel analysiert den Parteitag vom 21./22. April 1946, auf dem die Vereinigung von SPD und KPD zur SED beschlossen wurde. Es beleuchtet die politischen Hintergründe und die Debatten, die im Vorfeld des Parteitags geführt wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der Gründung der SED, der politischen Entwicklung in der SBZ nach dem Zweiten Weltkrieg, der Rolle der Sowjetischen Besatzungsmacht, den unterschiedlichen politischen Zielen und Strategien von SPD und KPD, der Debatte um die Freiwilligkeit oder Zwangsvereinigung der Parteien und den Auswirkungen der SED-Gründung auf die weitere Entwicklung der DDR.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die SED gegründet?
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) wurde am 21. und 22. April 1946 durch die Vereinigung von KPD und SPD in der Sowjetischen Besatzungszone gegründet.
War die Vereinigung von SPD und KPD freiwillig?
Dies ist historisch umstritten. Während es anfangs Bestrebungen zur Einheit gab, wurde der Prozess später massiv von der sowjetischen Besatzungsmacht forciert, was viele als Zwangsvereinigung betrachten.
Wer war Anton Ackermann und was war sein Konzept?
Anton Ackermann war ein KPD-Funktionär, der die Theorie vom „besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“ entwickelte, die eine friedlichere Entwicklung als in der Sowjetunion vorsah.
Welche Rolle spielte die Wennigsen-Konferenz?
Auf der Wennigsen-Konferenz im Oktober 1945 wurde die Spaltung zwischen der Ost-SPD (unter Grotewohl) und der West-SPD (unter Schumacher) hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der KPD deutlich.
Was war die "Sechziger-Konferenz"?
Die Sechziger-Konferenzen waren gemeinsame Sitzungen der Zentralausschüsse von SPD und KPD Ende 1945/Anfang 1946, um die organisatorische Verschmelzung vorzubereiten.
Wer ist Wolfgang Leonhard im Kontext dieser Arbeit?
Wolfgang Leonhard war ein junger KPD-Funktionär, dessen Zitate in der Arbeit verdeutlichen, wie die anfängliche Hoffnung auf eine demokratische Linkspartei bald der Enttäuschung wich.
- Quote paper
- Michael Kuhlmann (Author), 1997, "Brüder, in eins nun die Hände". SPD und KPD auf dem Weg zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 1945/46, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303212