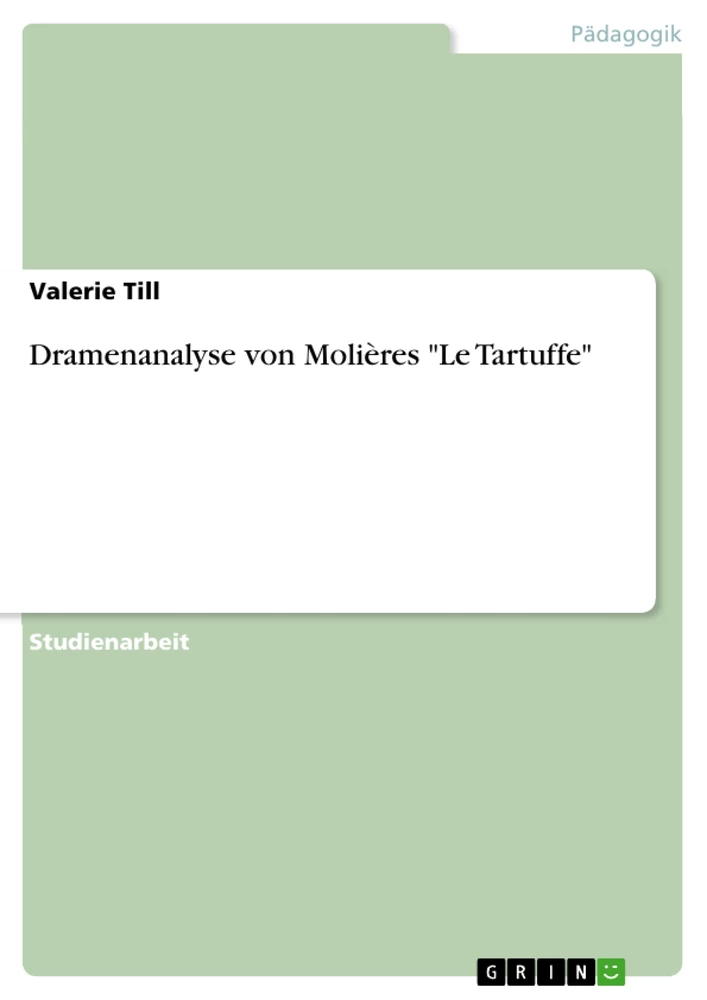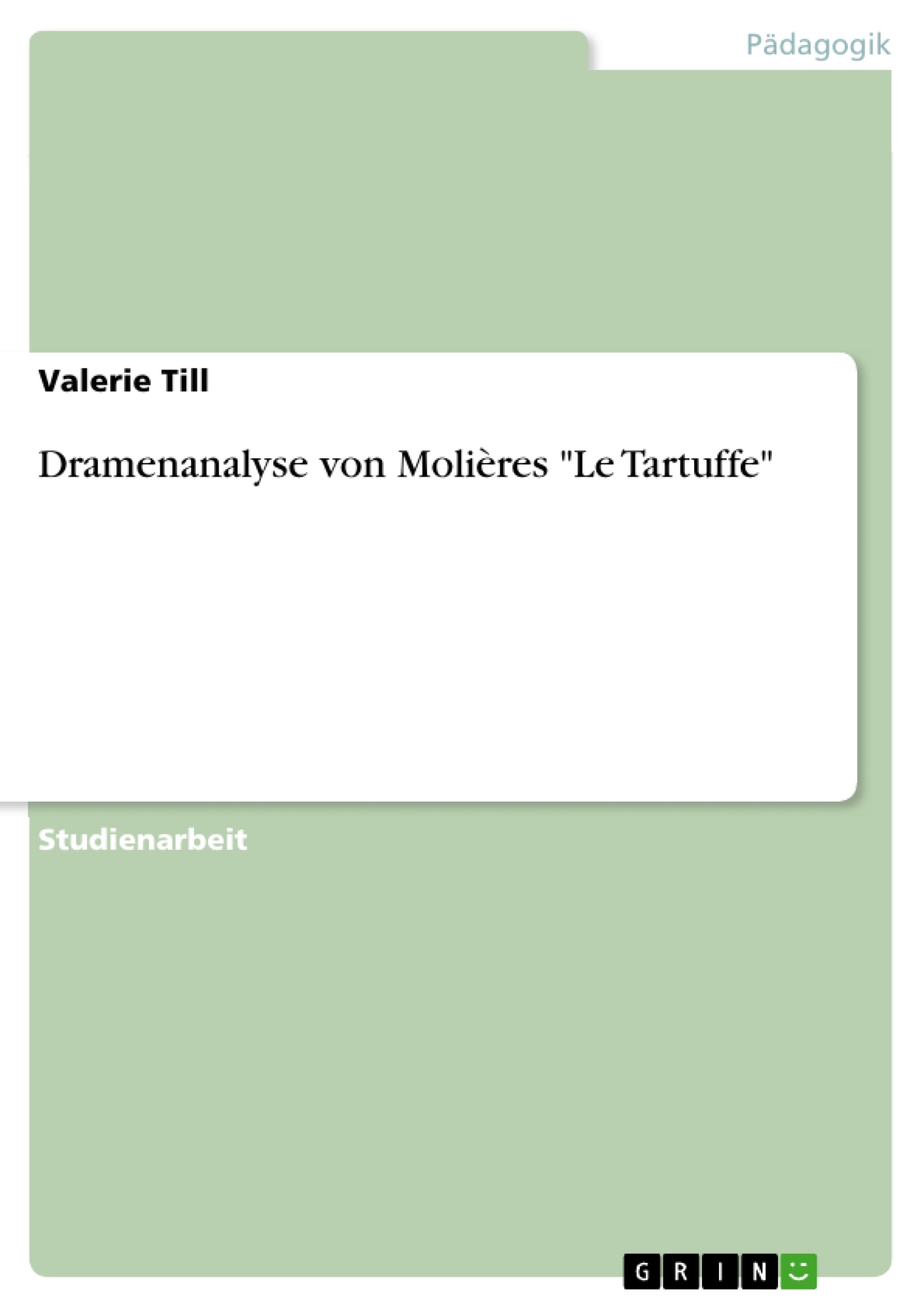In der vorliegenden Arbeit wird Molières Komödie ››Le Tartuffe ou l’Imposteur‹‹ analysiert. Zunächst wird ein Überblick über die Handlung und die Figuren erstellt. Hierfür dienen eine Figurenkonstellation und eine Personenkonfiguration. Des Weiteren wird geprüft, inwieweit Molière die damals geltenden Regelwerke akzeptierte.
Außerdem wird das Werk hinsichtlich der Gattungsmerkmale einer Komödie untersucht. Anschließend wird der Ablauf des Geschehens mithilfe eines Aktionsdreiecks näher betrachtet. Da dieses Drama zur Zeit der Veröffentlichung sehr umstritten war, wird auch der Bezug zur gesellschaftlichen und historischen Realität im 17. Jahrhundert näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Vorstellung des Werkes
- Figurenkonstellation
- Personenkonfiguration
- Akzeptanz der doctrine classique
- Gattungsmerkmale der Komödie
- Aktionsdreieck
- Bezug zur gesellschaftlichen und historischen Realität
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Molières Komödie „Le Tartuffe ou l'Imposteur“ und beleuchtet die Handlung, Figuren und die Einhaltung der klassischen Regeln. Des Weiteren wird die Komödie hinsichtlich ihrer Gattungsmerkmale und ihres Bezugs zur gesellschaftlichen Realität untersucht.
- Analyse der Figuren und ihrer Beziehungen zueinander
- Untersuchung des Einflusses von Tartuffe auf die Familie Orgon
- Bewertung der Einhaltung der Regeln der doctrine classique
- Einordnung der Komödie in das Genre der Komödie
- Bedeutung der gesellschaftlichen Kritik in Molières Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Arbeit bietet eine Einführung in die Analyse von Molières Komödie „Le Tartuffe ou l'Imposteur“. Sie erläutert den Gegenstand der Untersuchung und skizziert die wichtigsten Themenbereiche.
Vorstellung des Werkes
Dieses Kapitel präsentiert die Komödie „Le Tartuffe ou l'Imposteur“ und stellt die Handlung sowie die wichtigsten Figuren vor. Es wird auch auf die Zensur des Werkes und seine spätere Aufführung eingegangen.
Figurenkonstellation
Die Figurenkonstellation zeigt die Beziehungen zwischen den Figuren und ihre Positionen innerhalb der Handlung. Es werden die Gegenspieler von Tartuffe sowie seine Beziehung zu Orgon und seiner Familie beleuchtet.
Personenkonfiguration
Dieses Kapitel analysiert die Figuren anhand ihrer Rolle in der Handlung. Es wird der Protagonist Tartuffe, seine Antagonisten und konkomitante Figuren vorgestellt.
Akzeptanz der doctrine classique
Dieser Abschnitt untersucht, inwieweit Molière die Regeln der doctrine classique in seinem Werk einhält. Es werden die Regeln der Einheit der Handlung, der Zeit und des Ortes betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Arbeit sind: „Le Tartuffe ou l'Imposteur“, Molière, Komödie, doctrine classique, Figurenkonstellation, Personenkonfiguration, Heuchelei, Gesellschaftskritik, 17. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Molières Komödie „Le Tartuffe“?
Es geht um einen religiösen Heuchler (Tartuffe), der sich in die Familie von Orgon einschleicht, um diesen zu manipulieren und zu bestehlen.
Was ist die „doctrine classique“?
Ein Regelwerk des französischen Dramas des 17. Jahrhunderts, das die Einheiten von Ort, Zeit und Handlung vorschreibt.
Welche gesellschaftliche Kritik übt Molière in dem Werk?
Molière kritisiert die religiöse Heuchelei und die Leichtgläubigkeit des Bürgertums seiner Zeit.
Warum war das Drama zur Zeit seiner Veröffentlichung umstritten?
Kirchliche Kreise fühlten sich angegriffen, was zu einem zeitweiligen Aufführungsverbot durch König Ludwig XIV. führte.
Was zeigt die Figurenkonstellation in Tartuffe?
Sie verdeutlicht den Konflikt zwischen den vernünftigen Familienmitgliedern und der Verblendung Orgons durch Tartuffe.
- Quote paper
- Valerie Till (Author), 2013, Dramenanalyse von Molières "Le Tartuffe", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303224