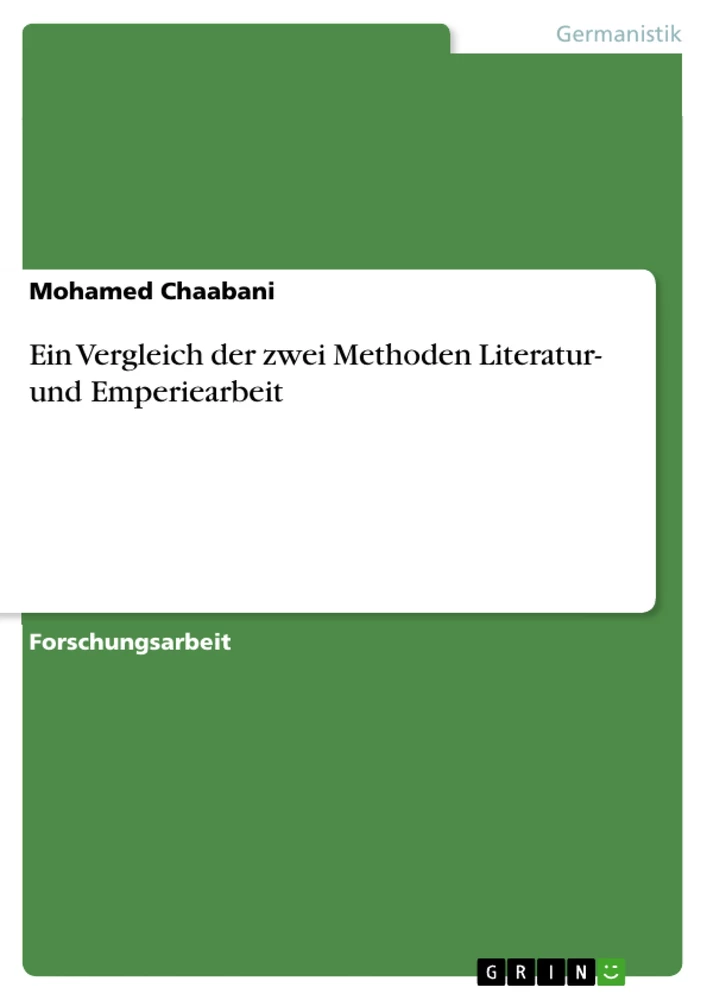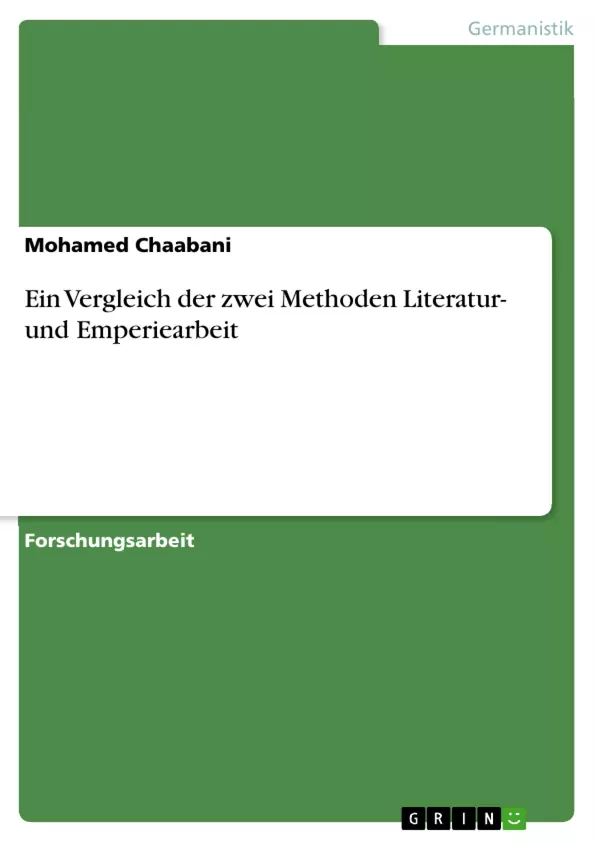Gegenstand der vorliegenden Forschungsarbeit ist ein Vergleich zwischen theoretischen und empirischen Arbeiten. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung richtet sich auf eine ausführliche Betrachtung von den Unterschieden zwischen den beiden wissenschaftlichen Arbeiten. Methodisch ist die vorliegende Arbeit zur Gegenüberstellung empirischer und theoretischer Arbeiten eher theoretisch angesiedelt. Die Arbeit soll ferner einen Beitrag zur Förderung von der wissenschaftlichen Schreibkompetenz bei den Studierenden im Fremdsprachenunterricht leisten.
Die Entscheidung über eine Literaturarbeit oder eine empirische Untersuchung hängt von der Forschungsfrage oder dem Fachbereich ab. Die Biologie z.B. bezieht sich auf Beobachtungen. Die Sozialwissenschaft dagegen arbeitet häufig mit Befragungen. In den beiden empirischen und theoretischen Arbeiten wird der Forschungsstand rekonstruiert und diskutiert. Im Folgenden wird laut Karmasin, Matthias, Ribing, Rainer (2006, 83) der Unterschied zwischen diesen beiden Arbeiten gezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Literaturarbeit versus Empiriearbeit
- Methoden bei empirischen und literarischen Arbeiten
- Methoden bei theoretischen Arbeiten
- Methoden bei empirischen Arbeiten
- Diskussion in empirischen und literarischen Arbeiten
- Diskussionen in empirischen Studien
- Diskussionen in Literaturarbeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht theoretische und empirische Forschungsarbeiten. Das Hauptziel ist die detaillierte Darstellung der Unterschiede zwischen beiden Ansätzen und die damit verbundene Förderung wissenschaftlicher Schreibkompetenz bei Studierenden im Fremdsprachenunterricht. Die Arbeit konzentriert sich auf methodologische Aspekte und die Struktur der jeweiligen Arbeiten.
- Unterschiede zwischen Literatur- und Empiriearbeit
- Methodische Vorgehensweisen in theoretischen und empirischen Arbeiten
- Struktur und Aufbau von Diskussionen in beiden Arbeitstypen
- Der Stellenwert der Theorie in empirischen Untersuchungen
- Der Umfang des Literaturstudiums in theoretischen und empirischen Arbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Literaturarbeit versus Empiriearbeit: Dieses Kapitel untersucht die Entscheidungsgrundlagen für die Wahl zwischen einer Literaturarbeit und einer empirischen Studie. Es wird hervorgehoben, dass die Forschungsfrage und der jeweilige Fachbereich die Wahl beeinflussen. Beispiele aus der Biologie (Beobachtung) und der Sozialwissenschaft (Befragung) verdeutlichen die unterschiedlichen Ansätze. Das Kapitel betont die gemeinsame Notwendigkeit, den Forschungsstand in beiden Arten von Arbeiten zu rekonstruieren und zu diskutieren, wobei der Unterschied zwischen den beiden Herangehensweisen herausgestellt wird. Der Bezug auf Karmasin, Matthias, Ribing, Rainer (2006) untermauert die Argumentation.
Methoden bei empirischen und literarischen Arbeiten: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Methoden, die in theoretischen und empirischen Arbeiten zum Einsatz kommen. Es beschreibt die Unterschiede in der Vorgehensweise, von der Formulierung der Forschungsfrage bis zur Auswertung der Ergebnisse und der Schlussfolgerungen. Der Schwerpunkt liegt auf der systematischen Gegenüberstellung der Methoden, um ein umfassendes Verständnis für die jeweiligen Anforderungen zu vermitteln. Das Kapitel analysiert sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze und deren spezifischen Einsatz.
Diskussion in empirischen und literarischen Arbeiten: Dieses Kapitel vergleicht die Diskussionen in empirischen und Literaturarbeiten. Es beleuchtet den Unterschied im Fokus und in der Argumentation, basierend auf den jeweiligen methodischen Ansätzen. In empirischen Studien konzentriert sich die Diskussion auf die Interpretation der Ergebnisse und deren Implikationen, während Literaturarbeiten die verschiedenen Positionen und Perspektiven im Forschungsfeld aufgreifen und bewerten. Das Kapitel betont die Bedeutung der kritischen Reflexion und den Stellenwert der Auseinandersetzung mit bestehenden Forschungslücken in beiden Arten von Arbeiten.
Schlüsselwörter
Literaturarbeit, Empiriearbeit, Methodenvergleich, wissenschaftliches Schreiben, Forschungsmethoden, qualitative Methoden, quantitative Methoden, Diskussion, Forschungsstand, Hypothese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Vergleich theoretischer und empirischer Forschungsarbeiten
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über den Vergleich theoretischer (Literatur-) und empirischer Forschungsarbeiten. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den methodologischen Unterschieden und dem Aufbau beider Arten von Arbeiten, um die wissenschaftliche Schreibkompetenz von Studierenden zu verbessern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Unterschiede zwischen Literatur- und Empiriearbeit, methodische Vorgehensweisen in beiden Ansätzen (inklusive qualitativer und quantitativer Methoden), Aufbau und Struktur von Diskussionen in theoretischen und empirischen Arbeiten, den Stellenwert der Theorie in empirischen Untersuchungen und den Umfang des Literaturstudiums in beiden Arbeitstypen.
Wie werden Literatur- und Empiriearbeit unterschieden?
Die Arbeit erläutert, dass die Wahl zwischen Literaturarbeit und empirischer Studie von der Forschungsfrage und dem Fachbereich abhängt. Beispiele aus Biologie und Sozialwissenschaft veranschaulichen die unterschiedlichen Ansätze. Obwohl beide Arten von Arbeiten den Forschungsstand rekonstruieren und diskutieren müssen, unterscheidet sich die Herangehensweise deutlich. Die Entscheidungskriterien werden detailliert untersucht.
Welche Methoden werden in den verschiedenen Arbeitstypen verwendet?
Das Kapitel zu den Methoden beschreibt die Unterschiede in der Vorgehensweise, von der Forschungsfrage bis zur Ergebnisinterpretation und Schlussfolgerung. Es werden sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze systematisch gegenübergestellt, um ein umfassendes Verständnis der jeweiligen Anforderungen zu vermitteln.
Wie unterscheiden sich die Diskussionen in Literatur- und Empiriearbeiten?
Empirische Studien konzentrieren sich in der Diskussion auf die Interpretation der Ergebnisse und deren Implikationen. Literaturarbeiten hingegen greifen verschiedene Positionen und Perspektiven im Forschungsfeld auf und bewerten diese. Die Bedeutung der kritischen Reflexion und der Auseinandersetzung mit Forschungslücken wird in beiden Arbeitstypen hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literaturarbeit, Empiriearbeit, Methodenvergleich, wissenschaftliches Schreiben, Forschungsmethoden, qualitative Methoden, quantitative Methoden, Diskussion, Forschungsstand, Hypothese.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Hauptziel ist die detaillierte Darstellung der Unterschiede zwischen theoretischen und empirischen Forschungsarbeiten und die damit verbundene Förderung der wissenschaftlichen Schreibkompetenz bei Studierenden im Fremdsprachenunterricht. Der Fokus liegt auf den methodologischen Aspekten und der Struktur der jeweiligen Arbeiten.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich in erster Linie an Studierende im Fremdsprachenunterricht, die ihre wissenschaftliche Schreibkompetenz verbessern möchten. Sie ist jedoch auch für alle anderen Leser relevant, die sich mit dem Vergleich und den Unterschieden zwischen theoretischen und empirischen Forschungsarbeiten auseinandersetzen möchten.
- Quote paper
- Mag. Mohamed Chaabani (Author), 2015, Ein Vergleich der zwei Methoden Literatur- und Emperiearbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303254