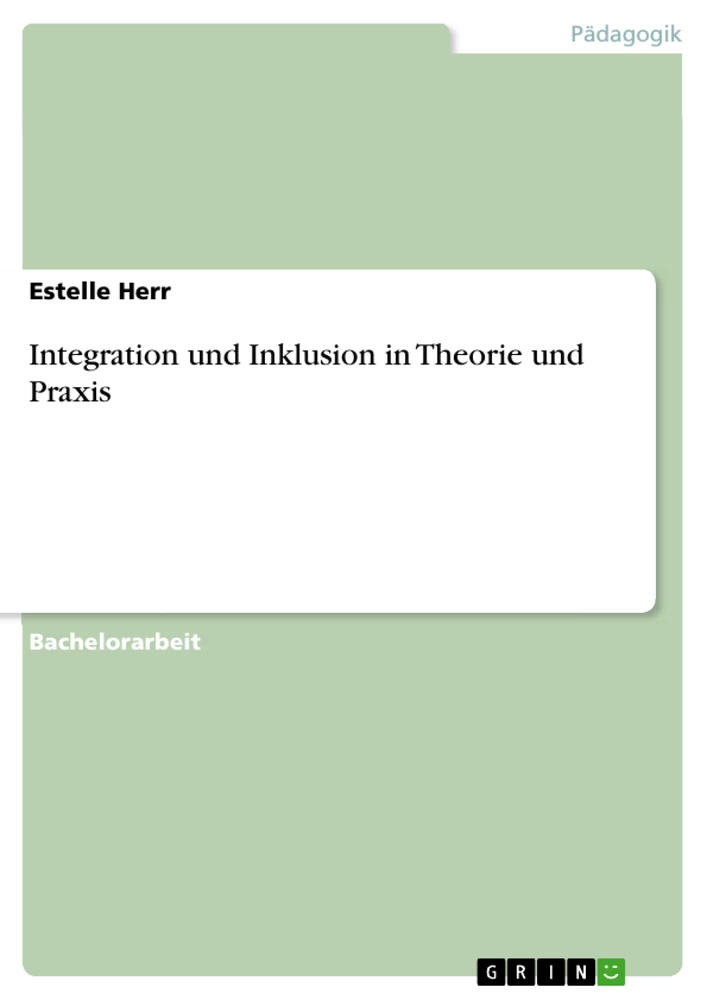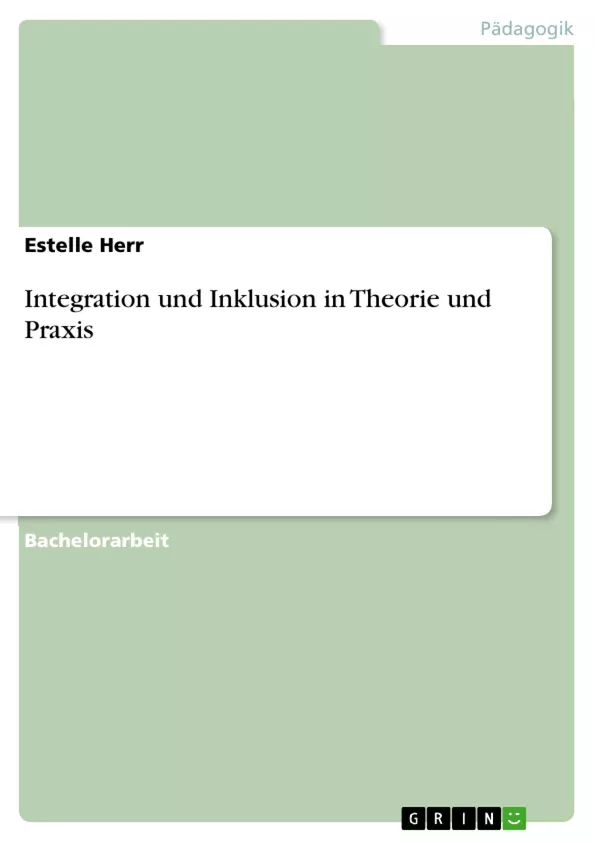Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz dieser Konzepte in Schule und Unterricht am Beispiel einer integrierten Gesamtschule in Rheinlandpfalz und gliedert sich in einen Theorie- und einen Praxisteil.
Der theoretische Teil der Arbeit beginnt mit der Darstellung des Spannungsfeldes der beiden Termini. Danach folgt ein Blick auf die Entstehung und Entwicklung jener Begriffe. Anschließend wird ein Definitionsversuch unternommen mit Bezug auf die Umsetzung im schulischen Kontext, welchem sich eine Vorstellung verschiedener Kritikpunkte anschließt. Daran anknüpfend wird der rechtliche Rahmen der Konzepte betrachtet, ausgehend vom Internationalen bis zum Bundesland Rheinland-Pfalz. Danach wird der Forschungsstand erläutert und am Ende des theoretischen Teils das Forschungsinteresse und die Fragestellung verdeutlicht. Der praktische Teil gliedert sich zunächst in die methodischen Überlegungen bezüglich des verwendeten Forschungsdesigns, der Erhebungsmethode, des Untersuchungsinstrumentes, in diesem Fall Experteninterviews, der Konstruktion der verwendeten Befragung, der Durchführung eben dieser, sowie eine Zusammenfassung des Transkripts. Des Weiteren werden die Experteninterviews ausgewertet und analysiert, indem zuerst die vorliegenden Daten dargestellt und im Anschluss, in Kategorien unterteilt, interpretiert werden. Das Ende des praktischen Teils bildet eine zusammenfassende Diskussion über die erhaltenen Daten mithilfe eines Rückbezugs auf den theoretischen Teil der Arbeit. Abschließend wird ein Fazit herausgearbeitet und ein Ausblick auf die Forschung und den Einsatz der Konzepte „Integration“ und „Inklusion“ gegeben
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten der Konzepte
- Problemstellung
- Das Konzept „Integration“
- Entstehung und Entwicklung
- Definitionsversuch
- Umsetzung
- Kritik am Konzept
- Das Konzept „Inklusion“
- Entstehung und Entwicklung
- Definitionsversuch
- Umsetzung
- Kritik am Konzept
- Rechtlicher Rahmen
- International
- Die Gesetzeslage in Deutschland
- Das Bundesland Rheinland-Pfalz
- Forschungsstand
- Forschungsinteresse und Fragestellung
- Methodische Überlegungen
- Forschungsdesign
- Erhebungsmethode
- Untersuchungsinstrument
- Konstruktion der Befragung
- Durchführung
- Transkript
- Auswertung
- Auswertung und Interpretation der Interviews
- Datendarstellung
- Analyse
- „Dass es keine Ausgrenzung gibt“
- „Ein radikaler Umbau“
- „Das komplette Paket eben“
- „Zum Teil differenzierte Sachen“
- „Nicht für alle den gleichen Arbeitsauftrag“
- „Wir haben hier ja unsere Förderlehrer“
- „Das war nie ein Thema“
- „Ein sehr positives Fazit“
- „Man merkt in der Klassengemeinschaft nicht wer ein Gutachten hat“
- „Man weiß es nicht“
- „Durchgehend doppelt besetzen“
- „Noch eine Stufe weiter“
- Zusammenfassende Interpretation
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Anwendung der Konzepte „Integration“ und „Inklusion“ im schulischen Kontext anhand einer integrierten Gesamtschule in Rheinland-Pfalz. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte im Hinblick auf ihre praktische Umsetzung in der Schule und im Unterricht zu untersuchen.
- Entwicklung und Wandel der Konzepte „Integration“ und „Inklusion“
- Rechtlicher Rahmen und Bedeutung der Inklusion
- Praktische Umsetzung der Konzepte im schulischen Alltag
- Herausforderungen und Chancen der Inklusion im Unterricht
- Erfahrungen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern mit Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Erläuterung der beiden Konzepte „Integration“ und „Inklusion“, wobei auf ihre Entstehung, Definition und praktische Umsetzung eingegangen wird. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Spannungsfeld zwischen den Begriffen und den verschiedenen Kritikpunkten. Es wird daraufhin der rechtliche Rahmen der Konzepte beleuchtet, von der internationalen Ebene bis hin zum Bundesland Rheinland-Pfalz. Im Anschluss folgt eine Vorstellung des Forschungsinteresses und der Fragestellung der Arbeit. Der praktische Teil beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der methodischen Vorgehensweise, einschließlich Forschungsdesign, Erhebungsmethode und Auswertung der Daten. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Experteninterviews, die Einblicke in die Praxis der Inklusion in der untersuchten Gesamtschule in Rheinland-Pfalz liefern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Konzepten „Integration“ und „Inklusion“ im schulischen Kontext. Im Fokus stehen dabei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte, der rechtliche Rahmen der Inklusion, sowie die praktische Umsetzung in der Schule und im Unterricht. Die Arbeit analysiert die Erfahrungen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern mit Inklusion und erörtert die Herausforderungen und Chancen des inklusiven Bildungssystems.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration zielt darauf ab, Menschen mit Förderbedarf in ein bestehendes System einzugliedern. Inklusion geht weiter und fordert einen radikalen Umbau des Systems, sodass die Struktur von vornherein auf die Vielfalt aller Individuen ausgerichtet ist.
Wie sieht der rechtliche Rahmen für Inklusion aus?
Die Grundlage bildet die UN-Behindertenrechtskonvention auf internationaler Ebene, die in Deutschland durch Bundesgesetze und landesspezifische Regelungen (z.B. in Rheinland-Pfalz) umgesetzt wird.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung im Unterricht?
Lehrkräfte nennen oft den Bedarf an Doppelbesetzungen durch Förderlehrer, die Notwendigkeit differenzierter Arbeitsaufträge und den baulichen sowie strukturellen Umbau der Schulen.
Was sagen Experteninterviews über die Praxis an Gesamtschulen aus?
Die Interviews zeigen ein positives Fazit: In einer guten Klassengemeinschaft ist oft nicht mehr erkennbar, wer ein Gutachten hat. Dennoch wird betont, dass Inklusion ein kontinuierlicher Prozess ist.
Warum wird Kritik am Konzept der Integration geübt?
Kritiker argumentieren, dass Integration oft eine Zwei-Gruppen-Theorie (behindert vs. nicht-behindert) aufrechterhält, anstatt die Individualität jedes Schülers als Normalität zu betrachten.
- Quote paper
- Estelle Herr (Author), 2014, Integration und Inklusion in Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303339