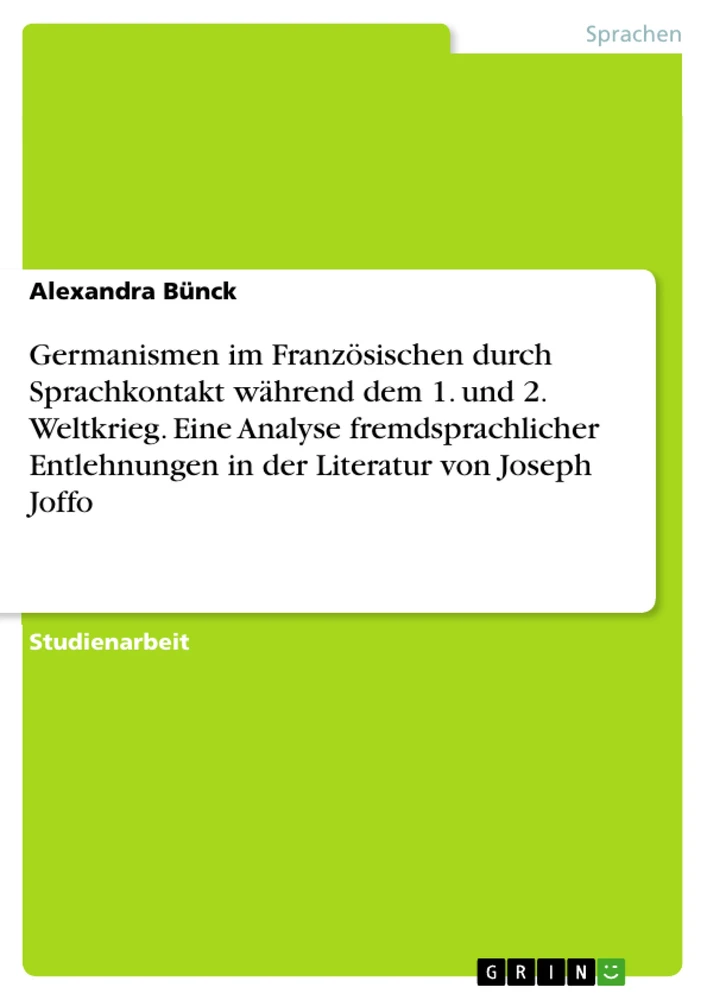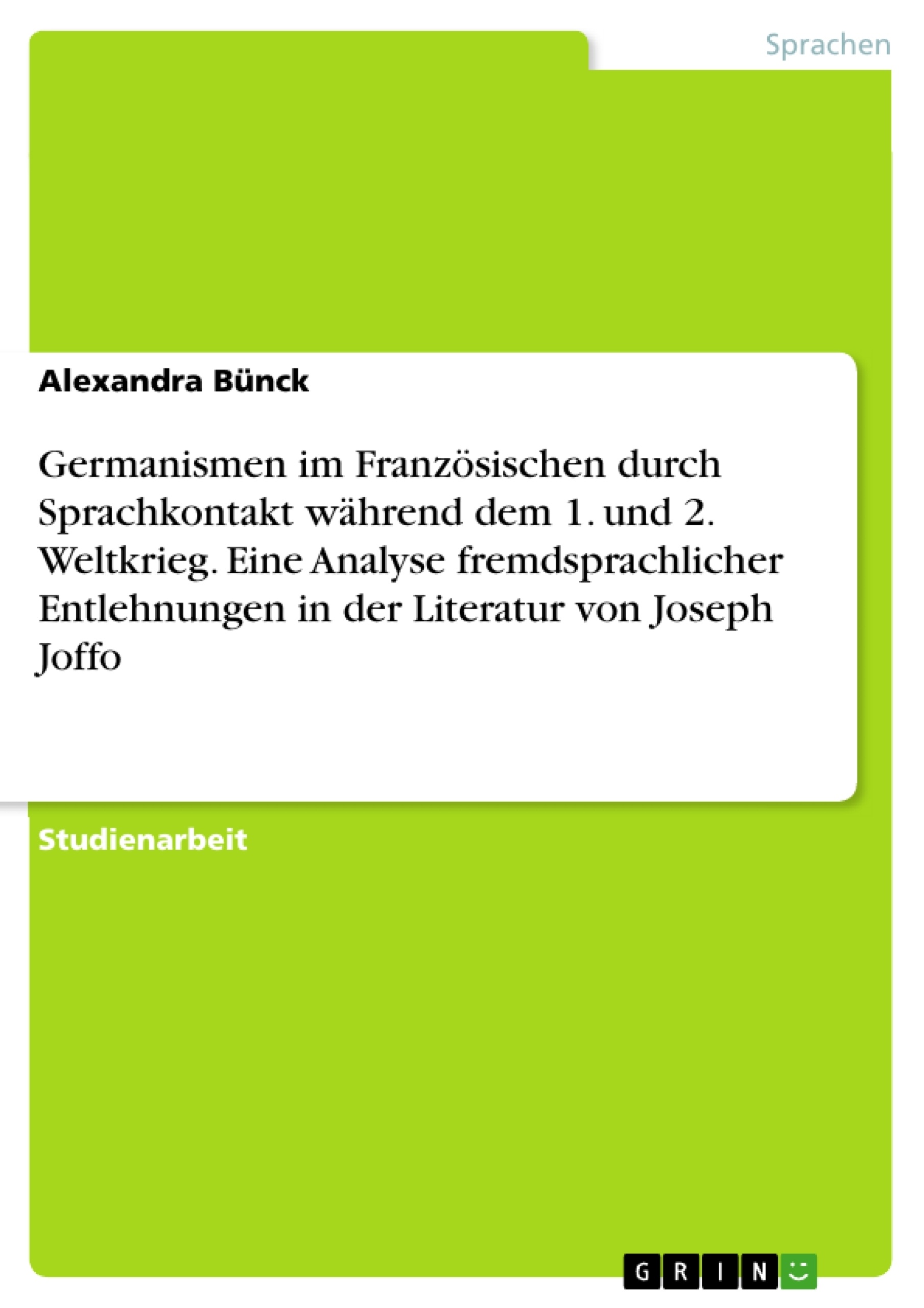Beim dem Lesen des Romans "La Jeune Fille au pair" entstand die Idee, den deutschen Sprachkontakt in Frankreich während der beiden Weltkriege zu untersuchen. Aufgrund dieses umfangreichen Themas beschränkt und spezialisiert sich diese Hausarbeit auf deutsche Entlehnungen aus der Literatur von Joseph Joffo. Ziel der Hausarbeit ist, aufzudecken, welche deutschen Entlehnungen während der beiden Weltkriege in die französische Sprache gelangt sind.
Eine der wichtigsten Hauptquellen ist das Buch "La Langue allemande en France: De 1830 à nos jours" von Paul Lévy. Dieses Werk wurde ausgewählt, weil der Autor ein wichtiger Zeitzeuge ist und den für diese Hausarbeit wesentlichen Zeitraum persönlich erlebt hat. Sprachwissenschaftliche Definitionen stammen aus unterschiedlichen Lexika.
Exemplarische Beispiele stammen aus Lévys Werk oder aus Joseph Joffos Werken "Un sac de billes" und "La Jeune Fille au pair". Ersteres ist seine autobiografische Erzählung, in der er berichtet, wie er als Jude im Alter von zehn Jahren mit seinem Bruder vor den Nationalsozialisten geflüchtet ist. Letzteres handelt von einem jungen Au-pair-Mädchen, welches auf der Suche nach dem Schicksal ihrer Eltern, unter dem Vorwand die französische Sprache zu erlernen, zu einer jüdischen Familie zieht.
Als Grundbaustein der Hausarbeit beginnt Kapitel 1 mit den Definitionen der Termini Sprachkontakt, Entlehnungen, Lehnwort und Lehnprägung. Anschließend werden der Sprachkontakt und die Sprachpolitik in Frankreich während der beiden Weltkriege in Kapitel 2 vorgestellt. Der behandelte Zeitraum wird in Erster Weltkrieg, Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg unterteilt. In Kapitel 3 folgt eine Auflistung, Kategorisierung und Analyse deutscher Entlehnungen aus den Werken "La Jeune Fille au pair" und "Un sac de billes" von Joseph Joffo. Im Schlussteil gibt es noch ein kurzes Resümee der Arbeit. Die Arbeit endet mit einem Ausblick inklusive einer eigenständig angefertigten Umfrage zum persönlichen Bekanntheitsgrad von den Entlehnungen aus der Literatur von Joseph Joffo anhand von französischsprachigen Muttersprachlern als Probanden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definitionen
- 1.1 Sprachkontakt
- 1.2 Entlehnungen
- 2. Sprachkontakt und Sprachpolitik in Frankreich während der ersten beiden Weltkriege
- 2.1 Erster Weltkrieg
- 2.2 Zwischenkriegszeit
- 2.3 Zweiter Weltkrieg
- 3. Fremdsprachliche Entlehnungen aus dem Deutschen in der Literatur von Joseph Joffo inklusive Analyse
- 3.1 La Jeune Fille au pair
- 3.2 Un sac de billes
- 3.3 Deskriptive Analyse der Umfrageergebnisse
- Schlussteil
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den deutschen Sprachkontakt in Frankreich während der beiden Weltkriege, speziell im Hinblick auf deutsche Entlehnungen in der Literatur von Joseph Joffo. Das Ziel ist es, diese Entlehnungen aufzudecken und zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der Erforschung der linguistischen Phänomene des Sprachkontakts und der damit verbundenen sprachpolitischen Aspekte.
- Sprachkontakt und Sprachpolitik in Frankreich während der beiden Weltkriege
- Analyse deutscher Entlehnungen in der französischen Literatur von Joseph Joffo
- Identifizierung der Sprachkontaktsituation im Zusammenhang mit deutschen Entlehnungen
- Untersuchung der Auswirkungen von Sprachpolitik auf die Integration von Fremdwörtern
- Bedeutung des Sprachwandels durch Sprachkontakt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Arbeit definiert die Schlüsselbegriffe "Sprachkontakt" und "Entlehnungen". Es werden verschiedene Arten von Entlehnungen, wie Lehnwort und Lehnprägung, erläutert. Das zweite Kapitel beleuchtet den Sprachkontakt und die Sprachpolitik in Frankreich während der beiden Weltkriege. Es betrachtet den Zeitraum, der in Erster Weltkrieg, Zwischenkriegszeit und Zweiter Weltkrieg unterteilt ist. Das dritte Kapitel beinhaltet eine Auflistung, Kategorisierung und Analyse deutscher Entlehnungen aus den Werken von Joseph Joffo, "La Jeune Fille au pair" und "Un sac de billes". Die Arbeit endet mit einem kurzen Resümee und einem Ausblick.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Sprachkontakt und Sprachpolitik in Frankreich während der beiden Weltkriege, insbesondere mit deutschen Entlehnungen in der Literatur von Joseph Joffo. Wichtige Schlüsselwörter sind: Sprachkontakt, Sprachpolitik, Entlehnungen, Lehnwort, Lehnprägung, Fremdsprachige Entlehnungen, Französisch, Deutsch, Joseph Joffo, La Jeune Fille au pair, Un sac de billes.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussten die Weltkriege die französische Sprache?
Durch den intensiven Sprachkontakt während der Besatzungszeiten und der militärischen Auseinandersetzungen gelangten zahlreiche deutsche Wörter als Entlehnungen in das Französische.
Welche Rolle spielt die Literatur von Joseph Joffo in dieser Analyse?
Die Arbeit analysiert deutsche Entlehnungen in Joffos Werken wie „Un sac de billes“, um aufzuzeigen, wie diese Begriffe literarisch verarbeitet wurden und welche Zeitzeugnisse sie darstellen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Lehnwort und einer Lehnprägung?
Ein Lehnwort wird in seiner äußeren Form übernommen, während bei einer Lehnprägung ein fremder Begriff mit den Mitteln der eigenen Sprache nachgebildet wird.
Welche Bedeutung hat Paul Lévy für diese Forschung?
Lévys Werk „La Langue allemande en France“ dient als Hauptquelle, da er als Zeitzeuge die sprachlichen Veränderungen durch den deutschen Kontakt ab 1830 detailliert dokumentiert hat.
Sind die deutschen Entlehnungen heute noch im Französischen gebräuchlich?
Die Arbeit enthält eine Umfrage unter Muttersprachlern, die den aktuellen Bekanntheitsgrad dieser Germanismen untersucht und zeigt, welche Begriffe im kollektiven Gedächtnis geblieben sind.
- Quote paper
- Alexandra Bünck (Author), 2013, Germanismen im Französischen durch Sprachkontakt während dem 1. und 2. Weltkrieg. Eine Analyse fremdsprachlicher Entlehnungen in der Literatur von Joseph Joffo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303479