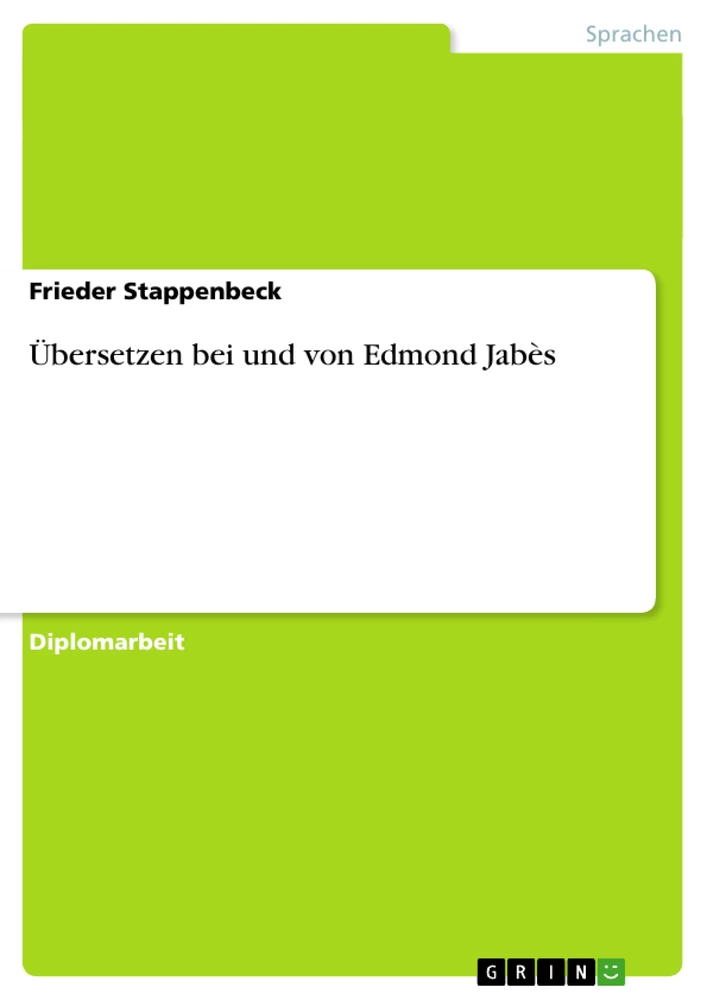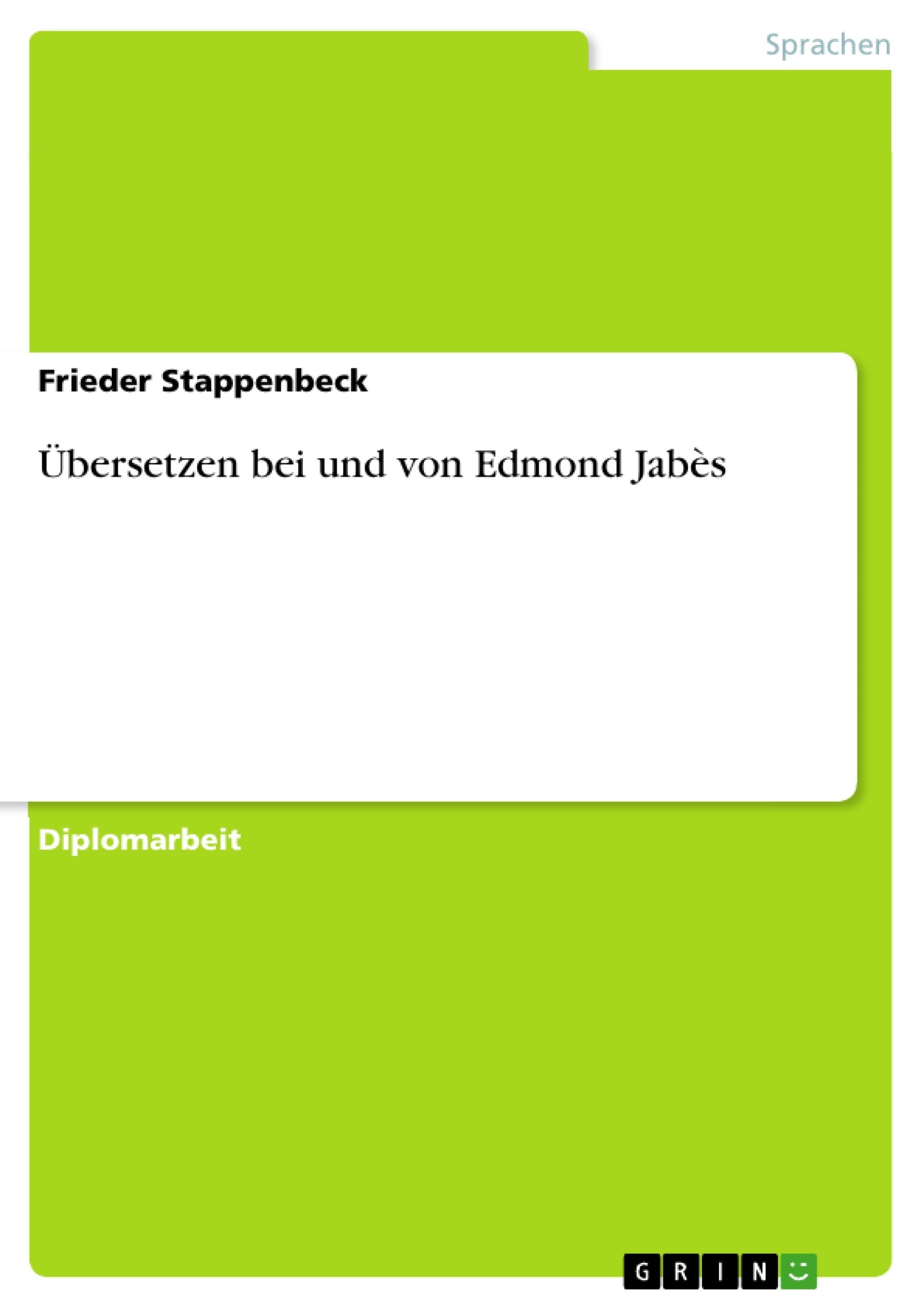Edmond Jabès fristet in der deutschsprachigen Rezeption noch immer ein arg schattiges Dasein, was verwunderlich ist angesichts der Fülle, Dichte und Sprachgewalt der Fragen, die er über die Schrift und ihre Beziehungen zu Schriftsteller, Leser und Gott aufwirft.
Es handelt sich bei seinen Büchern weder um Lyrik noch um reine Prosa philosophischer, theologischer oder mystischer Natur, noch um psychoanalytische Essays. Jabès‘ Schriften haben weder Anfang noch Abschluß, sie sind vielmehr als ein einziger, von allerlei Brüchen gezeichneter Text zu lesen. Aus der Not seiner Unklassifizierbarkeit heraus und dem Bemühen, der Kohärenz aller Jabès-Bücher Rechnung zu tragen, fand der Begriff "texte-Jabès" Verbreitung.
Scheint dieser Jabèstext im Vergleich zur neuzeitlichen Literatur seinesgleichen zu suchen, zeigt sich deutlich die Anlehnung an die Tradition jüdischer Kommentarliteratur. Für den aus Ägypten stammenden Jabès ist das Judentum ein strukturelles Vorbild. Die formalen Merkmale des jabesianischen Buches stimmen weitgehend mit denen des Talmud überein: Beide kennzeichnet zum Beispiel das Prinzip des Kreisens - das heißt, auf der Ebene des Textausschnitts: um ein bestimmtes Motiv kreisen Fragen, Dialoge, Kommentare; auf der Ebene des Gesamttextes: bestimmte Motive werden immer wieder aufgegriffen und variiert. Urjüdisch sind auch das Prinzip des Fragens und die Tradition der Buchstabenneukombination.
Doch charakterisiert sich der Jabèstext auch durch seinen Posttheismus, durch die Infragestellung der Beziehung von Schrift, Autor, Leser und verstummtem Gott. Hier setzt diese Untersuchung an: Anhand Jabès‘ Reflexionen hierüber soll jenes uralte Problem freigefräst werden: das Verhältnis vom Unsichtbaren und Virulenten zum Sichtbaren und Realisierten, hinführend zum Gegensatzpaar Freiheit und Vorbestimmtheit. Dabei geht es immer um die Beziehung zwischen zwei Seiten, die ewig unlösbare Aufgabe, etwas über eine Schwelle überzusetzen. Und auf dieser tiefstmöglichen Grundbedeutung des Wortes Übersetzen sei dieser Aufsatz aufgebaut: Jabès‘ poetologische Gedankenfülle soll in einer möglichst weiten Assoziationsspanne auf dieses Wort hin untersucht werden unter dem Eindruck, daß das jabesianische Buch selbst bereits nichts weiter ist als eine: Übersetzung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Jabèstext
- 1.1. Zur Methodik dieser Arbeit und zur Struktur des Jabèstextes
- 1.2. Hermeneutische und poetologische Überlegungen
- 2. Die Echos mystiques
- 2.1. Die jüdische Mystik: Abulafia, der Sohar, Luria
- 2.2. Der talmudische Topos der weißen und schwarzen Schrift
- 3. Der Jabèstext selbst als Übersetzung
- 3.1. Parenté - La part entée
- 3.2. Der Punkt
- 3.3. Faire table rase - Le Livre brûlé
- 3.4. Der Weiße Schrift-Topos im Kontext des Übersetzens
- 3.5. Die Aufgabe des Autors
- 3.6. Die Schlüsselwörter rupture und brisure
- 3.7. Die Schlüsselwörter subversion und absence
- 3.8. Die wichtigsten Wortbefragungen
- 4. Zur Übersetzung des Jabèstextes in andere Sprachen
- 4.1. Die Aufgabe des Übersetzers
- 4.2. Das Wort Dieu und seine Variationen
- 4.3. Weiteres zur Subversion
- 4.4. L'étranger
- 4.5. Das Schlüsselwort silence
- 4.6. Beispiele aus deutschen und spanischen Übersetzungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Werk von Edmond Jabès und dessen Verhältnis zum Thema Übersetzung. Ziel ist es, Jabès' poetologische Gedankenwelt im Kontext des Übersetzens zu analysieren und die These zu belegen, dass der Jabèstext selbst als Übersetzung verstanden werden kann. Die Arbeit betrachtet dabei verschiedene Aspekte, von der Struktur des Jabèstextes bis hin zu konkreten Übersetzungsbeispielen in verschiedene Sprachen.
- Die Struktur und Methodik des Jabèstextes
- Die Beziehung zwischen Autor, Text und Leser bei Jabès
- Der Einfluss jüdischer Mystik und Tradition auf Jabès' Werk
- Der Jabèstext als Übersetzungsprozess
- Herausforderungen und Strategien der Übersetzung von Jabès' Texten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Jabèstext: Dieses Kapitel legt die methodischen Grundlagen der Arbeit und analysiert die Struktur des Jabèstextes. Es behandelt die Rezeption Jabès' Werkes, die methodischen Ansätze der Arbeit, die Verwurzelung Jabès im Judentum und die strukturelle Vielfalt seiner Texte. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Prinzip der „quoibilité“, dem Verhältnis von Autor, Buch und Leser sowie der Poetologie des Buches gewidmet. Schlüsselbegriffe wie „Schreiben nach der Schoa“ werden eingeführt und in ihrem Kontext erläutert, um die spezifische Schreibweise und die Thematik von Jabès' Werk einzuführen und zu kontextualisieren.
2. Die Echos mystiques: Dieses Kapitel beleuchtet die Einflüsse jüdischer Mystik auf das Werk von Jabès. Es untersucht den Begriff der Kabbala und die Bedeutung von Abraham Abulafia, dem Sohar und Isaak Luria. Der talmudische Topos der weißen und schwarzen Schrift wird eingehend analysiert, um den spezifischen Umgang Jabès' mit Sprache und Schrift zu verstehen. Die Kapitel veranschaulicht die tiefe Verwurzelung von Jabès' Werk in der jüdischen Tradition und seine Auseinandersetzung mit zentralen Konzepten der jüdischen Mystik.
3. Der Jabèstext selbst als Übersetzung: Dieses Kapitel erörtert die zentrale These der Arbeit, dass der Jabèstext selbst als Übersetzungsprozess zu verstehen ist. Es analysiert Schlüsselbegriffe wie „rupture“ und „brisure“, „subversion“ und „absence“, und untersucht den Einsatz von Wortwiederholungen und -veränderungen, um die Übersetzungsprozesse innerhalb des Textes zu verdeutlichen. Es werden konkrete Beispiele aus Jabès’ Werk herangezogen, um die These zu untermauern und die Bedeutung dieser Übersetzungsprozesse für das Verständnis des Jabèstextes zu belegen.
4. Zur Übersetzung des Jabèstextes in andere Sprachen: Dieses Kapitel widmet sich der Übersetzungspraxis des Jabèstextes. Es untersucht die Aufgabe des Übersetzers im Umgang mit den spezifischen Herausforderungen des jabesianischen Schreibstils, beleuchtet die Schwierigkeit der Übersetzung des Wortes „Dieu“ und seiner Variationen und analysiert weitere Aspekte der „Subversion“ im Kontext der Übersetzung. Es werden konkrete Beispiele aus deutschen und spanischen Übersetzungen angeführt und eine eigene Teilübersetzung präsentiert, um verschiedene Übersetzungsstrategien zu diskutieren und zu bewerten. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Übersetzung des Jabèstextes ergeben.
Schlüsselwörter
Edmond Jabès, Übersetzung, Literaturübersetzung, Jüdische Mystik, Kabbala, Talmud, Hermeneutik, Poetologie, Schreiben, Text, Autor, Leser, Gott, Schoa, Subversion, Silence, Rupture, Brisure, Quoibilité.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Edmond Jabès und die Übersetzung
Was ist das Thema dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Werk von Edmond Jabès und dessen Verhältnis zum Thema Übersetzung. Die zentrale These ist, dass der Jabèstext selbst als Übersetzungsprozess verstanden werden kann.
Welche Aspekte von Jabès' Werk werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte, von der Struktur des Jabèstextes und seiner poetologischen Grundlagen über den Einfluss jüdischer Mystik und Tradition bis hin zu konkreten Übersetzungsbeispielen in verschiedene Sprachen. Die Beziehung zwischen Autor, Text und Leser bei Jabès spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit legt die methodischen Grundlagen dar und analysiert die Struktur des Jabèstextes. Hermeneutische und poetologische Überlegungen bilden die Grundlage der Analyse. Es werden Schlüsselbegriffe wie „Schreiben nach der Schoa“, „rupture“, „brisure“, „subversion“ und „absence“ untersucht und im Kontext des Übersetzens interpretiert.
Welche Rolle spielt die jüdische Mystik in Jabès' Werk?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss jüdischer Mystik, insbesondere der Kabbala, auf Jabès' Werk. Der talmudische Topos der weißen und schwarzen Schrift wird analysiert, um Jabès' Umgang mit Sprache und Schrift zu verstehen. Die tiefe Verwurzelung von Jabès' Werk in der jüdischen Tradition und seine Auseinandersetzung mit zentralen Konzepten der jüdischen Mystik werden hervorgehoben.
Wie wird die These vom Jabèstext als Übersetzung begründet?
Die Arbeit analysiert Schlüsselbegriffe wie „rupture“ und „brisure“, „subversion“ und „absence“ und untersucht den Einsatz von Wortwiederholungen und -veränderungen, um die Übersetzungsprozesse innerhalb des Textes zu verdeutlichen. Konkrete Beispiele aus Jabès’ Werk untermauern die These.
Wie wird die Übersetzung des Jabèstextes in andere Sprachen behandelt?
Die Arbeit widmet sich den Herausforderungen der Übersetzung des Jabèstextes. Die Aufgabe des Übersetzers, die Schwierigkeit der Übersetzung des Wortes „Dieu“ und seiner Variationen sowie weitere Aspekte der „Subversion“ im Kontext der Übersetzung werden analysiert. Konkrete Beispiele aus deutschen und spanischen Übersetzungen werden diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Der Jabèstext; 2. Die Echos mystiques; 3. Der Jabèstext selbst als Übersetzung; 4. Zur Übersetzung des Jabèstextes in andere Sprachen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Edmond Jabès, Übersetzung, Literaturübersetzung, Jüdische Mystik, Kabbala, Talmud, Hermeneutik, Poetologie, Schreiben, Text, Autor, Leser, Gott, Schoa, Subversion, Silence, Rupture, Brisure, Quoibilité.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Jabès' poetologische Gedankenwelt im Kontext des Übersetzens zu analysieren und die These zu belegen, dass der Jabèstext selbst als Übersetzung verstanden werden kann.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die zentralen Themen und Ergebnisse jedes Abschnitts erläutert.
- Quote paper
- Frieder Stappenbeck (Author), 2003, Übersetzen bei und von Edmond Jabès, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30350