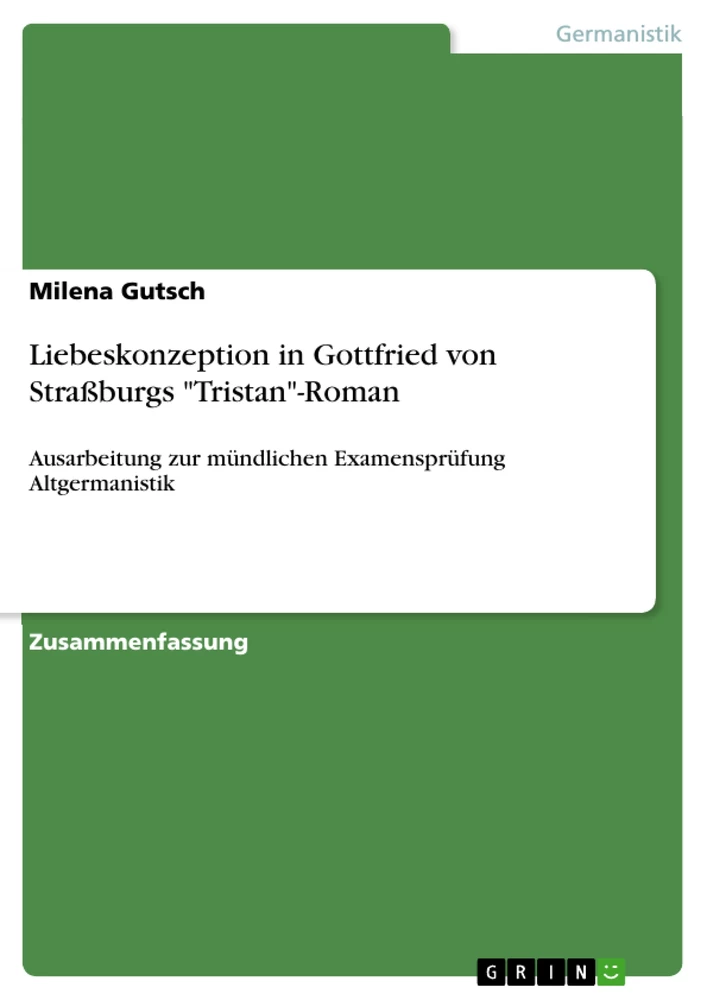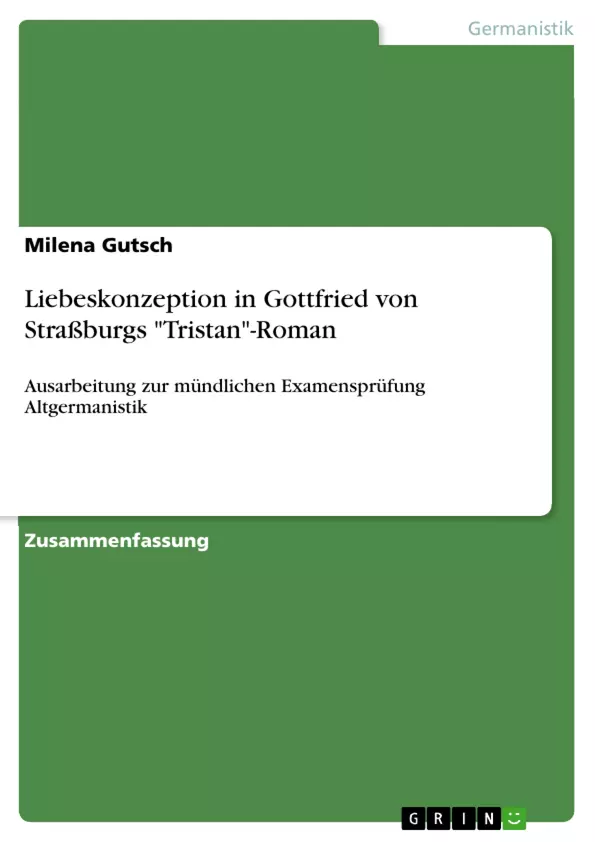Die vorliegende Ausarbeitung zur mündlichen Examensprüfung in Altgermanistik (Literaturwissenschaft) zum Thema "Die Liebeskonzeption in Gottfried von Straßburgs "Tristan"-Roman" enthält in Stichpunkten folgende Schwerpunkte:
- Die Liebesdarstellung in Straßburgs „Tristan“ im Kontext des höfisch-literarischen Liebesdiskurses im 12. Jh.
- Widersprüche der Liebe
- Bedeutung der minne-Exkurse (Funktionen)
- Klassische Artusroman und Minneroman
Zudem ist eine Literaturliste zum ausgearbeiteten Thema angegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Die Liebeskonzeption Gottfried von Straßburgs im „Tristan“-Roman
- Unterschiede zum klassischen Artusroman
- Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft
- Liebe und Ehebruch -> die 3 minne-excurse
- Die Liebesdarstellung in Straßburgs „Tristan“ im Kontext des höfisch-literarischen Liebesdiskurses im 12. Jh.
- 8 Kriterien der höfischen Liebe
- Ausschließlichkeit
- Beständigkeit
- Aufrichtigkeit
- Selbstlosigkeit
- Gegenseitigkeit
- Freiwilligkeit
- Maβ, Vernunft
- Leidensbereitschaft
- Die Liebe von Tristan und Isolde
- Widersprüche der Liebe
- Widerspruch zwischen den Liebenden und der Gesellschaft
- Bedeutung der Exkurse (Funktionen)
- Klassische Artusroman und Minneroman
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Liebeskonzeption Gottfried von Straßburgs im „Tristan“-Roman. Er analysiert die Unterschiede zur klassischen Artusromanliteratur und beleuchtet den Konflikt zwischen individuellem Liebesstreben und gesellschaftlichen Normen, insbesondere im Kontext von Ehe und Treuebruch.
- Die Besonderheiten der höfischen Liebeskonzeption im 12. Jahrhundert
- Die Rolle der Minne-Exkurse in der Darstellung der Tristan-Liebe
- Die Widersprüchlichkeit der Tristan-Liebe und ihre Folgen
- Der Konflikt zwischen individueller Liebe und gesellschaftlichen Normen
- Die Bedeutung der Exkurse für Textverständnis und Leserlenkung
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text untersucht zunächst die Liebeskonzeption Gottfried von Straßburgs im „Tristan“-Roman und stellt sie in den Kontext des höfischen Liebesdiskurses des 12. Jahrhunderts. Es werden acht Kriterien der höfischen Liebe definiert und anhand der Liebe zwischen Tristan und Isolde analysiert. Dabei werden die verschiedenen Aspekte der Liebe wie Ausschließlichkeit, Beständigkeit, Aufrichtigkeit, Selbstlosigkeit, Gegenseitigkeit, Freiwilligkeit, Maβ, Vernunft und Leidensbereitschaft im Detail beleuchtet.
Der Text zeigt dann die Widersprüche auf, die innerhalb der Tristan-Liebe und zwischen den Liebenden und der Gesellschaft existieren. Er analysiert die Rolle der Minne-Exkurse und ihre Funktion für die Textdeutung und die Leserlenkung.
Schließlich werden die Unterschiede zwischen dem klassischen Artusroman und dem Minneroman herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind höfische Liebe, Tristan-Roman, Minne-Exkurse, Ehebruch, Konflikt, Individuum, Gesellschaft, Außennormen, Innennormen, Leidensbereitschaft, Freiwilligkeit, Selbstlosigkeit, Gegenseitigkeit, Maβ, Vernunft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Merkmale der Liebeskonzeption in Gottfrieds "Tristan"?
Die Liebe in "Tristan" ist durch Ausschließlichkeit, Leidenschaft und eine radikale Hinwendung zum Individuum geprägt, was oft im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen steht.
Welche Rolle spielen die Minne-Exkurse im Roman?
Die Minne-Exkurse dienen der Leserlenkung und theoretischen Untermauerung der Liebesdarstellung. Sie reflektieren das Wesen der Minne und kommentieren das Handeln der Protagonisten.
Wie unterscheidet sich der Tristan-Roman vom klassischen Artusroman?
Während im Artusroman die Integration des Helden in die Gesellschaft im Vordergrund steht, thematisiert der Tristan-Roman den unauflösbaren Konflikt zwischen individueller Liebe und sozialen Verpflichtungen.
Was bedeutet "Leidensbereitschaft" im Kontext der Tristan-Minne?
Leidensbereitschaft ist eines der acht Kriterien der höfischen Liebe. Sie besagt, dass wahre Liebende bereit sein müssen, für ihre Liebe Schmerz und gesellschaftliche Ächtung in Kauf zu nehmen.
Wie wird das Thema Ehebruch im Werk behandelt?
Ehebruch wird als notwendige Konsequenz der absoluten Liebe dargestellt, was zu einem ständigen Spannungsfeld zwischen der "Inneren Norm" der Liebenden und der "Außennorm" der Gesellschaft führt.
- Quote paper
- Milena Gutsch (Author), 2012, Liebeskonzeption in Gottfried von Straßburgs "Tristan"-Roman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303590