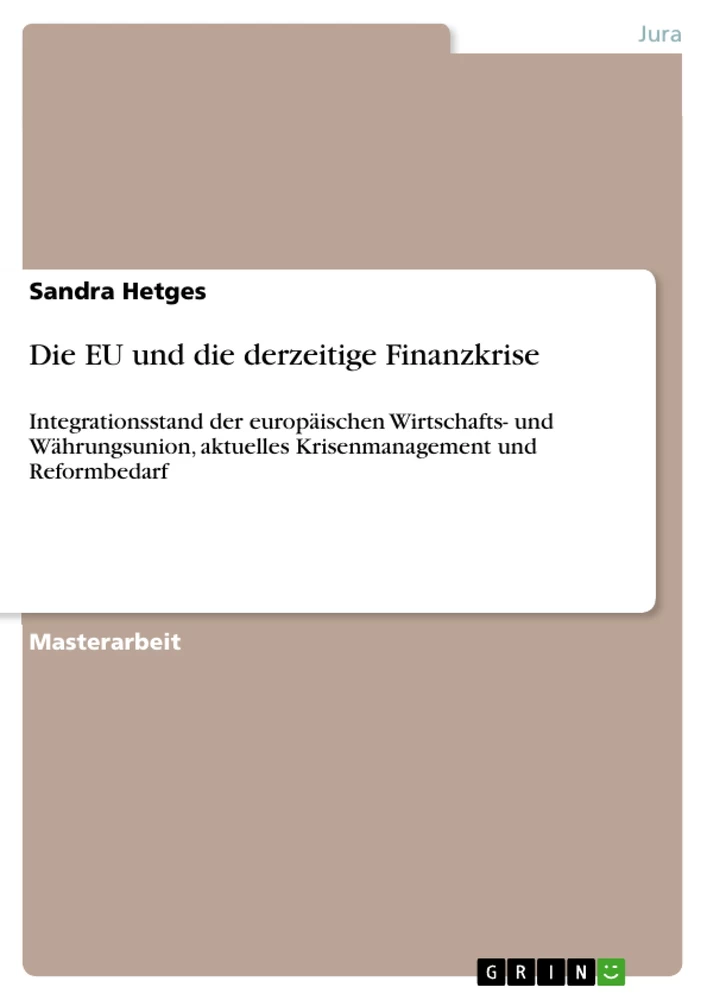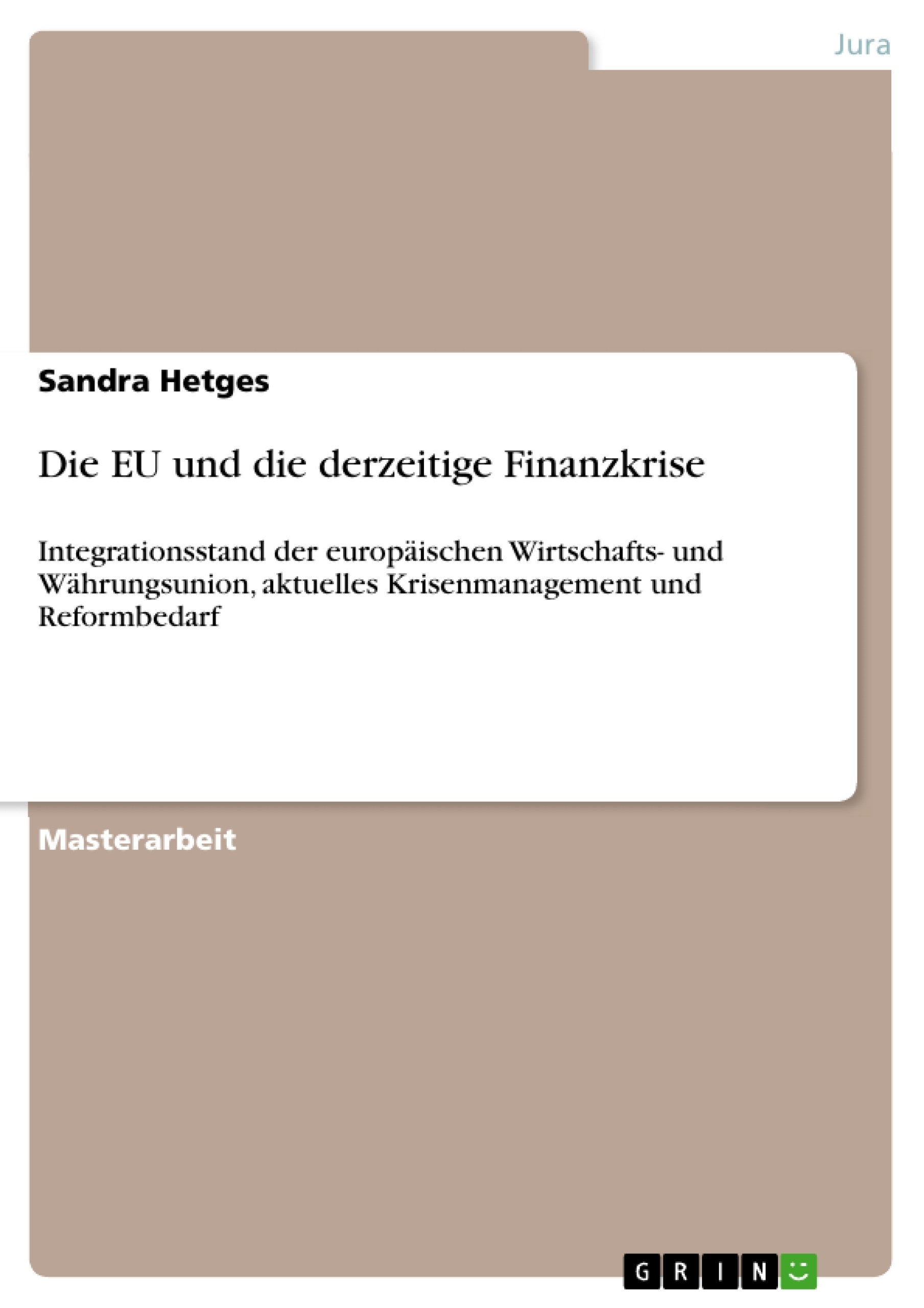Seit dem Frühjahr 2010 ist die Gefährdung des Euro das dominierende Thema in der Europäischen Union. Der Euro ist mittlerweile die gemeinsame Währung von 19 der 28 Mitgliedstaaten der EU. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion "erschaffen", die eine gemeinsame Währungspolitik - ausgeführt von der EZB - beinhaltet, jedoch keine echte Wirtschaftsunion, d.h. eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, sondern verpflichtet die Mitgliedstaaten "nur" zu einer Koordination der Wirtschaftspolitiken und Haushaltsdisziplin.
Bereits 1992 unterschrieben mehr als 60 Professoren ein Manifest gegen den Vertrag von Maastricht, in dem sie vor einer verfrühten Währungsunion warnten und exakt jene Entwicklungen vorausgesagt haben, die in der letzten Zeit eingetreten sind. Tatsächlich ermöglichte die Einheitswährung und die einheitliche Geldpolitik der EZB es den sog. Peripherieländern sich (zu) billig zu verschulden (z.B. Griechenland) und konnte einem ungesunden kreditfinanzierten Wirtschaftsboom (wie den Aufbau einer Immobilienblase in Spanien) - der die Preise und Löhne in den Krisenländern viel rascher als in den anderen Euroländern ansteigen ließ - nicht rechtzeitig entgegenwirken. Die verabredeten fiskalischen Kriterien, der Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Verpflichtung zur Koordination der Wirtschaftspolitiken konnten die Verschuldungsprobleme ebenfalls nicht verhindern.
Die Mitgliedstaaten der EU und die EU selber haben ein Bündel von Maßnahmen geschnürt, die alle darauf abzielen, alle bisher am Währungsraum teilnehmenden Ländern im Währungsraum zu halten.
Ziel dieser Arbeit ist zum einen, die von der Politik ergriffenen Maßnahmen rechtlich und ökonomisch zu würdigen. Neben Bedenken, ob diese Maßnahmen mit dem Unionsrecht und dem Grundgesetz zu vereinbaren sind, stellt sich die Frage nach der ökonomischen Sinnhaftigkeit und den möglichen Alternativen zur Krisenbewältigung. Zum anderen verfolgt diese Arbeit das Ziel mögliche Vorkehrungen darzustellen, damit sich ein solches Szenario nicht wiederholt. Hierzu ist es erforderlich, die Ursachen dieser Krise herauszuarbeiten, um wirksame Instrumente zur Verhinderung zukünftiger Krise zu entwickeln. Dabei geht es weniger um die Frage, ob die derzeitigen Regelungen zur Haushaltsdisziplin ausreichend sind, sondern eher um die Frage welcher Regelungen es bedarf, eine solide Haushaltspolitik wirksam durchsetzen und wirtschaftliche Konvergenz gewährleisten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Methodik und Aufbau der Arbeit
- 2. Wirtschaftsunion und Währungsunion
- 2.1 Begriffsdefinitionen
- 2.2 Kosten und Nutzen einer Währungsunion
- 2.2.1 Kosten einer Währungsunion
- 2.2.2 Nutzen einer Währungsunion
- 3. Die Verwirklichung der EWWU im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses
- 3.1 Vorläufer der EWWU
- 3.1.1 Von der Europaidee zum Werner-Plan
- 3.1.2 Das Europäische Währungssystem
- 3.1.3 Die Einheitliche Europäische Akte und der Delors-Bericht
- 3.2 Die Verwirklichung der EWWU im Vertrag von Maastricht
- 3.2.1 Erste Stufe
- 3.2.2 Zweite Stufe
- 3.2.3 Dritte Stufe
- 4. Asymmetrie der EWWU
- 4.1 Integrationsstand Währungsunion
- 4.2 Integrationsstand Wirtschaftsunion
- 4.3 Spannungsverhältnis und daraus resultierende Gefahren der EWWU
- 4.3.1 Gefahr einer expansiven Fiskalpolitik
- 4.3.2 Gefahr einer expansiven Tarifpolitik und fehlender realwirtschaftlicher Konvergenz
- 4.4 Wann ist eine Währungsunion ökonomisch sinnvoll?
- 5. Die (bisherigen) Rechtsgrundlagen der EWWU
- 5.1 Vertragliche Grundlagen zur Währungspolitik
- 5.1.1 Art. 127 AEUV
- 5.2 Vertragliche Grundlagen zur Wirtschaftspolitik
- 5.2.1 Art. 119 und 120 AEUV
- 5.2.2 Art. 120, Art. 121 und Art. 136 AEUV
- 5.2.3 Art. 122 AEUV
- 5.2.4 Art. 123 AEUV
- 5.2.5 Art. 124 AEUV
- 5.2.6 Art. 125 AEUV
- 5.2.7 Art. 126 AEUV
- 5.3 Zweck und ökonomische Zielsetzungen der Art. 123126 AEUV
- 6. Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die drohende Zahlungsunfähigkeit Griechenlands und weitere Krisenfaktoren
- 6.1 Ursachen und Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise
- 6.1.1 Ursachen
- 6.1.2 Auswirkungen auf die Haushaltslage der Mitgliedstaaten der EU und die europäische Wirtschaft
- 6.2 Der Fall Griechenland
- 6.3 Weitere Krisenfaktoren
- 6.3.1 Staatsschulden und Haushaltsdefizite
- 6.3.2 Fehlende reale Konvergenz
- 7. Das Krisenmanagement der EU und der Mitgliedstaaten
- 7.1 Rettungspaket zugunsten Griechenlands durch die Mitgliedstaaten
- 7.2 Der Euro-Rettungsschirm
- 7.3 Maßnahmen der EZB
- 8. Rechtliche Beurteilung der Hilfsmaßnahmen im Lichte des Unionsrechts
- 8.1 Beurteilung des EFSM
- 8.1.1 Auffassungen in der Literatur
- 8.1.2 Stellungnahme
- 8.1.2.1 Anwendungsfall Griechenland
- 8.1.2.2 Anwendungsfall Irland
- 8.1.3 Begebung von Anleihen durch die EU?
- 8.2 Beurteilung der bilateralen Kredite zugunsten Griechenlands und der Kredite durch die ESFS an Irland, Griechenland und Portugal
- 8.2.1 Beurteilung der bilateralen Kredite zugunsten Griechenlands
- 8.2.1.1 Auffassungen zur Reichweite der no-bailout-Klausel
- 8.2.1.1.1 Art. 125 AEUV als strikte Verbotsklausel
- 8.2.1.1.2 Art. 125 AEUV verbietet keine bilateralen Kredite
- 8.2.1.2 Stellungnahme
- 8.2.2 Beurteilung der Kredite durch die ESFS an Irland, Griechenland und Portugal
- 8.2.2.1 Stellungnahme
- 8.3 Verstoß gegen Art. 124 AEUV?
- 8.4 Beurteilung der Maßnahmen der EZB
- 8.4.1 Stellungnahme
- 8.5 Rechtsfolgen
- 9. Beurteilung aus Sicht des deutschen Verfassungsrechts
- 9.1 Die Entscheidung des BVerfG vom 07.09.2011
- 9.2 Kritik
- 10. Beurteilung der Maßnahmen aus ökonomischer Sicht
- 10.1 Kredite an überschuldete Staaten
- 10.2 Weitere Kritik
- 10.3 Alternative 1: keine Kreditgewährung, Verbleib im Euroraum
- 10.4 Alternative 2: Ausscheiden aus der Währungsunion
- 10.5 Maßnahmen der EZB
- 10.6 Stellungnahme
- 11. Reformbedarf der EWWU
- 11.1 Zusammenfassung und Entwicklung des Reformbedarfs
- 11.2 Bereits durchgeführte Reformen
- 11.2.1 Der Euro-Plus-Pakt
- 11.2.2 Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
- 11.2.2.1 Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte
- 11.2.2.2 Haushaltspolitische Überwachung
- 11.2.2.3 Verfahren bei einem übermäßigen Defizit
- 11.2.2.4 Beurteilung der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes
- 11.2.3 Der Europäische Stabilisierungsmechanismus
- 11.2.3.1 Beurteilung des ESM
- 11.3 weiterer Reformbedarf
- 11.3.1 Insolvenzrest für Staaten
- 11.3.2 nationale Schuldenbremse
- 11.3.3 Maßnahmen für Banken
- 11.3.4 Auf dem Weg zur einer echten Wirtschaftsunion?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die derzeitige Finanzkrise aus der Perspektive der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU). Ziel ist es, den Integrationsstand der EWWU zu analysieren, die aktuellen Krisenmanagementmaßnahmen zu bewerten und den Reformbedarf zu beleuchten.
- Integrationsstand der EWWU
- Asymmetrie der EWWU
- Krisenmanagement der EU und der Mitgliedstaaten
- Rechtliche Beurteilung der Hilfsmaßnahmen
- Reformbedarf der EWWU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung und die Zielsetzung. Anschließend werden die Begriffe Wirtschaftsunion und Währungsunion definiert und die Kosten und Nutzen einer Währungsunion erläutert. Kapitel 3 befasst sich mit der Verwirklichung der EWWU im europäischen Integrationsprozess, wobei die Vorläufer der EWWU und die Verwirklichung im Vertrag von Maastricht beleuchtet werden. In Kapitel 4 wird die Asymmetrie der EWWU untersucht, insbesondere der Integrationsstand der Währungsunion und der Wirtschaftsunion. Kapitel 5 analysiert die Rechtsgrundlagen der EWWU, insbesondere die vertraglichen Grundlagen zur Währungs- und Wirtschaftspolitik. Kapitel 6 behandelt die Wirtschafts- und Finanzkrise, die drohende Zahlungsunfähigkeit Griechenlands und weitere Krisenfaktoren. Kapitel 7 beleuchtet das Krisenmanagement der EU und der Mitgliedstaaten, inklusive Rettungspakete und Maßnahmen der EZB. Kapitel 8 befasst sich mit der rechtlichen Beurteilung der Hilfsmaßnahmen im Lichte des Unionsrechts, während Kapitel 9 die Beurteilung aus Sicht des deutschen Verfassungsrechts darstellt. Kapitel 10 untersucht die Maßnahmen aus ökonomischer Sicht. Abschließend werden in Kapitel 11 der Reformbedarf der EWWU, bereits durchgeführte Reformen und weiterer Reformbedarf diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der europäischen Integration, insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion. Zentrale Begriffe sind der Integrationsstand der EWWU, Asymmetrie, Krisenmanagement, rechtliche Beurteilung, Reformbedarf, Staatsschulden, Haushaltsdefizite, Euro-Rettungsschirm, EFSM, ESM, Stabilitäts- und Wachstumspakt, no-bailout-Klausel, deutsche Verfassung, ökonomische Beurteilung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Euro in Gefahr?
Die Asymmetrie zwischen einer gemeinsamen Währungspolitik (EZB) und einer dezentralen Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten führte zu hohen Verschuldungen und wirtschaftlichen Ungleichgewichten.
Was ist die „no-bailout-Klausel“?
Art. 125 AEUV besagt eigentlich, dass weder die EU noch Mitgliedstaaten für die Verbindlichkeiten anderer Staaten haften dürfen, was in der Krise rechtlich debattiert wurde.
Welche Rolle spielt Griechenland in der Finanzkrise?
Griechenland war das erste Land, das durch massive Überschuldung Rettungsschirme und bilaterale Kredite der EU-Partner benötigte, um eine Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.
Was sind EFSM und ESM?
Dies sind Stabilisierungsmechanismen (Rettungsschirme), die geschaffen wurden, um zahlungsunfähigen Euro-Staaten finanzielle Unterstützung unter Auflagen zu gewähren.
Welche Reformen sind für die EWWU nötig?
Diskutiert werden nationale Schuldenbremsen, ein Insolvenzrecht für Staaten und eine stärkere Koordinierung der Fiskalpolitik hin zu einer echten Wirtschaftsunion.
- Citar trabajo
- Sandra Hetges (Autor), 2012, Die EU und die derzeitige Finanzkrise, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303640