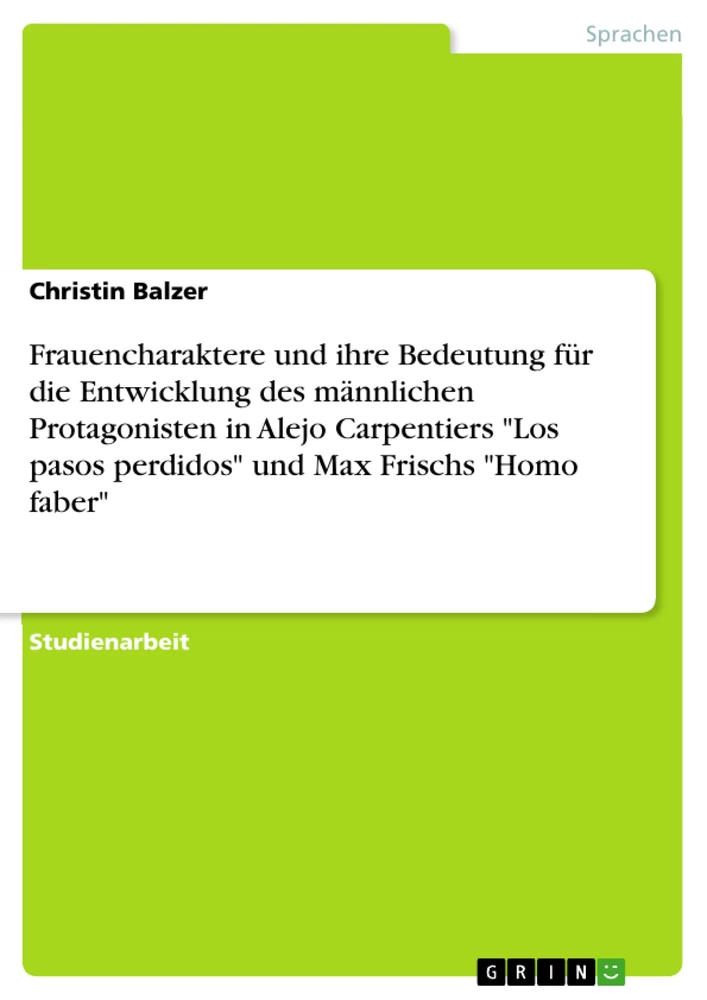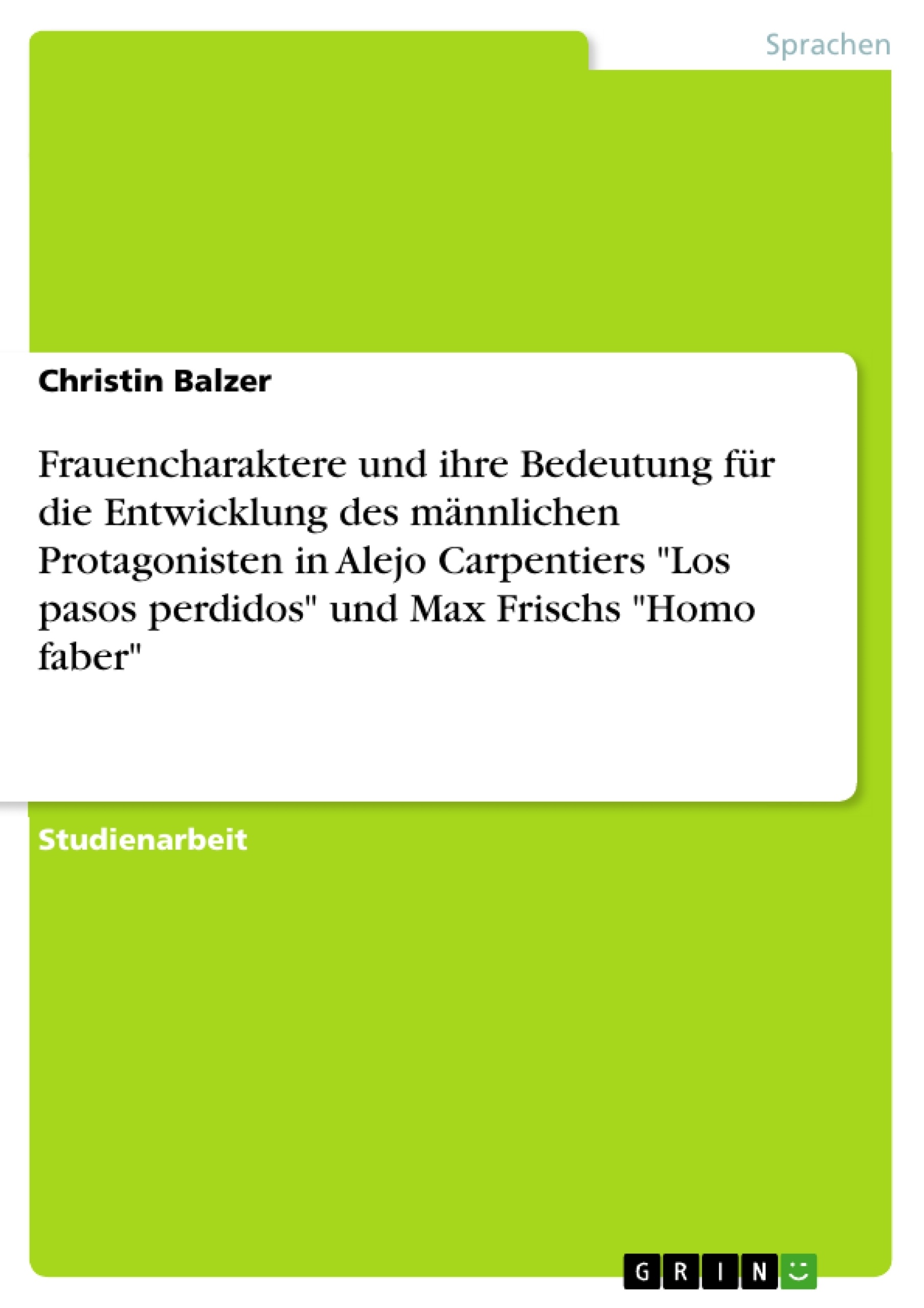Der franko-kubanische Schriftsteller Alejo Carpentier gehört zu den bedeutendsten Vertretern der Literatur Lateinamerikas des 20. Jahrhunderts. Sein Roman "Los pasos perdidos" von 1953 ist eines seiner bekanntesten Werke und zudem eines der bedeutendsten Werke der lateinamerikanischen Literatur insgesamt.
Wie auch in seinem 1949 erschienenen Roman "El reino de este mundo" spielt das Konzept des „real maravilloso“, des „wunderbar Wirklichen“, eine große Rolle. Das „real maravilloso“ wird als Konzept verstanden, das zur Entstehung des „realismo mágico“, des „magischen Realismus“, beigetragen hat. Dieses Konzept hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung der lateinamerikanischen Literatur. Es beinhaltet die Idee, dass das „wunderbar Wirkliche“ überall um uns herum, in der Realität, vorhanden ist und passiert.
Dieses interessante und bereits viel diskutierte Konzept soll aber nicht Gegenstand dieser Hausarbeit sein. Ich möchte mich vielmehr auf die Figurenkonstellationen und Figurencharakterisierungen beziehen, genauer gesagt, auf die weiblichen Figuren des Romans. Das Ziel meiner Hausarbeit soll es sein, die besonderen Beziehungen der drei weiblichen Hauptfiguren zu dem männlichen Protagonisten herauszuarbeiten und zu interpretieren und somit zu untersuchen, welche Bedeutung die unterschiedlichen Frauentypen für den Protagonisten und dessen Entwicklung haben.
Des Weiteren möchte ich anhand eines direkten Vergleiches mit dem Werk "Homo faber" von Max Frisch, erschienen im Jahr 1957, zeigen, dass bestimmte Frauentypen auch in anderen Romanen der damaligen Zeit einen ähnlichen Einfluss auf den Werdegang und die Entscheidungen der männlichen Hauptfiguren haben. Hierbei werde ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gestaltung der Charaktere und ihrer Bedeutung herausarbeiten.
Ich habe mich für einen Vergleich mit "Homo faber" entschieden, da ich denke, dass die Werke einige deutliche Gemeinsamkeiten aufweisen, welche sie für eine Gegenüberstellung prädestinieren. Zum Beispiel brechen in beiden Werken die männlichen Protagonisten von New York aus nach Lateinamerika auf. In beiden Romanen gibt es drei Frauen, die die Leben der Protagonisten bestimmen und in beiden Fällen kann man von der Reise als Sinnsuche und der Suche nach sich selbst sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltsangaben
- Inhaltsangabe Los pasos perdidos
- Inhaltsangabe Homo faber
- Mouche
- Rosario
- Ruth
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beziehungen der weiblichen Hauptfiguren zu den männlichen Protagonisten in Alejo Carpentiers Los pasos perdidos und Max Frischs Homo faber. Ziel ist es, die Bedeutung der unterschiedlichen Frauentypen für die Entwicklung der männlichen Protagonisten herauszuarbeiten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der Gestaltung der Charaktere und ihrer Bedeutung in beiden Romanen zu vergleichen.
- Bedeutung weiblicher Figuren für die Entwicklung der männlichen Protagonisten
- Vergleich der weiblichen Charaktere in beiden Romanen
- Analyse der Beziehungen zwischen den Protagonisten und den weiblichen Figuren
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Frauenrollen
- Die Rolle der Reise als Sinnsuche in beiden Romanen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und erläutert die zentralen Fragestellungen. Sie stellt Alejo Carpentier als bedeutenden Vertreter der lateinamerikanischen Literatur vor und erwähnt sein Konzept des „real maravilloso“, welches jedoch nicht im Fokus der Arbeit steht. Stattdessen konzentriert sich die Arbeit auf die Figurencharakterisierungen, insbesondere die weiblichen Figuren und deren Einfluss auf die männlichen Protagonisten in Los pasos perdidos im Vergleich zu Homo faber. Der Vergleich beider Romane wird begründet durch die Gemeinsamkeit der Reise als Sinnsuche der männlichen Protagonisten von New York nach Lateinamerika und der Präsenz von drei Frauen, die deren Leben prägen.
Inhaltsangabe Los pasos perdidos: Diese Inhaltsangabe fasst die Handlung des Romans Los pasos perdidos zusammen. Der namenlose Protagonist, ein Musikwissenschaftler, bricht mit seiner Geliebten Mouche nach Lateinamerika auf, um nach alten Musikinstrumenten zu suchen. Die Reise wird durch die Begegnung mit Rosario geprägt, die eine bedeutende Rolle in seinem Leben einnimmt. Die Beziehung zu Mouche endet, während die Beziehung zu Rosario eine neue Perspektive für den Protagonisten eröffnet. Die Reise wird letztendlich zu einer Sinnsuche, welche durch die Begegnung mit den verschiedenen Frauen und den Erfahrungen im lateinamerikanischen Urwald gekennzeichnet ist. Die anfängliche Flucht vor der Realität in New York mündet in einer neuen, jedoch auch unklaren Zukunftsperspektive.
Inhaltsangabe Homo faber: Die Inhaltsangabe beschreibt den Beginn von Walter Fabers Reise von New York nach Caracas. Die Notlandung und die Begegnung mit Herbert, dem Bruder seines Freundes, führt zur Enthüllung von Fabers Vergangenheit, insbesondere seiner Beziehung zu Hanna und seinem unehelichen Kind. Diese Offenbarung stürzt Faber in eine existentielle Krise und beeinflusst seine weiteren Entscheidungen und Handlungen maßgeblich. Der Auszug deutet bereits die folgenden Konflikte und die Reise als Prozess der Selbstfindung an.
Schlüsselwörter
Los pasos perdidos, Homo faber, Alejo Carpentier, Max Frisch, Frauenfiguren, männlicher Protagonist, Beziehungsdynamik, Reise als Metapher, Sinnsuche, Lateinamerika, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Hausarbeit: Vergleich der weiblichen Figuren in "Los pasos perdidos" und "Homo faber"
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Beziehungen der weiblichen Hauptfiguren zu den männlichen Protagonisten in Alejo Carpentiers Los pasos perdidos und Max Frischs Homo faber. Es wird der Einfluss der unterschiedlichen Frauentypen auf die Entwicklung der männlichen Protagonisten verglichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der Gestaltung der Charaktere und ihrer Bedeutung in beiden Romanen analysiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der weiblichen Figuren für die Entwicklung der männlichen Protagonisten, einen Vergleich der weiblichen Charaktere in beiden Romanen, die Analyse der Beziehungen zwischen den Protagonisten und den weiblichen Figuren, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Frauenrollen und die Rolle der Reise als Sinnsuche in beiden Romanen.
Welche Romane werden verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht Alejo Carpentiers Los pasos perdidos und Max Frischs Homo faber. Der Vergleich wird begründet durch die Gemeinsamkeit der Reise als Sinnsuche der männlichen Protagonisten von New York nach Lateinamerika und der Präsenz von jeweils drei prägenden Frauenfiguren in ihren Leben.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, Inhaltsangaben zu beiden Romanen (Los pasos perdidos und Homo faber), Kapitelzusammenfassungen, eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und eine Liste der Schlüsselbegriffe. Die Einleitung stellt die Fragestellungen und die Autoren vor. Die Inhaltsangaben fassen die Handlung der Romane zusammen. Die Kapitelzusammenfassungen liefern detailliertere Informationen zu den einzelnen Abschnitten der Analyse.
Welche Rolle spielt die Reise in den Romanen?
Die Reise dient in beiden Romanen als Metapher für die Sinnsuche der männlichen Protagonisten. Die Reise von New York nach Lateinamerika ist ein zentraler Bestandteil der Handlung und beeinflusst maßgeblich die Entwicklung der Beziehungen zu den weiblichen Figuren und die persönliche Entwicklung der Protagonisten.
Welche weiblichen Figuren werden im Detail betrachtet?
Die Hausarbeit analysiert die Figuren Mouche und Rosario aus Los pasos perdidos und Hanna aus Homo faber. Der Fokus liegt auf ihren Beziehungen zu den männlichen Protagonisten und ihrem Einfluss auf deren Entwicklung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Los pasos perdidos, Homo faber, Alejo Carpentier, Max Frisch, Frauenfiguren, männlicher Protagonist, Beziehungsdynamik, Reise als Metapher, Sinnsuche, Lateinamerika, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Wo finde ich weitere Informationen zu den Romanen?
Weitere Informationen zu den Romanen Los pasos perdidos und Homo faber können in einschlägiger Literatur zur lateinamerikanischen bzw. deutschsprachigen Literatur gefunden werden. Spezifische Informationen zu den Autoren Alejo Carpentier und Max Frisch sind ebenfalls in der Literatur verfügbar.
- Arbeit zitieren
- Christin Balzer (Autor:in), 2012, Frauencharaktere und ihre Bedeutung für die Entwicklung des männlichen Protagonisten in Alejo Carpentiers "Los pasos perdidos" und Max Frischs "Homo faber", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303788