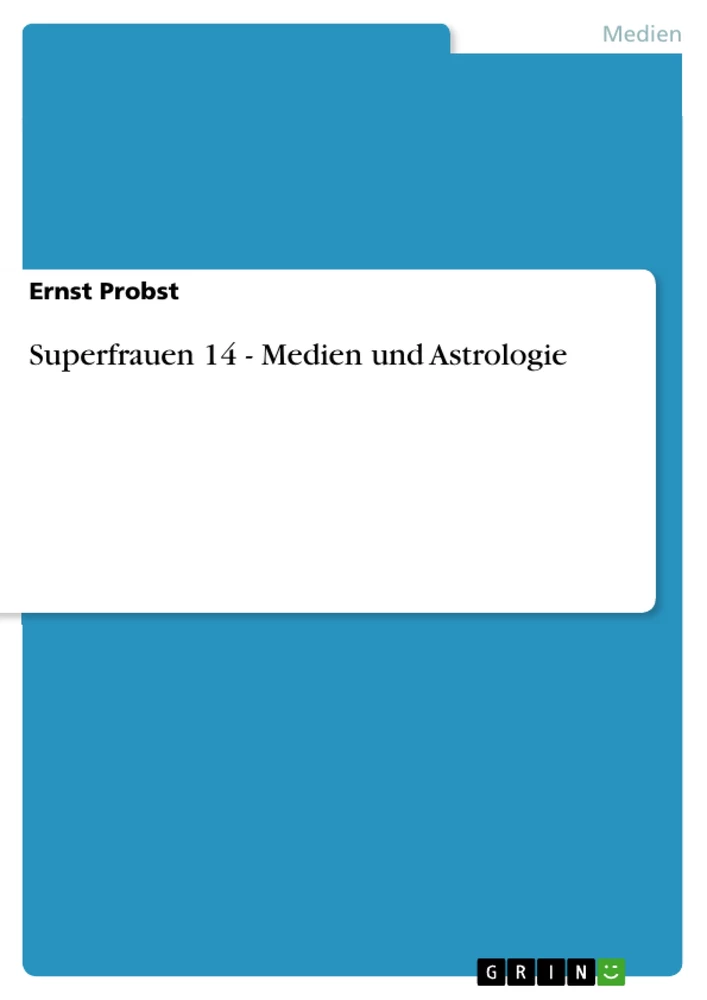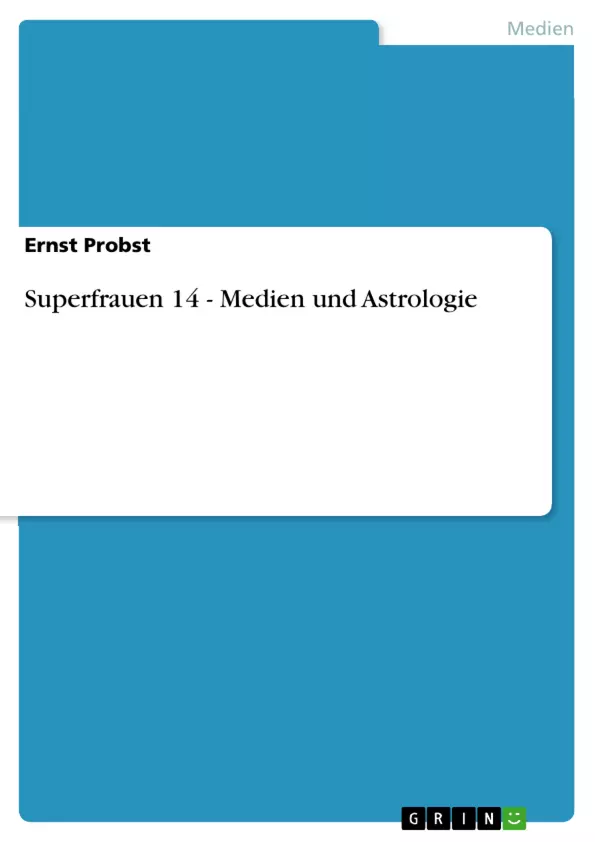Der Name von Dagmar Berghoff, der ersten Frau der „Tagesschau“, ist Millionen von Deutschen bekannt. Dasselbe gilt von Amelie Fried, der ersten deutschen Talkmasterin, Irene Koss, der ersten deutschen Fernsehansagerin, und Margarethe Schreinemakers, Deutschlands bisher erfolgreichster Fernsehmoderatorin.
Weniger gut als um die vertrauten Gesichter vom Fernsehbildschirm ist es um die Popularität verdienter Damen von der Presse und dem Rundfunk bestellt, wenn man von der Verlegerin Aenne Burda und der Publizistin Marion Gräfin Dönhoff absieht. Das ist kein Wunder: Schließlich erregt heutzutage kein Medium mehr Aufsehen als das Fernsehen.
Wer kennt schon die deutsche Schriftstellerin Therese Huber (1764–1829), die als erste Frau eine Zeitung leitete und deswegen als „Urmutter der Journalistinnen“ gilt. Und wem sind die Namen von Matilde Serao (1856–1927), der ersten Gründerin einer italienischen Zeitung, oder von Dorothy Thompson (1894–1961), einer der couragiertesten amerikanischen Journalistinnen, deren Beiträge täglich von 150 Zeitungen gedruckt wurden, geläufig?
Diesem Manko soll das vorliegende Buch „Superfrauen 14 – Medien und Astrologie“ abhelfen. Es stellt 17 Frauen aus dem Bereich Medien und drei weitere aus dem Bereich Astrologie in Wort und Bild vor.
Die Astrologie wurde aus gutem Grund hinzugefügt: Denn die Arbeit der Journalistinnen von Presse, Rundfunk und Fernsehen ähnelt nicht selten der von Wahrsagerinnen. Von dem, was in Kommentaren über Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport vorhergesagt wurde, traf so manches nicht ein.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- MEDIEN
- Dagmar Berghoff
- Wibke Bruhns
- Aenne Burda
- Marion Gräfin Dönhoff
- Amelie Fried
- Alice Schwarzer
- Therese Huber
- Beate Klarsfeld
- Irene Koss
- Gabriele Krone-Schmalz
- Franca Magnani
- Louise Otto-Peters
- Margarete Schreinemakers
- Matilde Serao
- Dorothy Thompson
- Beate Wedekind
- ASTROLOGIE
- Madame Buchela
- Jeane Dixon
- Elisabeth Teissier
- Weitere Frauen aus dem Bereich Medien
- Meilensteine der Mediengeschichte
- Literatur
- Der Autor
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch widmet sich dem Leben und Wirken von außergewöhnlichen Frauen, die in den Bereichen Medien und Astrologie Geschichte geschrieben haben. Es beleuchtet die Karrierewege, Herausforderungen und Erfolge dieser Frauen, die mit ihrem Talent und ihrer Entschlossenheit die Medienlandschaft und das öffentliche Bewusstsein nachhaltig geprägt haben.
- Wegbereiterinnen in den Medien
- Frauen in Führungspositionen
- Einfluss von Frauen auf die öffentliche Meinung
- Bedeutung von Astrologie und Medien
- Geschlechterrollen und Frauenbilder in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung von Frauen in den Medien und der Astrologie beleuchtet. Anschließend werden die Biografien und Karrieren von prominenten Frauen aus beiden Bereichen vorgestellt. Die einzelnen Kapitel widmen sich jeweils einer Frau und erzählen ihre Geschichte, ihre Erfolge und Herausforderungen. Dabei werden auch die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beleuchtet, in denen diese Frauen agierten.
Schlüsselwörter
Medien, Astrologie, Frauen, Führungspositionen, öffentliche Meinung, Geschichte, Biografien, Karrierewege, Herausforderungen, Erfolge, Geschlechterrollen, Frauenbilder, Gesellschaft, Medienlandschaft, Einfluss, Bewusstsein, Wegbereiterinnen.
Häufig gestellte Fragen
Wer gilt als die „Urmutter der Journalistinnen“?
Die deutsche Schriftstellerin Therese Huber (1764–1829) gilt als Pionierin, da sie als erste Frau eine Zeitung leitete.
Welche bekannten deutschen Fernsehfrauen werden im Buch vorgestellt?
Vorgestellt werden unter anderem Dagmar Berghoff (Tagesschau), Amelie Fried (Talkmasterin) und Irene Koss (Fernsehansagerin).
Warum wird die Astrologie im Buch thematisiert?
Der Autor zieht eine Parallele zwischen Journalismus und Wahrsagerei, da politische und wirtschaftliche Kommentare oft Vorhersagen enthalten, die nicht immer eintreffen.
Wer war Marion Gräfin Dönhoff?
Sie war eine bedeutende deutsche Publizistin und langjährige Herausgeberin der Wochenzeitung „DIE ZEIT“.
Welche internationalen Journalistinnen werden erwähnt?
Das Buch stellt unter anderem Matilde Serao aus Italien und Dorothy Thompson aus den USA vor.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2015, Superfrauen 14 - Medien und Astrologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304002