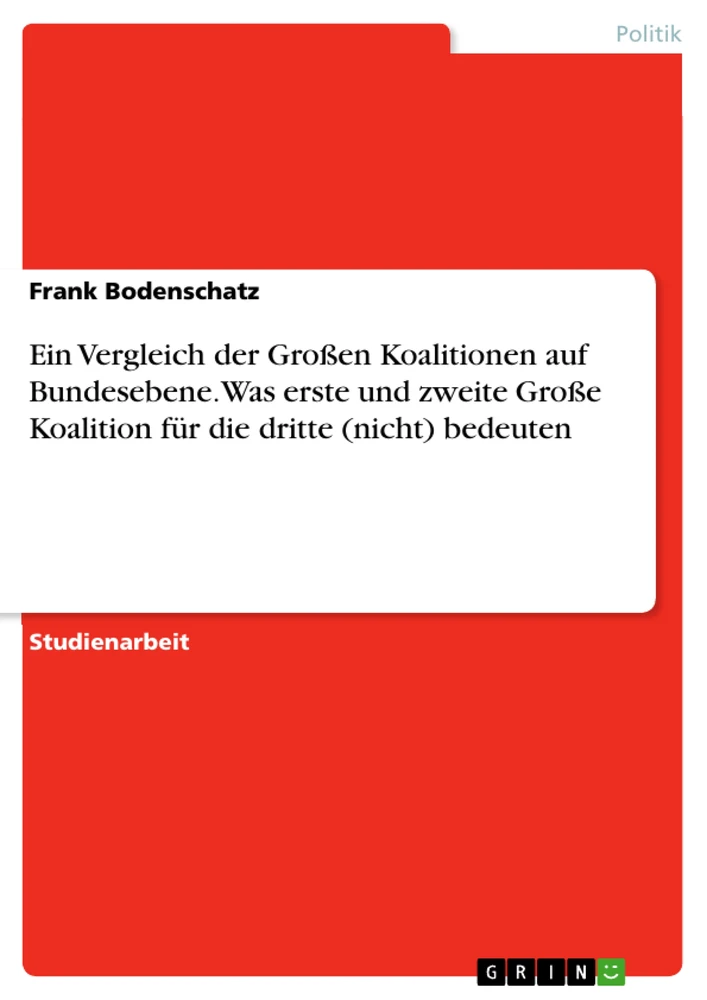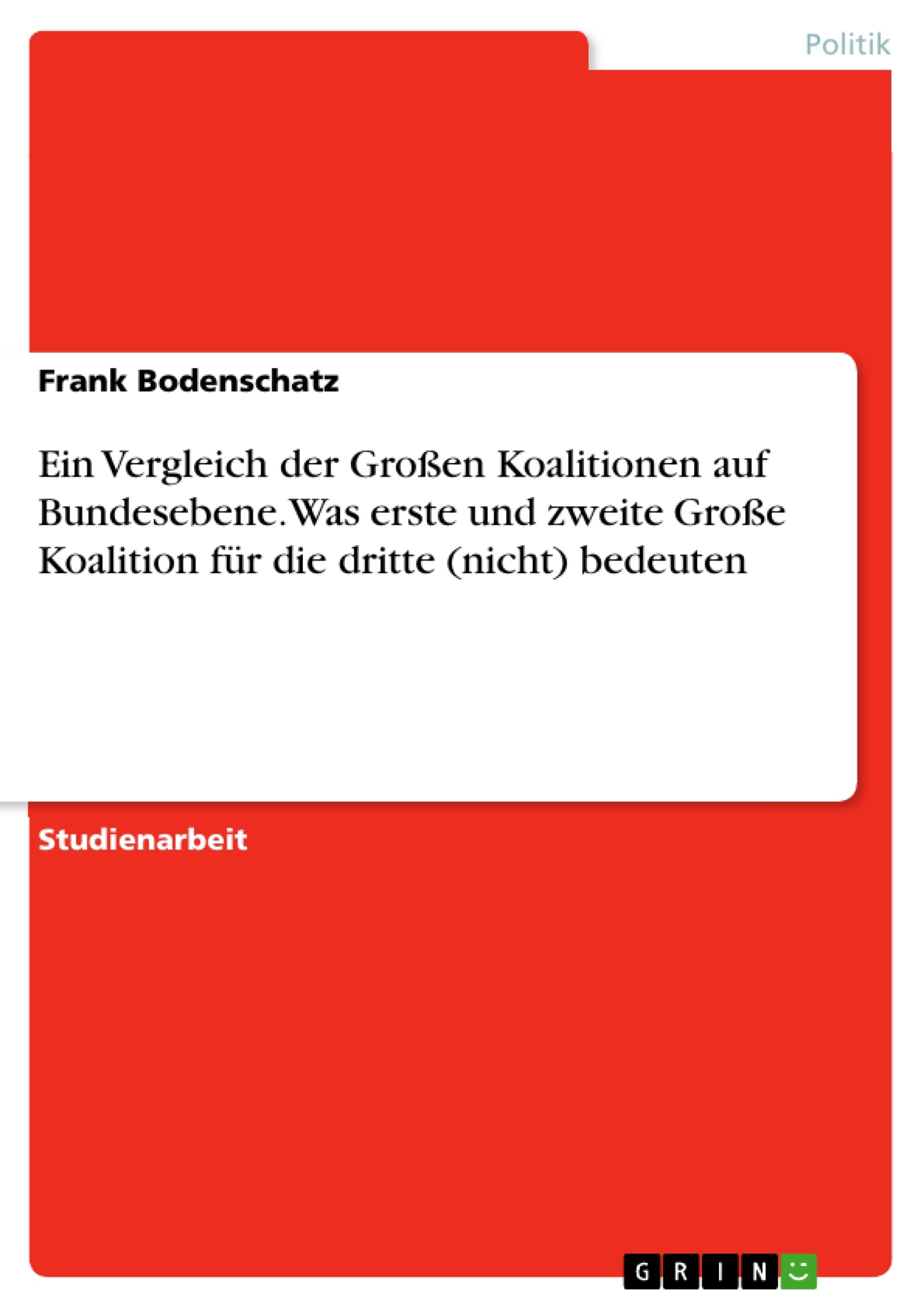Kaum einem Ereignis in der jüngeren bundesdeutschen Parteiengeschichte wurde – sowohl von der Öffentlichkeit als auch den Beteiligten selbst – mit solch einer großen (An-) Spannung entgegengefiebert wie der Verkündung des Ergebnisses im bis dato einmaligen SPD-Mitgliederentscheid über den neuerlichen Eintritt in eine Große Koalition mit den Unionsparteien. Am Nachmittag des 14. Dezember 2013 war es so weit: Eine von vielen nicht für möglich gehaltene, überraschend klare Mehrheit von 75,96 Prozent aller SPD-Mitglieder votierte mit „Ja“ – bei annähernd 78 Prozent Wahlbeteiligung. Ganze 83 Tage nach der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag war der Weg für die Bildung der dritten Regierung Merkel endlich frei, und die Wiederwahl der Kanzlerin nebst Vereidigung ihres Kabinetts am 17. Dezember nur mehr Formsache.
Dass die Bundesrepublik nun zum dritten Mal in ihrer Geschichte von einer Großen Koalition regiert wird, stellt einen willkommenen Anlass dar, um eine vergleichende Rückschau auf die ersten beiden Bündnisse jener Art zu halten, die noch immer als demokratischer Sonder- bzw. Ausnahmefall gelten.
Das konkrete Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, mithilfe einer analytischen Betrachtung von Entstehung, Arbeitsweise und Ergebnissen der „historischen“ Großen Koalitionen Schlussfolgerungen für die gegenwärtige zu ziehen. Was bedeuten die erste und zweite Große Koalition also für die dritte – und was bedeuten sie nicht?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau
- Forschungsstand
- Zum Begriff der „Großen Koalition“
- Erste Große Koalition (1966-1969)
- Ausgangslage und Entstehung
- Koalitionsverlauf und -ende
- Auswirkungen und Folgen
- Zweite Große Koalition (2005-2009)
- Ausgangslage und Entstehung
- Koalitionsverlauf und -ende
- Auswirkungen und Folgen
- Vergleich
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Schlussfolgerungen für die dritte Große Koalition
- Schlussbetrachtung
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die ersten beiden Großen Koalitionen in der Bundesrepublik Deutschland und untersucht deren Entstehung, Verlauf und Folgen. Ziel ist es, aus dieser vergleichenden Rückschau Schlussfolgerungen für die dritte Große Koalition zu ziehen. Dabei wird insbesondere die Frage untersucht, was die ersten beiden Bündnisse für die dritte (nicht) bedeuten.
- Entwicklung und Charakteristika von Großen Koalitionen in Deutschland
- Vergleich der ersten und zweiten Großen Koalitionen
- Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
- Abgrenzung von Großen Koalitionen von anderen Regierungsformen
- Relevanz von Großen Koalitionen für das deutsche Parteiensystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit dar. Sie führt zudem in den Forschungsstand ein und behandelt die unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Große Koalitionen.
- Zum Begriff der „Großen Koalition“: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Kritik am Begriff der Großen Koalition im Kontext des parlamentarischen Systems.
- Erste Große Koalition (1966-1969): In diesem Kapitel wird die Entstehung, der Verlauf und die Folgen der ersten Großen Koalition analysiert.
- Zweite Große Koalition (2005-2009): Dieses Kapitel behandelt analog die zweite Große Koalition und ihre Auswirkungen.
- Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die erste und zweite Große Koalition und leitet daraus Schlussfolgerungen für die dritte ab.
Schlüsselwörter
Große Koalition, Bundesrepublik Deutschland, Parteiensystem, Regierungsbildung, Koalitionspolitik, Vergleich, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, politische Systemforschung, Verhältniswahlsystem, Mehrheitsregierung, Opposition, Bundeskanzler, Helmut Schmidt, Kressbronner Kreis, Parteienlandschaft, Wählerverhalten, politisches System, föderales System, politische Kultur
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Große Koalitionen gab es bisher auf Bundesebene in Deutschland?
Bis zum Zeitpunkt der Arbeit gab es drei Große Koalitionen: 1966-1969, 2005-2009 und die ab 2013 gebildete Regierung.
Was war das Besondere am SPD-Mitgliederentscheid 2013?
Es war ein bis dato einmaliger Vorgang, bei dem die Basis der SPD über den Eintritt in die Koalition abstimmte; 75,96 Prozent votierten für das Bündnis.
Was charakterisiert die erste Große Koalition (1966-1969)?
Sie entstand in einer Krisensituation unter Kanzler Kiesinger und war geprägt von bedeutenden Reformen wie der Notstandsgesetzgebung, führte aber auch zur Entstehung der APO.
Welche Unterschiede bestehen zwischen den historischen Koalitionen?
Unterschiede liegen vor allem in der parteipolitischen Ausgangslage, dem Wählerverhalten und der Rolle der Opposition im parlamentarischen System.
Gilt die Große Koalition als politischer Normalfall?
In der Politikwissenschaft wird sie oft als demokratischer Sonder- oder Ausnahmefall betrachtet, da sie die parlamentarische Opposition stark schwächt.
Welchen Einfluss hat das Wahlsystem auf die Bildung Großer Koalitionen?
Das deutsche Verhältniswahlsystem begünstigt Koalitionen, wobei die Fragmentierung der Parteienlandschaft die Bildung "großer" Bündnisse wahrscheinlicher machen kann.
- Quote paper
- Frank Bodenschatz (Author), 2014, Ein Vergleich der Großen Koalitionen auf Bundesebene. Was erste und zweite Große Koalition für die dritte (nicht) bedeuten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304021