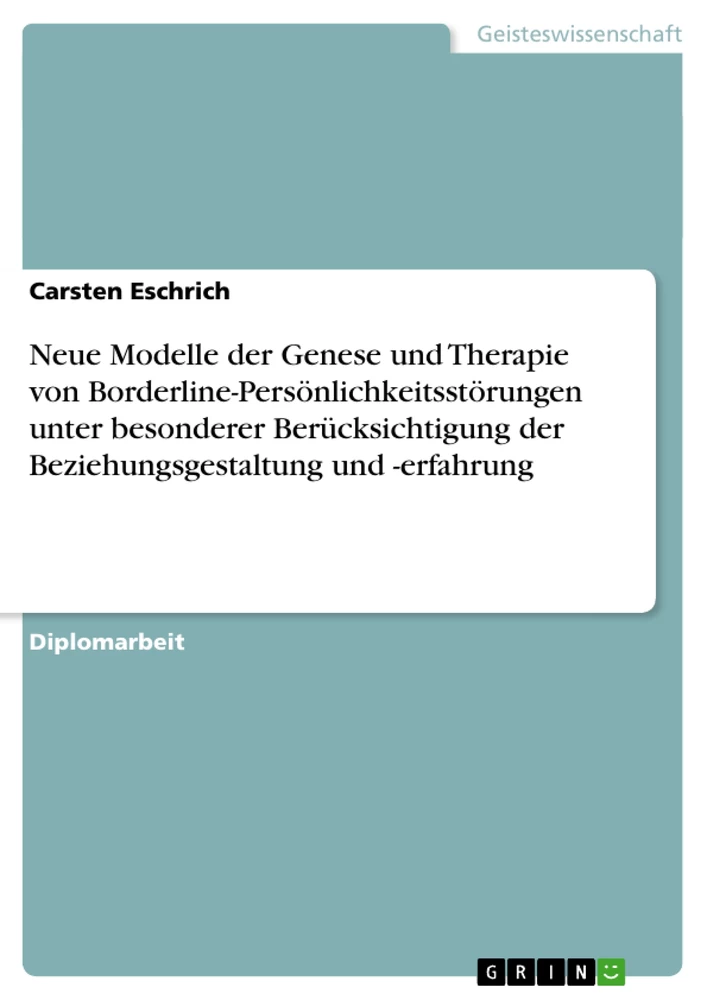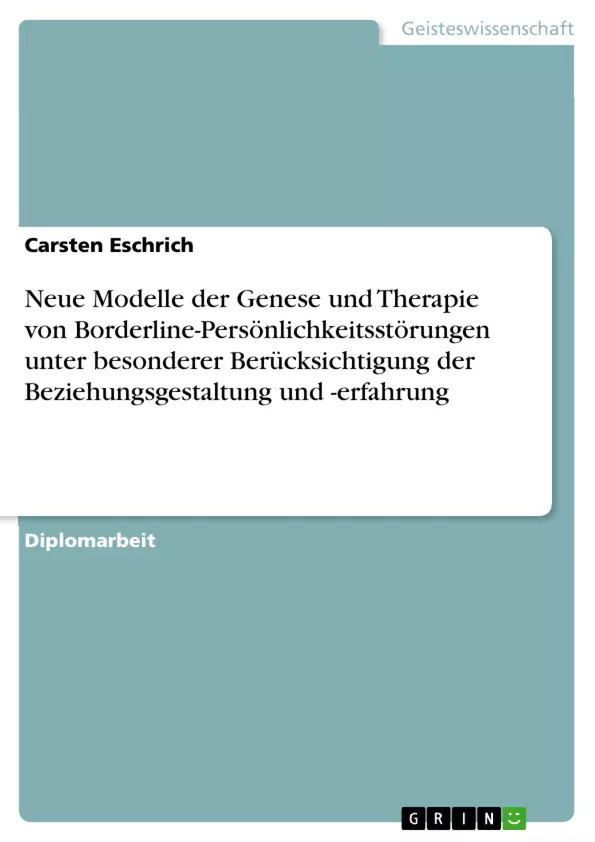In meiner Diplomarbeit gehe ich der Fragestellung nach, welche Bedeutung der Beziehung
im Zusammenhang mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung (im Folgenden BPS)
zukommt. Insbesondere soll dabei aufgezeigt werden, was die Erwartung an eine Beziehung
prägt, wie sie sich zwischen professionellem Helfer und Borderline-Patienten gestaltet und
was sie im Einzelnen so außerordentlich schwierig, doch gleichzeitig unentbehrlich für das
Gelingen des therapeutischen Prozesses macht. Die Beziehungsgestaltung als auch die Art
der Beziehungsabbrüche im privaten Bereich lassen sich von denen auf therapeutischer Basis
in ihrer Dramatik, Impulsivität und Intensität kaum voneinander unterscheiden, was die
Vermutung nahe legt, dass eine ähnlich geartete elementare Erwartungshaltung der Patienten
an die spezielle Art der helfenden Begegnung geknüpft ist.
Auch jene, die gesamte Persönlichkeitsstruktur durchziehende Angst und der verzweifelte
Kampf um deren Vermeidung hätten Angelpunkte einer Herangehensweise für die
Diplomarbeit sein können, ebenso wie die Spaltung in „gut“ und „böse“ als zentralem
Abwehrmechanismus. Ich habe meine Herangehensweise an das Thema Borderlinestörungen
gewählt, weil Beziehung den Rahmen darstellt, in dem alle Aspekte der widerstreitenden
Struktur der BPS am offensichtlichsten erscheinen, weil Beziehung selbst oft genug zum
Auslöser für die Symptomatik wird und sowohl für die Entwicklung als auch für die Therapie
der BPS die entscheidende Rolle spielt.
Als ich mich für das Thema meiner Arbeit entschied, hatte ich schon einiges über die
Psychodynamik der BPS in Erfahrung gebracht, da ich während des integrierten Praktikums
in der sozialpsychiatrischen Ambulanz der Universitätsklinik in Hamburg, sowie in meiner
jetzigen studienbegleitenden Tätigkeit in einer Rehaklinik oft mit Borderline-Patienten
konfrontiert wurde und mich mit gängiger Literatur darüber auseinandergesetzt hatte.
Die Aufnahme der so genannten „schwierigen“ Patienten, zu denen vor allem die Borderliner
zählen, lösen in der Regel äußerst gegensätzliche Motivationen im Team aus. Diese bewegen
sich üblicherweise zwischen der Vorrausahnung einer Überforderung und der Neugierde auf
eine Beziehungs-Herausforderung. So etwas wie Indifferenz ist selten zu spüren. In der
Literatur wird ebenfalls schnell auf dasselbe Spannungsfeld hingewiesen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historisches zum Begriff „Borderline“
- Diagnostik
- Diagnostische Kriterien nach dem DSM-4
- Symptome als deskriptive Merkmale einer Diagnose
- Episodischer Verlust der Impulskontrolle und die Vermeidung von Ambiguität
- Frei flottierende Angst und ihre Koppelung an Objekte
- Alleinsein und extreme Verlassenheitsängste
- Chronisches Gefühl von Leere und Langeweile
- Selbst- und fremdverletzendes Verhalten
- Suizidalität
- Dissoziation in Folge von Aktivierungen traumaassoziierter Schemata
- Antisoziales Verhalten und Delinquenz
- Strukturmerkmale und Psychodynamik, Schwerpunkte der Diagnose
- Die Borderlinestruktur als Abwehr- und Erhaltungsstrategie
- Die Spaltung
- Identitätsdiffusion und Verleugnung
- Kritik am Modell der Spaltung
- Projektion und projektive Identifizierung; Idealisierung und Abwertung
- Regression in der therapeutischen Beziehung
- Realitätsprüfung und Realitätsverlust
- Die Borderlinestruktur als Abwehr- und Erhaltungsstrategie
- Die Gegenübertragung und ihre Bedeutung für die Diagnose der BPS
- Zusammenfassung und Rückschlüsse für die Beziehungsgestaltung
- Genese der BPS
- Skizzen verschiedener Erklärungsansätze für frühe Beziehungsstörungen hinsichtlich der Entwicklung einer BPS
- Traumatisierende Faktoren in der frühkindlichen Entwicklung aus bindungstheoretischer Sicht
- Kriterien von Bindungssicherheit
- Bindungsmuster bei Borderline-Patienten
- Mahlers Theorie der Störung von Individuation und Loslösung während der Wiederannäherungsphase
- Kernbergs analytische Theorie der oralen Traumatisierung
- Die Bedeutung von Missbrauch und Misshandlung
- Neurobiologische Ursachen
- Autonomie und die Frage nach der Existenzberechtigung
- Zusammenfassung und eigene Einschätzung
- Beziehungsgestaltung und Selbsterleben von Borderline-Patienten exemplarisch dargestellt an zwei Beispielen
- Anfänge einer Beziehungsaufnahme
- Entwicklungsschritte zu einer Neuerfahrung von Beziehung während einer stationären Therapie über den Zeitraum von drei Jahren
- Fazit
- Erweiterung der Perspektive um einen spirituellen Ansatz
- Das Persönliche an der ganzheitlichen Erfahrung
- Leid als Vermeidung direkter Erfahrung
- Identifikation mit dem „Ego“ und dem „Selbst“
- Ganzheitlicher Aspekt in der Beziehung
- Liebe als Ausdruck des „Selbst“
- Glaube und Selbsterkenntnis als Rückbesinnung auf das Sein an sich
- Extreme Formen der Selbstaufgabe - extreme Versuche der Selbstbegegnung?
- Zusammenfassung und Bezug zur BPS
- Therapie der BPS
- Kriterien zur Therapie der BPS aus tiefenpsychologischer Sicht
- Beziehungsaufnahme, therapeutische Ausrichtung
- Widerstände im Therapeuten und im Patienten
- Zur Deutung
- Zur Schwierigkeit und Notwendigkeit der Grenzsetzung in der Therapie
- Dialektisch-Behaviorale Therapie
- Acht motivierende Grundannahmen in der DBT
- Weitere Aspekte für die Beziehungsgestaltung in der Einzeltherapie
- Veränderung innerer Schemata durch ihre Akzeptanz
- Behandlungsphasen in der DBT
- Vorbereitungsphase
- Bearbeitung der Probleme auf der Verhaltensebene
- Bewältigung der Folgen traumatischer Erfahrungen
- Integration des Gelernten und Neuorientierung
- Besonderheit des Telefonkontaktes in der DBT
- Stationäre Aspekte der Borderline-Therapie am Beispiel des „Klinikum Nord“ in Hamburg
- Zusammenfassung und eigene Einschätzung
- Kriterien zur Therapie der BPS aus tiefenpsychologischer Sicht
- Lebensweltorientierung durch sozialpädagogische Interventionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Beziehungen im Kontext der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS). Es wird analysiert, wie Beziehungserwartungen geformt werden, wie sich die Beziehung zwischen Therapeut und Patient gestaltet und welche Herausforderungen und Möglichkeiten sie für den Therapieprozess bietet. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich zwischen privaten und therapeutischen Beziehungen und der Rolle von Beziehung in der Genese und Therapie der Störung.
- Bedeutung von Beziehungen in der Genese und Therapie der BPS
- Analyse von Beziehungserwartungen bei Borderline-Patienten
- Herausforderungen und Chancen der therapeutischen Beziehungsgestaltung
- Vergleich zwischen privaten und therapeutischen Beziehungsmustern
- Die Rolle von Spaltung und anderen Abwehrmechanismen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die zentrale Fragestellung nach der Bedeutung von Beziehungen im Zusammenhang mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es wird die Relevanz der Beziehungsgestaltung für den Therapieerfolg betont und die eigene Motivation des Autors, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dargelegt. Der Autor beschreibt seine Erfahrungen mit Borderline-Patienten im Rahmen seiner Praktika und hebt die ambivalenten Reaktionen des therapeutischen Teams auf die Aufnahme solcher Patienten hervor. Die Einleitung unterstreicht die Komplexität der BPS und die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung der Beziehungsebene.
Historisches zum Begriff „Borderline“: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über den Begriff „Borderline“ und seine Entwicklung im Verständnis der Persönlichkeitsstörung. Es analysiert die verschiedenen Perspektiven und Definitionen, welche im Laufe der Zeit existiert haben und zeichnet ein Bild der Evolution der diagnostischen Kriterien und theoretischen Konzepte. Es beleuchtet die Schwierigkeiten, die mit der Abgrenzung zu anderen psychischen Störungen verbunden sind, sowie die Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung einer einheitlichen Definition ergeben.
Diagnostik: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Diagnostik der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es werden die diagnostischen Kriterien nach DSM-4 vorgestellt und im Detail erläutert. Die verschiedenen Symptome der Störung werden deskriptiv beschrieben und ihre Bedeutung im Kontext der Gesamtdiagnose herausgearbeitet. Es geht auf die Psychodynamik der Störung ein, wie beispielsweise Spaltung, Identitätsdiffusion und Projektion, und analysiert die Bedeutung der Gegenübertragung für den diagnostischen Prozess. Der Zusammenhang zwischen den Symptomen und der zugrundeliegenden Persönlichkeitsstruktur wird detailliert analysiert.
Genese der BPS: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Verschiedene Erklärungsansätze werden vorgestellt und kritisch beleuchtet, darunter Bindungstheorien, die Bedeutung frühkindlicher Traumatisierung sowie die Rolle von Missbrauch und Misshandlung. Die Bedeutung von Mahlers Theorie der Individuation und Kernbergs Theorie der oralen Traumatisierung wird ausführlich erörtert, wobei der Fokus auf den Einfluss frühkindlicher Beziehungserfahrungen liegt. Neurobiologische Ursachen werden ebenfalls berücksichtigt und in den Gesamtkontext eingeordnet.
Beziehungsgestaltung und Selbsterleben von Borderline-Patienten exemplarisch dargestellt an zwei Beispielen: In diesem Kapitel werden anhand zweier Fallbeispiele die Beziehungsgestaltung und das Selbsterleben von Borderline-Patienten verdeutlicht. Die Beispiele dienen dazu, die theoretischen Überlegungen aus den vorherigen Kapiteln zu illustrieren und zu konkretisieren. Es werden die Herausforderungen und Möglichkeiten der therapeutischen Beziehung anhand der konkreten Erfahrungen der Patienten beleuchtet und die Bedeutung der Beziehungsgestaltung für den Therapieverlauf hervorgehoben. Die Fallbeispiele zeigen die Dynamik der Beziehungen und deren Bedeutung für die Krankheitsentwicklung und -bewältigung.
Erweiterung der Perspektive um einen spirituellen Ansatz: Dieses Kapitel erweitert die Perspektive auf die BPS um einen spirituellen Ansatz. Es untersucht die Rolle von Sinnfindung, Glaube und der Beziehung zu etwas „Überwertigem“ im Kontext der Störung. Die Bedeutung von Leid und Selbstaufgabe als auch die Suche nach Selbstbegegnung werden untersucht. Der spiritueller Ansatz wird kritisch betrachtet und in Bezug zu anderen therapeutischen Ansätzen gesetzt. Das Kapitel untersucht das Potential spiritueller Ansätze zur Bewältigung der Krisen und zur Förderung des Heilungsprozesses bei Borderline-Patienten.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS), Beziehungsgestaltung, Therapie, Beziehungserwartungen, frühkindliche Traumatisierung, Bindungstheorie, Spaltung, Diagnostik, DSM-4, Gegenübertragung, Psychodynamik, spiritueller Ansatz, Selbstaktualisierung, Suizidalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Borderline-Persönlichkeitsstörung und Beziehungen"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Beziehungen im Kontext der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS). Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich zwischen privaten und therapeutischen Beziehungen und der Rolle von Beziehung in der Genese und Therapie der Störung. Analysiert werden die Entstehung von Beziehungserwartungen, die Gestaltung der therapeutischen Beziehung und die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich daraus für den Therapieprozess ergeben.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Diagnostik der BPS (DSM-4 Kriterien, Symptome, Psychodynamik, Gegenübertragung), die Genese der BPS (Bindungstheorien, frühkindliche Traumatisierung, neurobiologische Ursachen), die Beziehungsgestaltung und das Selbsterleben von Borderline-Patienten (exemplarisch an zwei Fallbeispielen), einen spirituellen Ansatz zur Erweiterung der Perspektive, Therapie der BPS (tiefenpsychologische Sicht, Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), stationäre Aspekte) und schließlich die Lebensweltorientierung durch sozialpädagogische Interventionen. Ein historischer Überblick über den Begriff "Borderline" ist ebenfalls enthalten.
Welche diagnostischen Aspekte der BPS werden beleuchtet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die diagnostischen Kriterien nach DSM-4, die Symptome der BPS (z.B. Impulskontrollverlust, Angst, Verlassenheitsängste, Selbstverletzung, Suizidalität, Dissoziation), Strukturmerkmale und Psychodynamik (Spaltung, Identitätsdiffusion, Projektion), und die Bedeutung der Gegenübertragung für die Diagnose.
Wie wird die Genese der BPS erklärt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung der BPS, darunter Bindungstheorien, die Rolle frühkindlicher Traumatisierung (Missbrauch, Misshandlung), Mahlers Theorie der Störung von Individuation und Loslösung, Kernbergs Theorie der oralen Traumatisierung und neurobiologische Faktoren. Der Fokus liegt auf dem Einfluss frühkindlicher Beziehungserfahrungen.
Welche Rolle spielen Fallbeispiele in der Arbeit?
Zwei Fallbeispiele veranschaulichen die Beziehungsgestaltung und das Selbsterleben von Borderline-Patienten. Sie dienen dazu, die theoretischen Überlegungen zu konkretisieren und die Herausforderungen und Möglichkeiten der therapeutischen Beziehung anhand konkreter Erfahrungen zu beleuchten.
Wie wird ein spiritueller Ansatz in die Betrachtung der BPS integriert?
Die Arbeit erweitert die Perspektive um einen spirituellen Ansatz, der die Rolle von Sinnfindung, Glaube und der Beziehung zu etwas "Überwertigem" im Kontext der Störung untersucht. Die Bedeutung von Leid, Selbstaufgabe und der Suche nach Selbstbegegnung wird im Zusammenhang mit spirituellen Aspekten beleuchtet.
Welche Therapieansätze werden diskutiert?
Die Arbeit beschreibt Therapieansätze aus tiefenpsychologischer Sicht (Beziehungsaufnahme, Widerstände, Deutung, Grenzsetzung), die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) mit ihren acht motivierenden Grundannahmen, Behandlungsphasen und dem besonderen Aspekt des Telefonkontakts, sowie stationäre Aspekte der Borderline-Therapie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS), Beziehungsgestaltung, Therapie, Beziehungserwartungen, frühkindliche Traumatisierung, Bindungstheorie, Spaltung, Diagnostik, DSM-4, Gegenübertragung, Psychodynamik, spiritueller Ansatz, Selbstaktualisierung, Suizidalität.
- Quote paper
- Carsten Eschrich (Author), 2004, Neue Modelle der Genese und Therapie von Borderline-Persönlichkeitsstörungen unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungsgestaltung und -erfahrung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30410